soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
5.8 Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit
Beim Handlungsfeld "Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit" geht es in erster Linie darum, durch den Abbau von Vorurteilen und Informationslücken sowie den gleichzeitigen Aufbau von Kommunikationsnetzen und systematischer Berichterstattung Impulse zur Beteiligung an der Stadtteilentwicklung zu geben, realistische Entwicklungsperspektiven für den Stadtteil zu thematisieren und Identifikationsmöglichkeiten mit den Quartieren zu schaffen (1). In der konkreten Arbeit vor Ort werden die Folgen von Negativimages und Vernetzungsdefiziten deutlicher erkennbar, als dies durch die in der Umfrage genannten Ziele und Probleme wiedergegeben wird (2). Bei den konkreten Maßnahmen und Projekten spielt das Handlungsfeld "Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit" in drei Vierteln der Programmgebiete eine Rolle und nimmt damit den zweiten Rang bei den Häufigkeiten der Nennungen von Handlungsfeldern ein (vgl. Tabelle 12). Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit sind Querschnittsaufgaben, die sich vor allem mit Maßnahmen und Projekten im Handlungsfeld "Stadtteilkultur" überschneiden.
![]() Probleme und Potenziale für Image- und Öffentlichkeitsarbeit
Probleme und Potenziale für Image- und Öffentlichkeitsarbeit
Das Negativimage eines Großteils der Programmgebiete - insbesondere in der Außensicht - erweist sich als ein Schlüsselproblem für Atmosphäre und Stimmung vor Ort. Eine teilweise tendenziös-negative Berichterstattung in Presse, Rundfunk und Fernsehen hat daran ihren Anteil. Sie beeinflusst die öffentliche Meinung, und gleichzeitig ist sie auch deren Spiegel. Medienberichte waren und sind - insbesondere zu Beginn der Programmumsetzung - viel zu häufig ausschließlich an Problemen und "alltäglichen Katastrophen" ausgerichtet. So wurde längere Zeit den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf fast pauschal das Stigma der schlechten Adresse angeheftet. Eine Darstellung als Gebiete, in denen allein Armut und Verwahrlosung, Konflikte und Aggression den Alltag prägen, fördert Hoffnungslosigkeit, blockiert Engagement und beeinträchtigt das Selbstwertgefühl der Bewohnerschaft. Im Verlaufe der Programmumsetzung - dies wird beispielsweise aus den Modellgebieten Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord und Cottbus - Sachsendorf-Madlow berichtet - gelingt es jedoch häufig, eine konstruktivere Berichterstattung anzustoßen, bei der auf Entwicklungskonzepte, Lösungsansätze und weiterführende Projekte eingegangen wird.
Informationsmängel in den Gebieten der Sozialen Stadt werden von vielen Seiten thematisiert. Vor allem im Rahmen von Veranstaltungen und in den Erfahrungsberichten der PvO-Teams wird die Unkenntnis in den Gebieten über vorhandene Initiativen, interessierte und engagierte Einzelpersonen sowie über Einrichtungen und Angebote beklagt (3). Mit Blick auf die Größe der Gebiete, die flächenmäßig im Durchschnitt zwölfmal größer sind als die traditionellen Sanierungsgebiete und in denen durchschnittlich 8 400 Menschen leben, verwundert dieser Mangel nicht. Die Probleme verweisen zugleich auf Potenziale für Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Diskrepanz zwischen differenzierterem Innenimage und teilweise vorurteilsbehaftetem Außenimage in positiver Richtung auszugleichen, erscheint als ein Ansatzpunkt. Die zwar in den Quartieren noch nicht allgemein bekannten, aber vielfach vor Programmstart bereits vorhandenen Initiativen und Aktivitäten bieten darüber hinaus die Chance, diese bekannt zu machen, weiter auszubauen und zu vernetzen.
![]() Strategien der Image- und Öffentlichkeitsarbeit
Strategien der Image- und Öffentlichkeitsarbeit
Insgesamt setzt sich zunehmend ein Verständnis durch, nach dem Öffentlichkeitsarbeit vor allem als Instrument von Aktivierungs- und Beteiligungsansätzen begriffen wird. Eine beteiligungs- und dialogorientierte Öffentlichkeitsarbeit gewinnt in den Programmgebieten an Bedeutung. Die bisher schon eingesetzte Maßnahmenpalette zur Stärkung eines positiven Quartiersimages ist bunt. Von den vielen bereits praktizierten Ansätzen der Öffentlichkeitsarbeit zeichnet das Diagramm (Abbildung 65) ein erstes Bild, wenn auch die einzelnen Kategorien nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen sind.
Als Träger der Öffentlichkeitsarbeit - dies wird aus den Erfahrungen in den Modellgebieten deutlich - treten vor allem die Quartiermanagement-Teams, aber auch Vereine, Initiativen, Wohnungsunternehmen, Projektträger und die Pressestelle der Verwaltung in Erscheinung. Insbesondere im Zusammenhang mit Imageförderung und Marketingstrategien wird in einzelnen Gebieten auch die lokale Wirtschaft aktiv (Bremen, Gelsenkirchen, Kassel). Insgesamt lassen sich aus den Maßnahmen und Projekten im Handlungsfeld "Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit" folgende drei charakteristischen Strategien ableiten: Förderung der Stadtteilöffentlichkeit sowie Informations- und Beteiligungsstrategien zur Programmumsetzung als eher innengeleitete Strategien, die im Schwerpunkt auf die Rezeption im Gebiet ausgerichtet sind; vor allem außengeleitet ist die Strategie Förderung einer positiven Präsenz in den Medien.
|
Abbildung 65: Elemente von Öffentlichkeitsarbeit (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
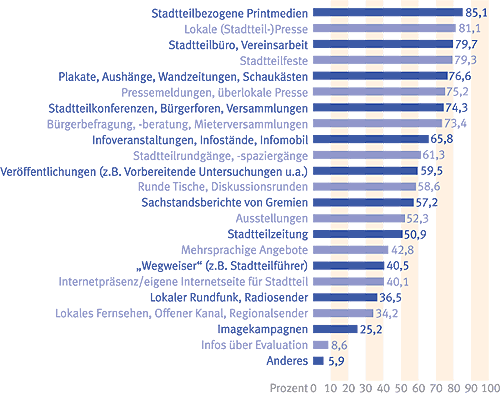 |
|
|
Insbesondere die Einrichtung von Stadtteilbüros als Orten der Informations- und Kontaktvermittlung (4), die Veranstaltung von Stadtteilfesten (für fast 80 Prozent aller Programmgebiete), gemeinsamen Stadtteilspaziergängen (5) (für 61 Prozent), Ausstellungen (6) (für 52 Prozent) und Lesungen sowie die Herausgabe von Stadtteilzeitungen (7) tragen zur Förderung der Stadtteilöffentlichkeit bei. In mehr als der Hälfte der Programmgebiete erscheinen Stadtteilzeitungen. Sie stellen die Plattform für eine Berichterstattung und Informationsstrategie dar, die mit Anschaulichkeit und verständlicher Sprache an der Alltagswelt der Bewohnerschaft anknüpft.
Wo sich die Bevölkerung und lokale Akteure mit eigenen Beiträgen beteiligen ("Kiezjournalisten" (8)) oder das Blatt sogar in eigener Regie herausgeben, bieten die Zeitungen auch die Chance zur Selbstdarstellung. Für das Modellgebiet Hamburg - Lurup wird die Stadtteilzeitung "Lurup im Blick" vom PvO-Team als eines der Schlüsselprojekte eingeordnet, weil es "der Information und dem Stadtteilmarketing zum Zweck der Imageverbesserung des Gebiets" dient (9). Darüber hinaus bieten eigens herausgegebene "Wegweiser", Führer, Infobroschüren und themenbezogene Pläne, Stadtteilkarten beispielsweise mit Verzeichnis von Vereinen, Treffpunkten, Sozialen Diensten usw. ein Informationsangebot, mit dem die Entwicklung von Stadtteilöffentlichkeit gestützt wird. 40 Prozent aller Programmgebiete verfügen auch bereits über eine Darstellung im Internet.
|
Praxisbeispiel |
Abbildung 66/67 |
 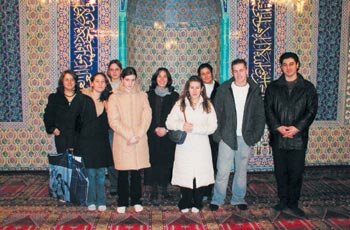 |
|
|
Südstadtkids in Nürnberg Galgenhof/Steinbühl Die Südstadtkids, ein Projekt an einer Nürnberger Hauptschule, erarbeiten Interviews, Reportagen, Kommentare oder Features für das Radio Südpol e.V. in Kooperation mit Radio Z. Dazu erlernen die Schülerinnen und Schüler technische Grundlagen wie Textverarbeitung, den Umgang mit digitalen Aufnahmegeräten und Soundsystemen sowie journalistische Techniken (Konzeption von Sendungen, Recherche und Schaffung von Spannungsbögen). Dabei werden sie von einer Lehrerin und professionellen Radio-Machern unterstützt. Die Südstadtkids wollen aber nicht nur journalistische Fähigkeiten erlernen und anwenden, sondern vor allem darüber berichten, was in der Nürnberger Südstadt, ihrem Lebensumfeld, passiert beispielsweise gab es Sendungen über Einrichtungen im Quartier und zu jüdischen Zeitzeugen, die über ihre Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs erzählten. |
|
Mit Aufnahme der Quartiere in das Programm Soziale Stadt wurden in vielen Gebieten umsetzungsbezogene Informations- und Beteiligungsstrategien (10) etabliert. Hierzu gehören Informationsveranstaltungen zu Planungs- und Umsetzungsstand des Programms - in den Modellgebieten waren dies beispielsweise die Themenund Starterkonferenzen -, die Durchführung von Bürgergutachten, Zukunftskonferenzen sowie Planungswerkstätten, die Veranstaltung von Stadtteilforen oder -konferenzen und die Einrichtung von Runden Tischen (11) .
|
Praxisbeispiel |
Abbildung 68 |
 |
|
|
Logo- und Sloganwettbewerb im Leipziger Osten im Sommer 2001 wurde ein Wettbewerb für die Entwicklung eines von allen lokalen und lokal wirksamen Akteuren kostenlos nutzbaren Logos und Slogans als Mittel zur Identitätsstiftung im Modellgebiet durchgeführt. Nachdem Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Themengruppe Image und Öffentlichkeitsarbeit einen Vorentscheid über die besten Entwürfe getroffen hatten, wurden im November 2001 während einer Sitzung des Forums Leipziger Osten das beste Logo und der beste Slogan ausgewählt und prämiert. Das Sieger-Logo mit dem Schriftzug Leipziger OSTEN soll für alle Aktivitäten, Veranstaltungen und Baumaßnahmen verwendet werden und überall dort präsent sein, wo über die vielen kleinen Erfolge im Leipziger Osten gesprochen wird. |
|
Mit Aufnahme der Quartiere in das Programm Soziale Stadt wurden in vielen Gebieten umsetzungsbezogene Informations- und Beteiligungsstrategien (10) etabliert. Hierzu gehören Informationsveranstaltungen zu Planungs- und Umsetzungsstand des Programms - in den Modellgebieten waren dies beispielsweise die Themenund Starterkonferenzen -, die Durchführung von Bürgergutachten, Zukunftskonferenzen sowie Planungswerkstätten, die Veranstaltung von Stadtteilforen oder -konferenzen und die Einrichtung von Runden Tischen (11).
Stadtteilzeitungen, Infoblätter, Flyer und andere im Gebiet produzierte Publikationen sind ein hilfreicher Bestandteil zur Verbesserung der Publizität im Gebiet; weiter aber kommt es darauf an, eine engagierte und wahrheitsgetreue Berichterstattung in den örtlichen und überörtlichen Medien - Presse, Funk, Fernsehen, Internet gleichermaßen - zu forcieren und zu kultivieren, insgesamt geht es damit um die Förderung einer positiven Präsenz in den Medien (12). Dabei kann es nicht - wie bei professionellen PR-Konzepten - darum gehen, Signets und Slogans zu entwickeln, die sich von der konkreten Situation lösen; vielmehr besteht Konsens darüber, dass alle Bemühungen um ein positives Image nur als Echo auf reale Verbesserungen aufgebaut werden können. Lösungsansätze und Projekte sind ins Blickfeld zu rücken; dies bedeutet nicht, auf kritische Reflexion zu verzichten. Bisher sind für ein Viertel der Programmgebiete eigene Imagekampagnen durchgeführt worden. Außerdem dienen medienwirksame Aktionen (Plakatierungen, Stadtteilfeste unter besonderem Motto, Funk- oder Fernsehspots) dazu, den Quartieren ein eigenes Gepräge zu geben; ein Beispiel dafür sind die Videoclips "Gröpelingen - viel besser als man glaubt", die in den Kinos im Vorprogramm laufen. Für das Modellgebiet Leipziger Osten wird der Logo- und Slogan-Wettbewerb von 2001 sogar als Schlüsselprojekt eingeschätzt (13).
|
Tabelle 13: |
||||||||||||
|
sehr negativ verändert |
negativ verändert |
gleich geblieben |
verbessert |
sehr stark verbessert |
weiß nicht |
|||||||
|
abs. |
% |
abs. |
% |
abs. |
% |
abs. |
% |
abs. |
% |
abs. |
% |
|
|
Außenimage des Gebiets (n=205) |
1 |
0,5 |
10 |
4,9 |
93 |
45,4 |
69 |
33,7 |
18 |
8,8 |
14 |
6,8 |
|
Innenimage des Gebiets (n=204) |
- |
- |
4 |
2,0 |
45 |
22,1 |
121 |
59,3 |
22 |
10,8 |
12 |
5,9 |
|
Identifikation mit dem Gebiet (n=203) |
- |
- |
4 |
2,0 |
49 |
24,1 |
110 |
54,2 |
24 |
11,8 |
16 |
7,9 |
|
Presseberichterstattung (n=204) |
- |
- |
7 |
3,4 |
35 |
17,2 |
113 |
55,4 |
38 |
18,6 |
11 |
5,4 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||||||||||||
Die Wirkungen bisheriger Öffentlichkeitsarbeit werden insgesamt von den kommunalen Ansprechpartnerinnen und -partnern für das Programm Soziale Stadt recht positiv eingeschätzt. Für das Innenimage, die Identifikation mit den Quartieren und die Presseberichterstattung über die Gebiete wird jeweils für etwa zwei Drittel der Programmgebiete konstatiert, dass eine Verbesserung bewirkt werden konnte. Hinsichtlich der Entwicklung des Gebietsimages nach außen drücken sich in den Einschätzungen eher Zurückhaltung und Skepsis aus: Hier weist zum einen der Anteil der Unentschiedenen ("gleich geblieben") mit 45 Prozent den höchsten Anteil auf, zum anderen wird nur für 42 Prozent der Programmgebiete vermutet, dass sich das Außenimage verbessert hat.
(1) Vgl. dazu Heidede Becker, Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt". Raumbezüge und Handlungsfelder, in: Die alte Stadt, H. 2 (2000), S. 148 f. ![]()
(2) Bei den Angaben zu Zielen der Programmumsetzung wurde nur für 15 Prozent der Programmgebiete die "Verbesserung des Gebietsimages" als Ziel genannt. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass für das Gros der Gebiete (Gebiete der Programmjahre 1999 und 2000) die Beantwortung im Rahmen der ersten Befragung erfolgte, also noch sehr am Anfang der Programmumsetzung. ![]()
(3) Dazu beispielsweise Klaus Selle im Rahmen der Podiumsdiskussion "Die soziale Stadt - Vielfalt und Zukunft" auf dem Zwischenbilanz-Kongress im Mai 2002: "Die wissen nicht, dass es da beim Sportverein jemand gibt, der sich verantwortlich für die Jugend im Stadtteil fühlt. Und die wissen nicht, dass der Schulleiter nebenan im Rahmen eines Bund-Länder-Modellversuchs gerade autonome Schule probt und den Stadtteil hereinholt. Die wissen nichts voneinander, und es gibt keinen, der systematisch Verbindungen herstellt." (abgedruckt in: Deutsches Institut für Urbanistik [Hrsg.], Kongress, S. 88) ![]()
(4) Vgl. hierzu folgende Projekte in der Datenbank: Stadtteilbüro und Stadtteiltreff in Emden-Barenburg; Stadtteilbüro Flensburg - Neustadt; URBAN-Büro Kiel; Stadtteilmanagement Gaarden in Kiel - Gaarden. ![]()
(5) Vgl. hierzu folgendes Projekt in der Projektdatenbank: "Stadt Deiner Träume", Stadtteilerkundung mit der Kamera in Düsseldorf - Flingern-Oberbilk. ![]()
(6) Vgl. hierzu in der Datenbank: "Es hat sich viel verändert" - Menschen und Meinungen aus dem Piusviertel in Ingolstadt (Fotoausstellung über die Bewohnerschaft). ![]()
(7) Vgl. hierzu folgende Projekte in der Datenbank: "Lurup im Blick", Informationen und Ideen für Hamburg-Altona - Lurup; Stadtteilzeitung "VorOrt" in Ahlen - Süd-Ost (Online-Zeitung als Qualifizierungsprojekt); "Soziale Stadt". Stadtteilmagazin Leipziger Osten. ![]()
(8) Beer/Musch, "Stadtteile ...", S. 139. ![]()
(9) Ingrid Breckner und Heike Herrmann, Hamburg-Altona - Lurup, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Die soziale Stadt, S. 145. ![]()
(10) Vgl. hierzu die folgenden Projekte in der Projektdatenbank: Bürgergutachten zur Aufwertung des Gottesauer Platzes in Karlsruhe - Oststadt/West; Bürgerbeteiligung im Piusviertel in Ingolstadt (Zukunftswerkstatt, Stadtarbeitskreise und zielgruppenspezifische Workshops); Umweltinitiative Dortmund - Scharnhorst-Ost (Projekt zur Steigerung der Wohn- und Umweltqualität). ![]()
(11) Vgl. hierzu weiter Kapitel 8 "Aktivierung und Beteiligung". ![]()
(12) Vgl. die folgenden Projekte in der Projektdatenbank: Ein neues Image für den Fischbacherberg (Stadtteilaufwertung in Siegen - Fischbacherberg); StadtTEILmarketing für Kiel - Gaarden; Ideenwettbewerb zur Namensgebung - ein neuer Name für den Stadtteil im Norden von Langen (Langen - Nordend); Medienwerkstatt/Koordinierte Pressearbeit zur Imageverbesserung in Singen - Langenrain. ![]()
(13) Dabei ging es darum, unter Beteiligung der Bevölkerung zu einem griffigen Logo für den Stadtteil zu kommen. Den Zuschlag erhielt der Slogan "Im Osten geht die Sonne auf"; er kann nun mit dem entsprechenden Logo von allen Akteuren kostenlos genutzt werden und so zur "Identitätsstiftung im Modellgebiet" beitragen; vgl. dazu Christa Böhme und Thomas Franke, Leipzig - Leipziger Osten, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Die Soziale Stadt, S. 205. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005