soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Drei Jahre Programm Soziale Stadt eine ermutigende Zwischenbilanz |
|
|
Heidede Becker |
Vorbemerkungen 
Das Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf die soziale Stadt« (kurz: Soziale Stadt) wurde politisch mit der Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen 1998 beschlossen. Im September 1999 wurde das Programm durch Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern etabliert. Es stellt eine Ergänzung zur baulich-räumlich orientierten traditionellen Städtebauförderung dar. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) hat dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) für die erste Phase der Programmumsetzung (Ende 1999 bis Frühjahr 2003) die Funktion einer Vermittlungs-, Beratungs- und Informationsagentur übertragen, die mehrere zentrale Aufgaben umfasst (vgl. Graphik): Der hohe Bedarf an Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zur Umsetzung des Programms war maßgeblich für die Entscheidung, ein bundesweites Netzwerk zur Sozialen Stadt aufzubauen, das unter anderem aus folgenden Elementen besteht: zentrale und dezentrale Veranstaltungen, kontinuierliches Berichtswesen (»Infos zur Sozialen Stadt« und »Arbeitspapiere zur Sozialen Stadt«) und Internetpräsentation (sozialestadt.de) mit Informationen zum Programm, den beteiligten Gebieten, zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie Datenbanken zu Projekten und Maßnahmen im Sinne der Sozialen Stadt und zu Literatur.
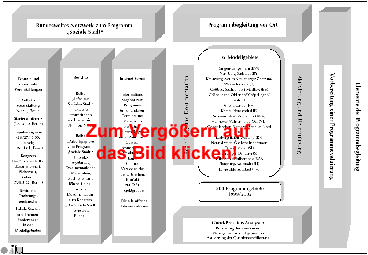 |
Elemente der Programmbegleitung |
Als zweites zentrales Element der bundesweiten Programmbegleitung wurde im Sommer 2000 die Programmbegleitung-vor-Ort (PvO) in den 16 von den Ländern ausgewählten Modellgebieten der Sozialen Stadt eingerichtet; die dort gesammelten Erfahrungen stehen im Mittelpunkt dieses Begleitbuchs (Kapitel 2). Der besseren Einschätzung der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von Maßnahmen und Projekten dient außerdem eine »good-practice«-Analyse sie wird auf Basis der im Frühjahr 2001 im Internet geschalteten und seitdem kontinuierlich fortgeschriebenen Projektdatenbank vorgenommen. Die Befunde dieser Untersuchung, die Ergebnisse zweier Befragungen zu den Gebieten der Sozialen Stadt (Programmjahre 1999, 2000 und 2002) und die Erkenntnisse der Programmbegleitung-vor-Ort sind Teil der Vorbereitung einer bundesweiten Evaluierung des Programms Soziale Stadt.
Die hiermit vorgelegte erste Bilanz zum Programm Soziale Stadt nach einer Laufzeit von knapp drei Jahren basiert auf
- Erfahrungen aus vielen bundesweiten, regionalen und lokalen Veranstaltungen sowie den beiden vom Difu gemeinsam mit dem BMVBW veranstalteten Impulskongressen (zum Quartiermanagement im Oktober 2000 in Leipzig, zum integrativen Handeln im November 2001 in Essen);
- Ergebnissen der ersten Difu-Umfrage, bei der Probleme, Potenziale, Ziele und (geplante) Maßnahmen im Vordergrund standen (1);
- Zwischenberichten zur ersten Phase der Programmbegleitung-vor-Ort;
- Ergebnissen eines Strategieworkshops zur Mittelbündelung, an dem auch die Städtebauförderungsreferenten des Bundes und der Länder teilnahmen, sowie zweier Treffen von Netzwerken, deren Arbeitsinhalte sich auf Themen der Sozialen Stadt beziehen;
- Mitarbeit in Arbeitskreisen und Netzwerken (z.B. Netzwerk »Kommunen der Zukunft«, Arbeitsgruppe »Soziale Stadt« der Fachkommission Städtebau der Bauministerkonferenz).
1. |
Soziale Stadt ein Programm gegen soziale und räumliche Ausgrenzung
|
Trotz seiner kurzen Laufzeit ist die öffentliche Resonanz auf das Programm Soziale Stadt bereits jetzt sehr groß. Es hat in vielen als benachteiligt eingestuften Stadtteilen Aufbruchstimmung erzeugt. In den beteiligten Kommunen gibt es neu geschaffene Organisations- und Managementformen für integrierte Stadtteilentwicklung von ressortübergreifenden Arbeitsgruppen auf der Verwaltungsebene bis zu Stadtteilbüros in den Quartieren –, man berücksichtigt die unterschiedlichsten Probleme, aber ebenso die Potenziale in benachteiligten Stadtteilen, wie sie im Rahmen vielfältiger Maßnahmen- und Projektlandschaften anzutreffen sind, und bezieht die lokalen Akteure in Prozesse und Entscheidungen ein. Dies alles dient in den meisten Fällen nicht nur der »technischen« Programmumsetzung, sondern spiegelt vielmehr die Entstehung einer neuen »Philosophie« gebietsbezogenen und ganzheitlichen Verwaltungshandelns auf der Basis eines intensiven Dialogs zwischen Bewohnerschaft, Politik und Verwaltung wider.
Damit kann das Programm Soziale Stadt auch als ein Pilotprojekt für eine Reform der Stadterneuerungspolitik, vielleicht sogar einer Stadtpolitikerneuerung insgesamt gesehen werden. Dafür spricht auch das breite Interesse an dem Programmansatz in Politik und Verwaltung, in Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden, Organisationen und Initiativen, das sich beispielsweise in zahlreichen Veranstaltungen und Publikationen sowie in der Entwicklung von programmbezogenen Studiengängen und Fortbildungsmaßnahmen niederschlägt.
Das Programm Soziale Stadt basiert zu einem großen Teil auf Vorerfahrungen einiger europäischer Nachbarstaaten und einzelner Bundesländer mit spezifischen Landesprogrammen. Insbesondere das bereits seit 1993 laufende nordrhein-westfälische Landesprogramm »Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf« (ILS 2000) sowie das 1994 begonnene Hamburger »Pilotprojekt zur Armutsbekämpfung« (Freie und Hansestadt Hamburg 1997) spielten eine wichtige Vorreiterrolle. Darüber hinaus flossen Erkenntnisse aus anderen europäischen Ländern insbesondere aus Frankreich, England und den Niederlanden sowie Ergebnisse aus der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN I in die Gestaltung des Programms ein. In der 1996 gestarteten Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt der ARGEBAU (heutige Bauministerkonferenz) wurden diese Erkenntnisse zusammengetragen, im Laufe des Prozesses auch durch Erfahrungen aus den jüngeren Landesprogrammen in Hessen, Berlin und Bremen ergänzt sowie mit dem Ziel gebündelt, bundesweit eine »nachhaltige Aufwärtsentwicklung« in »Stadtteilen mit Entwicklungspriorität« zu sichern (ARGEBAU 2000). Ergänzende konzeptionelle Vorarbeiten für die Ausgestaltung des Bund-Länder-Programms wurden vom Deutschen Institut für Urbanistik unter anderem im Rahmen der Anhörung des Deutschen Bundestages zur Städtebauförderung Anfang 1997 sowie mit einer Wirkungsuntersuchung bisheriger bundesweiter Stadterneuerungsprogramme geleistet (Becker u.a. 1998).
Aufgrund der Neuartigkeit des Programmansatzes wurde eine besondere Form für dessen Implementierung gewählt: Am 5.7.1999 wurde das Programm in Berlin im Rahmen einer Auftaktveranstaltung bundesweit publik gemacht. Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Bereichen informierten sich über Erfahrungen, die in Großbritannien und den Niederlanden mit vergleichbaren Ansätzen gesammelt worden waren, sowie über Hintergründe, Zielsetzungen und die konkrete Ausgestaltung dieses neuen, von vielen sehr begrüßten Programmansatzes zur Bekämpfung der wachsenden sozialen und räumlichen Spaltung in deutschen Städten. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten, die unter anderem der Komplexität des neuen Programms geschuldet waren, konnte es zum Jahresende in die Umsetzungsphase überführt werden. Weitere Grundsteine für die Durchführung des Programms wurden Anfang März 2000 auf der »Starterkonferenz« in Berlin mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelegt: Sowohl von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und dem damaligen Vorsitzenden der ARGEBAU als auch von Verantwortlichen aus den 16 Modellgebieten wurden unterstützt von Fachleuten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen erste Erfahrungen mit integrierter Stadtteilentwicklung vermittelt. Auch die jeweils mit mehreren hundert Teilnehmenden sehr gut besuchten Impulskongresse zum Quartiermanagement im Herbst 2000 in Leipzig und zu integrierten Handlungskonzepten ein Jahr später in Essen ließen das breite Interesse an der neuen Programmphilosophie erkennen, aber auch die noch verbreiteten Unsicherheiten bei der Programmumsetzung.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen durchaus auch, dass zwischen der Formulierung von Visionen und Zielen auf der programmatischen Ebene und der konkreten Arbeit in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf zum Teil erhebliche Diskrepanzen bestehen. Befürchtungen eines gewissen Verlusts von Macht und Einfluss, Sorge vor einer Deprofessionalisierung öffentlicher Leistungserbringung sowie Angst um die eigene finanzielle Ausstattung begründen bei einigen Akteuren auch Widerstand und Reibungsverluste. Auch die mancherorts vorhandenen überzogenen Erwartungen rascher und messbarer Erfolge führen bei vielen Beteiligten eher zu überzogener Ungeduld. Ohne langen Atem und Beharrlichkeit aber wird das Programm angesichts der Komplexität der Probleme und der Unumgänglichkeit grundlegender Arbeit in den Gebieten der Sozialen Stadt keinen nachhaltigen Erfolg haben. Erfahrungen aus dem europäischen Ausland belegen, dass eine auf Nachhaltigkeit angelegte soziale und wirtschaftliche Stadtteilentwicklung nicht in kurzen Fristen erreichbar ist.
1.1 Programmhintergrund: Die Entstehung benachteiligter Stadtteile 
Die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Veränderungen seit Ende der 60er-Jahre finden ihren räumlichen Niederschlag in einer wachsenden sozialen und stadträumlichen Fragmentierung mit der Folge einer selektiven Auf- und Abwertung einzelner Stadtteile (Franke/Löhr/Sander 2000, S. 244–246). Dabei spielt die starke Segmentierung des Wohnungsmarktes eine wesentliche Rolle: So hat sich seit Anfang der 1980er-Jahre beispielsweise die Zahl der Belegungsbindungen bei gleichzeitig starkem Anstieg von Haushalten, die auf den Bezug von Transferleistungen angewiesen sind, bundesweit mehr als halbiert. Alternativen auf dem sich in vielen Städten entspannenden freien Wohnungsmarkt sowie die eher geringe Attraktivität der verbliebenen Sozialwohnungen veranlassen Bewohnerinnen und Bewohner mit vergleichsweise höheren Einkommen zum Fortzug aus benachteiligten Gebieten dies gilt für die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. In die frei werdenden Wohnungen ziehen sodann vor allem Haushalte mit Migrationshintergrund dies gilt überwiegend für die alten Bundesländer sowie einkommensschwache deutsche Haushalte. Durch fortschreitende soziale Entmischung und die dadurch entstehende Konzentration benachteiligter Haushalte wachsen und verstärken sich in vielen Quartieren soziale Konfliktpotenziale. In den neuen Bundesländern leiden viele Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf darüber hinaus unter wachsendem Leerstand aufgrund negativer Wanderungssalden.
Bundesweit ist spätestens seit Beginn der 1990er-Jahre eine neue Form sozialer und (stadt-)räumlicher Ungleichheit festzustellen, die sich unter anderem in der Herausbildung benachteiligter Quartiere niederschlägt. Solche Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf sind meistens durch eine Mischung komplexer, miteinander zusammenhängender Probleme charakterisiert. Zu den häufigsten gehören:
- hoher Sanierungs- und Modernisierungsbedarf bis hin zu Verfallserscheinungen, Desinvestition, Wohnumfeldmängel, hohe Bebauungsdichte und hoher Versiegelungsgrad, Verkehrsprobleme, oftmals eingeschränkte Erreichbarkeit;
- fehlende Grün- und Freiflächen, Lärm- und Abgasbelastungen;
- schlechte Versorgungsinfrastruktur, unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur, mangelndes Freizeitangebot vor allem für Kinder und Jugendliche;
- Deindustrialisierung, Rückgang von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, zurückgehendes oder fehlendes Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot;
- überdurchschnittlich hohe Jugend- und/oder Langzeit-Arbeitslosigkeit, überdurchschnittlich starke Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, Kaufkraftverlust, Armut;
- Überalterung der deutschen Bevölkerung, überproportional starke Zuwanderung von benachteiligten Haushalten und solchen mit Migrationshintergrund (in Westdeutschland liegt der Anteil in den entsprechenden Stadtteilen bei durchschnittlich 25 Prozent gegenüber 13 Prozent in den Gesamtstädten; in Ostdeutschland bei rund 4 Prozent in Gesamtstädten und benachteiligten Stadtteilen), hoher Anteil Alleinerziehender (vor allem Frauen), Abwanderung einkommensstärkerer Haushalte, hohe Fluktuation, zunehmender Wohnungsleerstand vor allem in Ostdeutschland;
- Konzentration benachteiligter Haushalte, Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Vandalismus und Kriminalität, mangelnde Gesundheitsvorsorge, schulische Probleme bei Kindern und Jugendlichen, fehlendes Zusammengehörigkeitsgefühl, Vereinsamung, Anonymität, Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, Drogen- und Alkoholmissbrauch, geringe Eigeninitiative der Bewohnerinnen und Bewohner;
- Negativimage sowohl in der Innen- als auch in der Außenwahrnehmung.
Nahezu für alle in der ersten Difu-Umfrage erfassten Stadtteile werden soziale Schwierigkeiten und Belastungen sowie Mängel der Wohnungen und des Wohnumfelds als Probleme genannt (mehr als 95 Prozent), für deutlich über 80 Prozent der Gebiete auch Defizite der Nahversorgung und der (Stadtteil-) Zentren, für etwa drei Viertel fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten und ein Mangel an Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosigkeit in den Programmgebieten liegt mit durchschnittlich 19 Prozent weit über den Durchschnittszahlen der jeweiligen Städte (13 Prozent). Für die Hälfte aller Gebiete gilt, dass deutlich mehr als ein Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner keine Arbeit hat. Dies trifft für die alten wie auch die neuen Bundesländer fast gleichermaßen zu. Auch die Quote der Sozialhilfeempfänger übersteigt in den Modellgebieten den gesamtstädtischen Durchschnitt deutlich.
In vielen benachteiligten Quartieren gibt es keine ausgeprägten sozialen Netzwerke mehr. In einigen Gebieten ist die Entstehung einer »abweichenden Kultur« von Kindern und Jugendlichen zu beobachten, die in einem Umfeld mit nur wenigen positiven Vorbildern und Repräsentanten eines »normalen« Lebens den Sinn von Schule, Ausbildung und Beruf nicht mehr vermittelt bekommen. Staatliche Transferleistungen und Kleinkriminalität ersetzen in einem durch Arbeitslosigkeit geprägten Umfeld oftmals Arbeit als materielle Basis für Lebensunterhalt und Konsum. Viele benachteiligte Stadtteile sind mit dem Verlust der Anerkennung durch die gesellschaftliche Mehrheit konfrontiert; ihnen haftet oftmals ein Negativimage an. Die ungünstigen Rahmenbedingungen, die sich in vielen Stadtteilen finden, wirken zusätzlich benachteiligend: Benachteiligte Quartiere sind somit oft zugleich benachteiligende Quartiere.
Die dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohner sind gleich mehrfach ausgegrenzt: in ökonomischer Hinsicht, da vielen von ihnen aufgrund des Mangels an passenden Qualifikationen der Zutritt zum ersten Arbeitsmarkt dauerhaft verwehrt bleibt; kulturell durch den Verlust des Selbstwertgefühls aufgrund von Stigmatisierung und Diskriminierung; in sozialer Hinsicht durch Abkopplung von der gesellschaftlichen Mehrheit »aufgrund sozialer Isolation und einem Leben in einem geschlossenen Milieu« (Häußermann 2000, S. 13); und schließlich institutionell, da der Kontakt zwischen Betroffenen und politischen oder sozialstaatlichen Institutionen immer schwächer wird.
Gleichzeitig gibt es in allen Gebieten aber auch eine Vielzahl von Potenzialen: In der Difu-Umfrage von 1999/2000 wurde überwiegend der baulich- städtebauliche Bereich genannt Instandsetzungs- und Modernisierungsmöglichkeiten in der vorhandenen Bausubstanz, Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Grün-, Frei- und Brachflächen sowie des öffentlichen Raums; doch gab immerhin mehr als die Hälfte der Kommunen an, dass sie wichtige Potenziale zudem im lokalökonomischen Bereich, in Neuansiedlungsmöglichkeiten von Gewerbe und Existenzgründungen sehen, aber auch und vor allem Potenziale in den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern selbst als zentralen Akteuren der Stadtteilentwicklung.
1.2 Programmansatz: Die »Abwärtsspirale« unterbrechen 
Ohne sozialstaatliche Intervention wird sich die Abwärtsspirale einiger benachteiligter Stadtteile immer weiterdrehen. Die hier ablaufenden Prozesse verstärken sich selbst, wenn sie nicht durch koordinierte Anstrengungen von Politik, Verwaltung, Bewohnerinnen und Bewohnern, Wirtschaft und lokal relevanten Akteuren unterbrochen werden. Es sind Ansätze einer integrierten Stadtteilpolitik notwendig, die sich auf das Quartier als Ganzes richten und die es erlauben, die vorhandenen Potenziale zur Verbesserung der lokalen Lebensverhältnisse und den Aufbau möglichst selbsttragender Strukturen zu fördern. Für diese Aufgabe sind die bisherigen sektoralen Vorgehensweisen der einzelnen Fachbereiche nicht mehr geeignet; außerdem lässt sich eine zunehmende Diskrepanz zwischen sozial-ökonomischen Problemen und baulich-technischen Maßnahmen konstatieren. Daher und weil die Städte die Herausforderungen, mit denen sie durch die kritische Entwicklung in vielen Quartieren konfrontiert sind, nicht alleine bewältigen können, wurde vom BMVBW im Juli 1999 entsprechend der Koalitionsvereinbarung das Programm Soziale Stadt aufgelegt. Zu seinen Kernelementen gehören laut Verwaltungsvereinbarung folgende grundsätzliche Punkte:
- Die bisherige Städtebauförderung wird durch das Programm Soziale Stadt ergänzt, mit anderen stadtentwicklungspolitisch relevanten Politikfeldern verbunden und daraus ein neuer integrierter Ansatz entwickelt.
- Ziel dieses umfassenden Programmansatzes ist es, investive und nicht investive Maßnahmen aus verschiedenen Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerung zu kombinieren und zu integrieren, um über ein Programm »aus einer Hand« zu verfügen.
- Als Grundlage für die Programmumsetzung Soziale Stadt ist von den teilnehmenden Kommunen ein auf Fortschreibung angelegtes, gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept aufzustellen. Die Umsetzung des Programms stellt hohe Anforderungen an effizientes Verwaltungshandeln, insbesondere in Bezug auf
- Mittelbündelung, Integration und Kooperation,
- Aktivierung und Beteiligung lokaler und lokal wirksamer Akteure sowie
- das Etablieren neuer Management- und Organisationsformen.
Zwar bezieht sich das Programm Soziale Stadt auf ausgewählte Gebiete, doch sollen gesamtstädtische Zusammenhänge stets berücksichtigt werden, um die Entwicklungsdynamik eines Quartiers in ihren Wechselwirkungen mit anderen regional- und stadträumlichen Einheiten beobachten und analysieren zu können. Gefordert ist daher nicht nur ein ressortübergreifender, sondern gleichzeitig auch ein gebietsübergreifender Ansatz der Stadterneuerung und Stadtentwicklung.
Der Bund stattete das Programm, das wie die Städtebauförderung jährlich fortzuschreiben ist, zunächst mit 100 Mio. DM jährlich aus; seit dem Jahr 2001 stellt der Bund 150 Mio. DM bereit. Da Länder und Kommunen die Bundesförderung mit weiteren 300 Mio. DM kofinanzieren, steht für das Programm zur Zeit ein Gesamtvolumen von rund 230 Mio. Euro (das wären 450 Mio. DM) jährlich zur Verfügung. Diese Summe soll im Rahmen einer Verstetigung des Programms möglichst gehalten werden, so Bundesminister Bodewig im Herbst 2001 auf dem Impulskongress »Integratives Handeln für die soziale Stadtteilentwicklung« in Essen-Katernberg.
1.3 Programmgebiete: Auswahl und Zuschnitt 
Voraussetzung für den Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung dies gilt auch für das Programm Soziale Stadt ist die Ausweisung von Gebieten. Die Gebietskulisse der Sozialen Stadt ist sehr heterogen; sie umfasst aber ausschließlich Gebiete mit hoher Problemdichte. Die Tatsache, dass mit dem Programm Soziale Stadt allein die aufgeworfenen Probleme nicht zu lösen sind, verweist auf die Notwendigkeit, dass stadtteilbezogene Aktivitäten durch gesamtstädtische Strategien ergänzt werden müssen; der »besondere« Entwicklungsbedarf in den Programmgebieten der Sozialen Stadt setzt den gesamtstädtischen Vergleich voraus, denn es muss begründet werden, dass für diese Gebiete im Vergleich zu anderen Stadtteilen ein dringlicherer Handlungsbedarf besteht und ihrer Entwicklung eine höhere Priorität einzuräumen ist. Dabei sollte das Auswahlverfahren transparent und nachvollziehbar sein, um auch kommunalpolitisch legitimiert werden zu können. Eine fundierte Auswahl der Programmgebiete erfordert allerdings genaue Daten über den Ist-Zustand von Stadtquartieren und der Gesamtstadt Daten, die erst in wenigen Städten durch kontinuierliche Herausgabe von Sozialraumberichten beispielsweise zur Sozialen Lage, zu Armut und Gesundheit oder den Aufbau von Monitoring- Systemen vorliegen (z.B. in Berlin, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und München).
1999 wurden von den Bundesländern insgesamt 161 Stadtteile in 124 Städten und Gemeinden ins Programm Soziale Stadt aufgenommen; inzwischen sind 249 Stadtteile in 184 Städten und Gemeinden Programmgebiete der Sozialen Stadt (2). Allein in den Programmgebieten der Jahre 1999 und 2000 leben etwa 1,8 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner. Die neuen Bundesländer sind mit einem Fünftel der Gebiete beteiligt. Gut die Hälfte (54 Prozent) der Programmgebiete liegt in Großstädten mit mehr als 100 000 Einwohnern, davon 23 Prozent in Städten mit über 500 000 Einwohnern. Fast ein Drittel aller Gebiete gehört zu Städten mit weniger als 50 000 Einwohnern. Damit handelt es sich beim Programm Soziale Stadt nicht um ein Großstadtprogramm, wie von manchen vermutet wurde. Nach ihrer Lage in der Stadt handelt es sich um jeweils gut ein Drittel Stadtrandgebiete und Stadtteile in innerstädtischer Randlage, in knapp einem Fünftel der Fälle geht es um Innenstadtgebiete.
Zwei Quartierstypen zeichnen sich schon länger als Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf ab: zum einen verdichtete, häufig gründerzeitliche, auch altindustrialisierte, teilweise vernachlässigte Altbaugebiete, manchmal mit einem vielfältigen Nebeneinander kleinteiliger Siedlungsstrukturen, und zum anderen überwiegend industriell gefertigte Neubausiedlungen der 60er- bis 80er-Jahre, die westlichen Großtafel- und die östlichen Plattensiedlungen, die mit 44 Prozent fast die Hälfte der Gebiete ausmachen. Dieser hohe Anteil an Neubau-Großsiedlungen verweist auf die besondere Bedeutung, die den Wohnungsunternehmen als Trägern und Akteuren der integrierten Stadtteilentwicklung zukommt.
 |
Bund-Länder-Programm »Die Soziale Stadt« und URBAN II - Städte |
Bereits im Rahmen der traditionellen Städtebauförderung spielten und spielen Fragen der Gebietsauswahl, der Größe und des Zuschnitts der Gebiete eine besondere Rolle für die Programmumsetzung, wobei Fragen der Finanzierbarkeit und der zügigen Durchführung im Vordergrund standen. Dementsprechend war der Zuschnitt der Sanierungsgebiete mit bundesweit durchschnittlich 10,6 Hektar (1984) relativ klein (Autzen u.a. 1986, S. 51 f.). Dagegen sind die Programmgebiete zur Sozialen Stadt mit einer durchschnittlichen Größe von 116 Hektar mehr als zehn mal so groß. Dies kann als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass die Stadterneuerungsphilosophie, die nicht mehr allein auf städtebauliche Missstände ausgerichtet ist und sich stärker an integrierten Ansätzen orientiert, auch Veränderungen von Gebietsauswahl und -zuschnitt zur Folge hat. Eine Betrachtung der Stadtteile nur nach siedlungsstrukturellen, räumlichfunktionalen Aspekten ist nicht mehr sachgerecht.
Die Größe der für die Soziale Stadt ausgewählten Gebiete schwankt beträchtlich; sie bewegt sich zwischen 950 Hektar (Boy/Welheim in Bottrop) und 0,5 Hektar (Ortskern Spiesen im Saarland). Die mit Abstand größten Gebiete hat das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Durchschnittswert von 301 Hektar ausgewiesen, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 161 Hektar großen Gebieten. Die kleinsten Programmgebiete finden sich in Baden-Württemberg (35 Hektar) und Rheinland-Pfalz (39 Hektar).
Die durchschnittliche Einwohnerzahl der Gebiete beträgt 9 200 mit deutlichen Differenzen zwischen alten (8 400) und neuen (11 600) Bundesländern; darin spiegelt sich der deutlich höhere Anteil an Großsiedlungen in den neuen Ländern wider. Die erhebliche Bandbreite in der einwohnerbezogenen Gebietsgröße wird besonders augenfällig, wenn man sich beispielsweise die einwohnerschwächsten Gebiete (Schwabach Schwalbenweg mit nur 60 Einwohnern oder Husterhöhkaserne in Pirmasens mit 107 Einwohnern) und die einwohnerstärksten (Dortmund Nördliche Innenstadt mit rund 54 000 und Flingern/Oberbilk in Düsseldorf mit 42 000 Einwohnern) vor Augen führt. Bei den bevölkerungsreichsten Gebieten mit mehr als 25 000 Einwohnern fallen einerseits umfangreiche gründerzeitliche Altstadtquartiere auf (z.B. Leipziger Osten, Köln-Kalk, Bremen-Gröpelingen), andererseits die östlichen Plattenbausiedlungen (z.B. Halle-Neustadt, Berlin-Marzahn, Jena-Lobeda).
Manche Städte haben also sehr große Areale ausgewiesen mit einer Vielzahl von Teilräumen, in denen teilweise »soziale Brennpunkte« oder »Probleminseln« identifiziert werden. Bei anderen scheint dagegen eher die im Wesentlichen investiv ausgerichtete Städtebauförderung die Sicht bestimmt zu haben. Sehr kleine Gebiete, deren Zuschnitt sich fast ausschließlich am Investitionsvolumen der baulich-städtebaulichen Maßnahmen orientiert, stehen dann eher quer zu Erfordernissen der Sozialen Stadt, wenn eine Berücksichtigung von Potenzialen des Umfelds beispielsweise zur Förderung der lokalen Ökonomie ausgeblendet oder benachbarte Infrastruktur in Entwicklungs- und Nutzungskonzepte nicht einbezogen wird. Vor diesem Hintergrund wird beispielsweise in der nordrhein-westfälischen Evaluationsstudie für eine »erweiterbare flexible Gebietsabgrenzung« plädiert (ILS 2000, S. 18) oder auf dem Impulskongress zum Integrativen Handeln für die Berücksichtigung von »Ergänzungsgebieten«, die »institutionell abgesichert« werden sollten (Spiegel o.S.).
2. |
Ressourcenbündelung neue Kooperationsformen und zielgerichteter Mitteleinsatz
|
Das wichtigste Element zur Initiierung einer Aufwärtsentwicklung in den Gebieten der Sozialen Stadt ist die Entwicklung guter Ideen engagierter Netzwerke, gekoppelt mit der Bereitstellung von Fördermitteln. Dabei kommen neben den Mitteln des Programms Soziale Stadt selbst auch Mittel weiterer Förderprogramme zum Einsatz. Ressourcenbündelung im Sinne des Bund- Länder-Programms »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf die soziale Stadt« ist dabei ein strategischer Ansatz zum gebietsorientierten Einsatz von vorhandenen Ressourcen. Sie beschränkt sich nicht auf die Verbindung von verschiedenen Fördertöpfen zur Finanzierung einer Maßnahme oder eines Projekts. Zur Umsetzung dieser Strategie bedarf es deshalb konzeptioneller Abstimmungsprozesse auf allen staatlichen Ebenen. Das Programm ist ein eigenständiges Investitionsprogramm auf der Basis von Art. 104 a Abs. 4 Grundgesetz (GG) mit einem eigenen Haushaltstitel im Bundeshaushalt und ist gleichzeitig, wie auch das Programm »Stadtumbau Ost«, beispielhaft für die Verzahnung von Städtebau- und Wohnungspolitik (Krautzberger/Richter 2001, S. 17).
2.1. Ressourcenbündelung: ein zentrales Ziel des Programms 
Die finanziellen Mittel und die rechtlichen Möglichkeiten des Programms Soziale Stadt reichen zur Bewältigung der komplexen Problematik in den Gebieten nicht aus, auch wenn seit Programmbeginn zusammen mit den Komplementärmitteln von Ländern und Gemeinden bereits rund 770 Mio. Euro in die Programmgebiete geflossen sind. Das Programm ist daher darauf angelegt, durch Bündelung der Mittel aus verschiedenen Ressorts und der Privatwirtschaft das benötigte Geld und zugleich das Know-how dieser anderen Stellen in die Gebiete zu lenken.
Dementsprechend heißt es in dem Leitfaden der ARGEBAU zum Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf die soziale Stadt« in der Fassung vom 1.3.2000 unter 6.1 »Allgemeine Finanzierungsgrundsätze«: »Die Problembewältigung der ›Sozialen Stadt‹ erfordert eine integrierende Zusammenführung von Aufgaben und Förderprogrammen für investive und nicht-investive Maßnahmen. Deshalb sollen vorrangig die bestehenden Programme der beteiligten Fachressorts bzw. Ämter zur Finanzierung herangezogen werden … Der neue Ansatz stellt die Bündelung der für die Stadtteilentwicklung relevanten Finanzen und Maßnahmen (Städtebau- und Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Verkehr, Arbeits- und Ausbildungsförderung, Sicherheit, Frauen, Familien- und Jugendhilfe, Wirtschaft, Umwelt, Stadtteilkultur, Freizeit) als vordringliche Aufgabe auf der Ebene des Landes und der Gemeinde deutlich heraus.« Und unter 6.2 »Förderrechtliche Grundlage« wird ausgeführt: »Mittel Dritter (z.B. Wohnungsunternehmen, Mittel der europäischen Strukturfonds, Arbeitsförderprogramme) sind in die Projektfinanzierung einzubinden.« Der Leitfaden wird durch die zwischen Bund und Ländern getroffenen jährlichen Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung der Programmumsetzung zugrunde gelegt; er ist verbindlich.
Keiner Mittelbündelung bedarf es für nicht investive Maßnahmen, wie beispielsweise für die Finanzierung eines Quartiermanagements. Es ist unmittelbar über das Programm selbst förderfähig, weil sie eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung von investiven Maßnahmen und deren nachhaltige Werterhaltung darstellen.
2.2. Ressourcenbündelung auf Bundes- und EU-Ebene 
Ländern und Gemeinden kommt bei der Ressourcenbündelung besondere Verantwortung zu. Doch sind auch Intensivierung und Verbesserung der fachübergreifenden Zusammenarbeit auf Bundesebene Voraussetzung für den Erfolg des Programms (Leitfaden, 4.4 »Handeln auf Bundesebene«). Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen kommt dieser Verantwortung durch Aktivitäten auf vier Ebenen nach (3):
- Auf der Basis einer Bestandsaufnahme aller für die Stadtteilentwicklung relevanten Fördermöglichkeiten des Bundes hat (4) das Ministerium auf die Ausgestaltung anderer Bundesprogramme Einfluss genommen, bereits laufende Programme für die Gebiete der Sozialen Stadt fruchtbar gemacht und Informationen über diese Programme auf seiner eigenen Internetseite und der des Deutschen Instituts für Urbanistik den Akteuren vor Ort zugänglich gemacht. Dies gilt etwa für das Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend »Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten E&C«, das zwar keine eigenen Projektfördermittel zur Verfügung stellt, aber darauf angelegt ist, dass Mittel des Kinder- und Jugendplans durch die Mittelempfänger zu einem nicht unerheblichen Teil in Gebieten der Sozialen Stadt eingesetzt werden (5). Auch das Programm zur Aussiedlerintegration des Bundesministeriums des Innern konzentriert sich auf Gebiete der Sozialen Stadt (6). Weitere Bündelungseffekte ergeben sich daraus, dass andere, nicht spezifisch auf die Gebiete der Sozialen Stadt bezogene Programme gleichwohl in erheblichem Maße in diesen Gebieten eingesetzt werden. Dabei handelt es sich vor allem um Bundesmittel aus der Städtebauförderung, der sozialen Wohnraumförderung und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die Bundesanstalt für Arbeit hat die Arbeitsämter ausdrücklich auf den besonderen Förderbedarf in den Gebieten der Sozialen Stadt hingewiesen. Von besonderer Bedeutung ist hier das bewusst offen angelegte Programm der »Freien Förderung« nach § 10 Arbeitsförderungsgesetz. In diesem Rahmen kann unter anderem auch die Unterstützung regionaler, das heißt auch gebietsbezogener Aktivitäten zur Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher erfolgen. Inzwischen ist in die Ausführungsbestimmungen zur Freien Förderung ein Hinweis auf das Programm der Sozialen Stadt aufgenommen worden.
- Außerhalb von Förderprogrammen wurde die interministerielle Kooperation verstärkt. So wurde über die Mitarbeit in einer interministeriellen Arbeitsgruppe die Arbeit des neu gegründeten Deutschen Forums für Kriminalprävention auch für die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf fruchtbar gemacht. Außerdem ist das Ministerium am Staatssekretärsausschuss »Jugendpolitik« beteiligt. Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland führte das Ministerium am 6./7. Februar 2002 in Berlin eine Tagung durch mit dem Titel »Soziale Stadt: Entwicklung und Chancen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in benachteiligten Vierteln«, in der es vor allem um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stadterneuerung und Jugendhilfe ging, eine sehr wichtige Aufgabe, da in den Gebieten der Sozialen Stadt der Anteil von Kindern und Jugendlichen deutlich über dem städtischen Durchschnitt liegt. Weiterhin unterstützt es gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Urbanistik die seit Jahren jährlich stattfindenden internationalen Kongresse »Armut und Gesundheit«, um so die Aufgabe der in den Gebieten der Sozialen Stadt besonders wichtigen Gesundheitsförderung zu betonen und stärker bewusst zu machen, dass von deren erfolgreichem Wirken auch ein guter Fortgang der Gebietsentwicklung abhängt (7).
- Auch die Wohlfahrtsverbände und sonstigen freien Träger sozialer Arbeit sind für den Erfolg der Stadtteilentwicklung von zentraler Bedeutung. Um hier Synergieeffekte zu ermöglichen, führt das BMVBW Gespräche mit den Repräsentanten der Verbände und Initiativen auf Bundesebene, teils auf Fach- und Arbeitsebene, teils auf politischer Ebene durch den Minister selbst.
- Schließlich unterstützt das BMVBW den von Deutschem Städtetag, AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V., Schader-Stiftung, vhw Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. Bundesverband für Wohneigentum, Wohnungsbau und Stadtentwicklung und anderen Trägern bundesweit ausgelobten Wettbewerb »Preis Soziale Stadt«.
Allerdings ist auch das Programm Soziale Stadt an die grundgesetzlich vorgegebene Kompetenzverteilung nach dem Ressortprinzip (Art. 65 GG) und die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern (Art. 83 ff. GG) gebunden. Dies erschwert eine Bündelung auf Bundesebene, weil das BMVBW die Forderung anderer Ressorts, die auch eine gebietsbezogene Förderung durchführen, wie etwa das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung, nach Beteiligung an der Gebietsauswahl nicht erfüllen kann. Denn die Gebietsauswahl für das Programm Soziale Stadt obliegt den Ländern. Hier ist noch kein Weg einer förderlichen Kooperation gefunden.
Als problematisch erweisen sich in der Praxis auch die unterschiedlichen Fördermodalitäten (Voraussetzungen, Zeiträume, Subsidiaritäten) der einzelnen Programme. Während beispielsweise die Stadterneuerung ihre Mittel raumbezogen einsetzt, werden Förderungen von Beschäftigung und Qualifizierung (z.B. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM)) oder der Sozial- und Jugendhilfe personenbezogen entschieden. In fast allen Politiksektoren wird jedoch diskutiert und teilweise schon praktiziert, die Förderung auch sozialraumorientiert zu gestalten. Dies gilt etwa für die Bereiche der Jugendhilfe und der Gesundheitsförderung, wenngleich es hier noch erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten gibt.
Auf EU-Ebene stellt sich dieses Kompetenzverteilungs- und Subsidiaritätsproblem so nicht. Das URBAN-II-Programm ist dadurch gekennzeichnet, dass die verfügbaren Mittel für alle notwendigen Aufgaben im Rahmen der Stadtteilentwicklung bereits gebündelt sind und daher die verschiedensten Anträge aus einem Fördertopf bedient werden können. Dafür sind hier allerdings die Hürden für die Aufnahme in das Programm wesentlich höher (z.B. Ex-ante-Evaluation, genaue Festlegung der angestrebten Ziele, Verpflichtung zu fortlaufendem Monitoring und Evaluation); zudem kommen bundesweit nur zwölf Städte in den Genuss dieses Programms.
Darüber hinaus wird das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt durch die Strukturfondsförderung 2000–2006 der EU ergänzt. Ermöglicht wird dies durch die Mittel und Projekte der EU-Strukturpolitik zur »Erneuerung städtischer Problemgebiete«. Förderungen durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) können nicht nur über URBAN II, sondern auch über die EU-Regelförderung für Ziel-1- und Ziel-2-Gebiete erfolgen. Förderungen des Europäischen Sozialfonds (ESF) können mit EFRE-Mitteln kombiniert werden.
2.3 Ressourcenbündelung auf Länderebene 
In vielen Ländern wurden interministerielle Arbeitsgruppen von den jeweiligen Landesregierungen eingesetzt so beispielsweise 1999 in Mecklenburg- Vorpommern, wo Vertreter aus dem Ministerium für Arbeit und Bau, dem Sozialministerium, dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dem Innenministerium, dem Wirtschaftsministerium, dem Umweltministerium, dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V. und dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. sowie dem Deutschen Institut für Urbanistik als Programmbegleitung zusammenkommen. Unter der Federführung des Ministeriums für Arbeit und Bau werden dort Förderanträge beraten, programmbegleitende Arbeitshilfen und Veröffentlichungen erstellt sowie die Bündelung von Finanzmitteln gesichert. Eine Förderfibel für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurde 2001 in Abstimmung mit der hier IMAG genannten Gruppe vom Ministerium für Arbeit und Bau vorgelegt. In Nordrhein-Westfalen übernehmen die Mitglieder der interministeriellen Arbeitsgruppe koordinierende Aufgabe in ihrem jeweiligen Ressort; gleichzeitig sind sie Ansprechpartner für die Kommunen und das federführende Städtebauministerium. Diese Arbeitsgruppe entscheidet unter anderem über Aufnahmeanträge von Kommunen in das Programm Soziale Stadt und harmonisiert laufende Förderprogramme.
Andere Länder, wie z.B. Baden-Württemberg, verzichten auf solche interministeriellen Arbeitsgruppen und begnügen sich mit einem Kabinettsbeschluss, der die Ressorts dazu auffordert, ihre Programme bevorzugt in Gebieten der Sozialen Stadt einzusetzen. In wieder anderen Ländern, wie z.B. Hamburg, hat es sich als sinnvoll erwiesen, über Mittelbündelung nicht in einem größeren Kreis mehrerer Ressorts, sondern in einem zweiseitigen Gespräch mit dem je beteiligten Ressort zu verhandeln.
Einen weitergehenden Ansatz verfolgt das Land Sachsen-Anhalt mit seinem Programm Urban 21, das eine Bündelung aller für die Stadtentwicklung einsetzbarer Landesprogramme vorsieht. In die Förderung aufgenommen werden nur Konzepte, die mehrere der Leitziele verfolgen, die die EU in ihrem Aktionsrahmen »Nachhaltige Stadtentwicklung in der Europäischen Union« aufgeführt hat. Die Landesinitiative URBAN 21 wird begleitet von einem Arbeitskreis, dem unter Vorsitz des Wirtschaftsministeriums Vertreterinnen und Vertreter der hauptsächlich beteiligten Ressorts, der Regierungspräsidien, des Städte- und Gemeindebundes, der wohnungswirtschaftlichen Landesverbände und wissenschaftlicher Begleitinstitute wie des Deutschen Seminars für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) angehören. Dieser Arbeitskreis entscheidet im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fondsverwalter über die grundsätzliche Annahme eines Antrags.
Eine Vereinheitlichung der Förderrichtlinien verschiedener Ressorts oder die Einführung einer dem Prinzip der Einheit der Landesverwaltung eigentlich entsprechenden zentralen Antragstelle für alle an das Land gerichteten Förderanträge sind sonst nirgends verwirklicht. In Niedersachsen jedoch berät die Landestreuhandstelle, die auch einen umfangreichen Katalog der in Gebieten der Sozialen Stadt einsetzbaren Förderprogramme erarbeitet hat, alle Antragsteller und hilft ihnen, die richtige Stelle für ihr Förderanliegen zu finden. In Nordrhein-Westfalen wurden durch die landeseigene Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) und das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) Beratungseinrichtungen für die Beantragung und Bündelung von Fördermitteln geschaffen. Manche Länder, wie z.B. Bayern oder Nordrhein- Westfalen, nutzen auch ihre Bezirksregierungen als Bündelungsbehörde. Doch ist auch hier oftmals der Anspruch einer effektiven Mittelbündelung nicht zu verwirklichen. Die in Ost wie West eingefahrene und seit Jahrzehnten durchaus auch bewährte vertikale Versäulung der jeweiligen Fachverwaltungen vom Bund über das Land und die Bezirksregierungen bis zu den kommunalen Ämtern ist für das Verwaltungshandeln in Deutschland nach wie vor prägend (8).
Gleichwohl mehren sich über die erwähnten Initiativen hinaus die Ansätze vernetzten Vorgehens. Denn inzwischen gibt es zunehmend ressortspezifische Programme, die insbesondere in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf eingesetzt werden. So wurden z.B. in Nordrhein-Westfalen das 1000-Lehrerstellen-Programm des Schulministeriums, das Sonderprogramm zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch das Sozialministerium, das Programm für Jugend mit Zukunft Bewegung, Spiel und Sport in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf (jetzt Werkstatt Sport) aufgelegt. Das hessische Sozialministerium unterstützt das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt durch die Förderung flankierender nicht investiver sozialer Maßnahmen im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt HEGISS (9).
2.4 Ressourcenbündelung auf kommunaler Ebene 
Trotz Bündelungsbemühungen auf übergeordneten Ebenen bleibt die Projektebene der entscheidende Ort für die Bündelung der Ressourcen. Mittel, die nicht bereits weiter oben gebündelt wurden, wie dies etwa bei dem EU-Programm URBAN II der Fall ist, müssen hier zusammengeführt werden. Defizite von Absprachen und Abstimmungen auf Bundes- und Landesebene werden hier schmerzlich erfahrbar. Die Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik bei den Programmgemeinden der Förderjahrgänge 1999 und 2000 hat denn auch ergeben, dass sich die Bündelung in den weitaus meisten Fällen auf die traditionellen Felder der Städtebauförderung, der Wohnungsbauförderung, des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes und der Arbeitsverwaltung beschränkte. Die Erfahrungen der Programmbegleitungen vor Ort aus dem Jahr 2001 lassen auch in Gebieten, in denen die Umsetzung des Programms bereits fortgeschritten ist, zum Teil erhebliche Umsetzungsprobleme bei der Mittelbündelung erkennen. Es bleibt abzuwarten, ob die zweite Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik bei den Programmgemeinden Ende 2002 hier erkennbare Fortschritte signalisieren wird.
In vielen Bundesländern und von einzelnen Regierungsbezirken sind integrierbare Förderprogramme auf Länderebene (in Förderfibeln) zusammengestellt worden. In anderen müssen sie noch erarbeitet werden. Die in den 16 Modellgebieten eingesetzten Programmbegleitungen vor Ort machen immer wieder auf dieses Defizit aufmerksam (10). Neben fehlenden oder unzureichenden oder nicht aktuellen Zusammenstellungen der integrierbaren Förderprogramme werden auch Defizite in der Harmonisierung von Förderprogrammen beklagt. Hilfreich wäre es nach Auffassung der Gemeinden, wenn Förderrichtlinien, -zeiträume und -voraussetzungen so aufeinander abgestimmt wären, dass die Mittel von den Kommunen mit geringem Aufwand sinnvoll gebündelt werden könnten. Dies ist z.B. wegen wechselseitiger Subsidiaritätsforderungen teilweise nur schwer oder gar nicht möglich.
Auch scheint es im Allgemeinen große Unsicherheiten über Fördermittel und Antragswege zu geben. Es fehlen zentrale Stellen zur Fördermittelberatung. In fast allen Modellgebieten des Bund-Länder-Programms wurden auf kommunaler Ebene ämter- bzw. dezernatsübergreifende Lenkungsgremien als Steuerinstrument eingesetzt. Als allgemeine Tendenz wird von einigen Programmbegleitungen vor Ort der zu hohe Aufwand bei der Abstimmung zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen auf kommunaler Ebene, aber auch in den Länderverwaltungen, beschrieben. Konzeptionelle Absprachen zwischen den Ebenen fänden nicht im ausreichenden Maße statt.
Die Gemeinden selbst haben vielfach ämterübergreifende Strukturen geschaffen, um über Anträge aus den Gebieten der Sozialen Stadt zügig entscheiden zu können. Hier finden sich enge Verbindungen mit den Einrichtungen von Quartiermanagement. Auch gibt es Überlegungen, die Stadtverwaltung zur Effizienzsteigerung generell gebietsbezogen zu organisieren, um auf diese Weise räumlich abgestimmtes und präventives Verwaltungshandeln zu erleichtern (Grimm/Micklinghoff/Wermker 2001).
2.5 Bedeutung nicht staatlicher Ressourcen 
Die größten privaten Investoren der Sozialen Stadt sind die Wohnungsunternehmen. Sie modernisieren ihren Bestand an Wohnungen vor allem in den Großsiedlungen oder Plattenbauten, verbessern auf eigenem Grund und Boden das Wohnumfeld, stellen Hausmeister oder Concierges ein – nicht selten Langzeitarbeitslose aus dem Gebiet, die so die Möglichkeit zur Weiterqualifikation erhalten und beschäftigen zum Teil sogar Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um die Wohngebiete zu stabilisieren (Sachs 2001, S. 133 ff.). Ihre Investitionssumme übertrifft die der staatlichen Förderung durch das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt um ein Vielfaches. Die wirtschaftlichen Interessen der Wohnungsunternehmen werden hier zum tragfähigem Motiv für dieses Engagement (11). Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V. erfasst die Investitionsmittel seiner Mitglieder, die in die Programmgebiete fließen, erst seit kurzem statistisch, weshalb sie für diese erste Bilanz nicht zur Verfügung standen. In den Altbauquartieren kommt den hier primär vertretenen privaten Einzeleigentümern eine zentrale Rolle zu. Auch bei ihnen besteht der Konflikt zwischen kurzfristiger Gewinnerwartung und langfristiger Sicherung des Gebäudewerts, zwischen Stabilisierung der vorhandenen Bevölkerungsstruktur und Aufwertung des Gebiets mit Verdrängungsfolgen.
Die Auslobung des Wettbewerbs Soziale Stadt in den Jahren 2000 und 2002 zeigt ein weiteres Engagement unterschiedlicher Beteiligter, die die Ansätze und Ziele des Programms unterstützen. Bei diesem Wettbewerb, der nicht auf die Programmgebiete beschränkt ist, werden innovative Ansätze der Mittelbündelung und Zielintegration ausgezeichnet. Im Jahr 2000 beteiligten sich 101 Projekte an dem Wettbewerb, 15 erhielten Preise oder Anerkennungen. Der Wettbewerb zeigt ebenso wie zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen der Wohnungsunternehmen, der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Einrichtungen, wie z.B. von Stiftungen wie der Schader-Stiftung oder auch der ZEIT-Stiftung, dass die Ziele und Ansätze des Programms Soziale Stadt breite Zustimmung und Unterstützung erfahren. So wurde etwa in dem Netzwerk »Kommunen der Zukunft« der Bertelsmann-Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung und des Verbands für Kommunales Management (KGSt) ein Netzwerkknoten Quartiermanagement geschaffen.
Ein wichtiger Investor in den Gebieten der Sozialen Stadt ist auch die private Wirtschaft. Die Entwicklung der lokalen Ökonomie ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die positive und nachhaltige Entwicklung in den Gebieten. Die Summe der insgesamt privat investierten Mittel kann nicht erfasst werden. Es ist jedoch wie bei der traditionellen Städtebauförderung anzunehmen, dass diese Investitionen in dem Maße zunehmen, in dem sich in den Gebieten eine Stabilisierung oder gar Aufwärtsentwicklung abzeichnen.
Von erheblicher Bedeutung sind auch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die Eigen- und Fremdfördermittel für soziale Zwecke in den Gebieten zum Einsatz bringen. Soziale Maßnahmen, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsförderung, Ausländerintegration und zahlreiche weitere Funktionen werden von ihnen wahrgenommen. Die Höhe der so zum Einsatz kommenden Mittel ist ebenfalls nicht bekannt, dürfte aber erheblich sein.
3. |
Integriertes Handlungskonzept ein strategisches Instrument
|
Der effiziente Einsatz der verfügbaren Mittel setzt konzeptionelles Handeln voraus. Bund und Länder messen daher dem Integrierten Handlungskonzept für die Programmumsetzung Soziale Stadt zentrale Bedeutung bei; sie binden die Förderfähigkeit eines Gebietes an die Erarbeitung eines solchen Konzepts (Art. 2, Abs. 4 der von Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung 1999 bis 2002): »Maßnahmebegleitend ist ein auf Fortschreibung angelegtes gebietsbezogenes integriertes stadtentwicklungspolitisches Handlungskonzept durch die Gemeinden aufzustellen. Das Handlungskonzept (Planungs- und Umsetzungskonzept sowie Kosten- und Finanzierungsübersicht) soll zur Lösung der komplexen Probleme zielorientierte integrierte Lösungsansätze aufzeigen, alle Maßnahmen zur Erreichung der Ziele auch die anderer Bau- und Finanzierungsträger erfassen sowie die geschätzten Ausgaben und deren Finanzierung darstellen.« Integrierte Handlungskonzepte müssen, um wirksam werden zu können, an den Interessen, Aktivitäten und Bedürfnislagen der Quartiersbevölkerung anknüpfen, das heißt gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den lokalen Akteuren erarbeitet und weiterentwickelt werden.
3.1 Bedeutung Integrierter Handlungskonzepte in der Praxis 
Obwohl Integrierte Handlungskonzepte (Becker/Böhme/Meyer 2001) nach Aussage vieler am Programm Beteiligter als strategisches Instrument zur Steuerung der integrierten Stadtteilentwicklung gelten, herrschen in der bisherigen Praxis, was die Aufstellung solcher Konzepte betrifft, noch weitgehend Unsicherheit und Zurückhaltung. Erst für ein gutes Drittel der Modellgebiete wurden Integrierte Handlungskonzepte erarbeitet. Diese Unsicherheit erklärt sich zum Teil daraus, dass zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Programms und der Antragstellung viele Grundinformationen über das Gebiet noch fehlen, Organisations-, Management- und Kommunikationsstrukturen erst aufgebaut werden müssen und in der Regel erheblicher Zeitdruck besteht.
Erschwerend wirkt sich offenbar auch aus, dass die große Erfolgserwartung im Gebiet und seitens der Politik ein eher pragmatisches Vorgehen mit Schwergewicht auf schnell realisierbaren Projekten stützt. Deshalb überrascht es nicht, dass als Folge der unterschiedlichen Geschwindigkeiten für die Projektbewilligung im Rahmen bestehender Förderprogramme und für die Entwicklung wirklich integrierter und im Quartier abgestimmter Handlungskonzepte häufig mit Projekten und Einzelmaßnahmen in Vorleistung getreten wird, obwohl noch gar kein Handlungskonzept vorliegt und deshalb auch kein allgemein verbindlicher Orientierungsrahmen für die Steuerung der Programmumsetzung im Hinblick auf Projektentwicklung und -realisierung; natürlich fehlt es dann auch an Überlegungen zur Bündelung des Mitteleinsatzes.
Dort wo bisher von Integrierten Handlungskonzepten die Rede ist, zeigt sich eine große Variationsbreite der Ansätze: von der kommentierten Projektübersicht über den städtebaulich dominierten Rahmen- und/oder Maßnahmenplan traditioneller Stadterneuerung bis zum umfassenden Kompendium mit vielen Elementen vom Leitbild hin zur Beschreibung von Einzelmaßnahmen.
Für die Programmgebiete der Sozialen Stadt geht es darum, mit Blick auf ihre spezifischen Probleme, Potenziale und Ressourcen eine tragfähige und nachhaltig wirksame Zukunftsperspektive einschließlich der Verfahrensprogrammatik zu ihrer Realisierung zu entwickeln und zu begründen. Dabei müssen die Handlungsfelder präzisiert, Projektideen generiert, Prioritäten für deren Umsetzung aufgestellt, Förderung und Finanzierung akquiriert und koordiniert werden. Voraussetzung für ein solches Vorgehen sind die detaillierte Kenntnis der Lebens- und Wohnverhältnisse im Quartier sowie die Klärung seiner Funktion für die Gesamtstadt. Wenn entsprechende gebietsbezogene Erhebungen und Untersuchungen bereits vorliegen, sind deren Ergebnisse in das übergreifende Handlungskonzept aufzunehmen.
Elemente Integrierter Handlungskonzepte, die grundlegend für einen erfolgreichen Einsatz des Instruments sind, finden sich an vielen Orten: in den Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung, im Leitfaden der ARGEBAU, in Erfahrungen aus den Modellgebieten und Diskussionen auf dem diesem Thema gewidmeten Impulskongress sowie in Anforderungen der Länder an Integrierte Handlungskonzepte, die ihnen als Grundlage für die Vergabe von Programm-Mitteln der Sozialen Stadt und der traditionellen Städtebauförderung sowie für deren Bündelung mit Fördermitteln aus anderen Programmen dienen. Bei diesen Elementen geht es vor allem um folgende:
- Begründung der Auswahl und Abgrenzung des Gebiets, Analyse seiner gesamtstädtischen Bedeutung und Funktion;
- Benennung der zentralen Problemfelder und Entwicklungspotenziale auf Basis einer Strukturanalyse;
- Zusammenführen bereits vorhandener Entwicklungsprogramme und Maßnahmen aller wichtigen Handlungsfelder;
- Formulierung eines Leitbildes für die Stadtteilentwicklung, Vernetzung von Zielen verschiedener Handlungsfelder, Einbindung der Entwicklungsziele für den Stadtteil in das gesamtstädtische Entwicklungskonzept;
- Darstellung von Strategien, Maßnahmen und Projekten mit Angabe von Trägern, Adressaten, Finanzierung, Zeitplan der Umsetzung usw.;
- Angaben zur Organisation und Projektsteuerung sowie zum Management;
- Maßnahmen zur aktiven Beteiligung der Quartiersbevölkerung und der Stadtteilakteure;
- Konzept für eine begleitende Prozessevaluierung und Vorbereitung der Ergebnisevaluierung;
- Kosten- und Finanzierungsübersicht mit geschätzten Gesamtkosten und Finanzierungsplan.
3.2 Verfahren der Aufstellung, Umsetzung und Fortschreibung 
Voraussetzung für eine wirkungsvolle und effiziente Steuerung der Stadtteilentwicklung auf der Basis des Integrierten Handlungskonzepts ist die sorgfältige Abstimmung des Konzepts nicht nur zwischen allen zuständigen Ressorts oder Ämtern und lokal wirksamen Akteuren, sondern vor allem mit der Bewohnerschaft. Dies gilt insbesondere für ressortübergreifende Maßnahmen und Projekte sowie für die Abstimmung privatwirtschaftlicher und gemeinwohlorientierter Interessen. Ganz unterschiedlich wird gegenwärtig in den Kommunen noch eingeschätzt, inwieweit bei der Erarbeitung und Fortschreibung von Integrierten Handlungskonzepten »bottom-up«- und »top-down«-Strategien miteinander verknüpft werden können oder müssen. Es zeichnet sich allerdings ab, dass vor allem für die Antragstellung zur Aufnahme ins Programm und für die Phase der Programmimplementierung stärker »top-down« erarbeitete Vorschläge unerlässlich sind, um den Prozess überhaupt in Gang zu setzen. Anschließend sind dann zügig »bottom-up«-Strategien einzuleiten, die für die Weiterentwicklung und Fortschreibung der Konzepte tragend werden. Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts sind daher gleichzeitig Anstoß und Basis für Kommunikation und Koordination im Stadtteil zwischen Akteuren aller Ebenen: Bevölkerung, Verwaltung, intermediärer Instanz, Wirtschaft usw. Das Integrierte Handlungskonzept soll schließlich durch die Erarbeitung verlässlicher und motivierender Zukunftsperspektiven eine Grundlage für die Beteiligung der Bewohnerschaft am Stadtteilentwicklungsprozess bieten und auch die notwendige Vertrauensbasis für privatwirtschaftliches Engagement schaffen.
Die Entwicklung eines Integrierten Handlungskonzepts sollte mit Aktivierungs-, Beteiligungs- und Abstimmungsprozessen sowie öffentlichen Diskussionsrunden im Quartier intensiv und ernsthaft verknüpft werden. Die Formulierung von Zielen und Leitlinien als Element des Integrierten Handlungskonzepts erweist sich als abstrakte Aufgabe; sie muss deshalb auf Quartiersebene so vermittelt werden, dass ein möglichst großer Teil der Quartiersbevölkerung sich daran beteiligt. Allerdings darf die Debatte über Leitlinien als Handlungs- und Orientierungsrahmen für die Gebietsentwicklung nicht losgelöst werden von jener über konkrete Maßnahmen, Projekte und Einzelschritte zur schnellen Verbesserung der Situation im Gebiet (so genannte Leuchtturmprojekte) und von der Diskussion über das Erreichen der Ziele. Kooperative Erarbeitung und Fortschreibung von Integrierten Handlungskonzepten bieten die Chance, ein gemeinsames Selbstverständnis und Wir-Bewusstsein im Quartier zu entwickeln und sich über vordringliche Maßnahmen, Projekte und Verfahren zu verständigen.
Integrierte Handlungskonzepte brauchen zu ihrer Umsetzung Rückhalt durch die Politik, das heißt die Selbstbindung des Stadtrates an das Konzept und an alle Stationen seiner Fortschreibung. Denn Integrierte Handlungskonzepte gewinnen erst in der Wechselwirkung zwischen Konzeptentwicklung und Umsetzungserfahrung im Sinne der in der Verwaltungsvereinbarung gewählten Formulierung: »maßnahmenbegleitend« – schärfere Kontur. Deshalb ist es unerlässlich, die Handlungskonzepte als flexiblen Orientierungsrahmen anzulegen, sich kontinuierlich im gebietsöffentlichen Diskurs über Erfolg, Misserfolg und Änderungsbedarf zu verständigen und damit die Konzepte quasi als lernende Systeme mit lernenden Akteuren an gewandelte Bedingungen anzupassen. Daraus kann abgeleitet werden, dass der Fortschreibung der Handlungskonzepte kommunalpolitisch besonders hohes Gewicht zukommt.
Allerdings darf der gesamtstädtische Aspekt dabei nicht vernachlässigt werden. Zwar sind Integrierte Handlungskonzepte an den Problemen und Potenzialen einzelner Gebiete ausgerichtet, müssen aber als Bestandteil eines gesamtstädtischen Handlungskonzepts angelegt sein. Der Erfolg bei der Umsetzung des Programms Soziale Stadt hängt daher unter anderem auch davon ab, inwieweit es gelingt, gebietsbezogene Maßnahmen, Projekte, Verfahren und Strategien programmatisch mit der gesamtstädtischen Entwicklungspolitik zu verbinden und die gesamtstädtischen Wirkungszusammenhänge nicht aus dem Blick zu verlieren. Nur so kann ausgeschlossen werden, dass problematische Entwicklungen lediglich sozialräumlich verschoben werden oder dass quartierbezogenen Strategien durch übergeordnete Politiken entgegengewirkt wird. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Wohnungs- und Infrastrukturpolitik.
Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen, dem Land mit der bislang längsten Tradition integrierter Stadtteilentwicklung, machen deutlich, wie wichtig es ist, gleichzeitig Ziele und Leitvorstellungen weiterzuentwickeln und Teilschritte umzusetzen. Dies verweist auf die Notwendigkeit klarer Prioritätensetzungen für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten. So genannte Schlüssel- oder Leitprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie Handlungsfeld übergreifend angelegt sind (also Mehrzielprojekte sind, das heißt, der integrative Gehalt ist bereits im Projekt verankert und eine Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Qualifikationen und Fähigkeiten ist an Entwicklung und Durchführung beteiligt). Zur Um- und Durchsetzung mehrzielorientierter Projekte und Maßnahmen bedarf es in besonderem Maße des Zusammenspiels und der Vernetzung zwischen den Akteuren aus den Bereichen Wirtschafts- und Stadtteilentwicklung, den lokalen Initiativen und der Kooperation zwischen Betrieben und Schulen im Stadtteil.
3.3 Zentrale Handlungsfelder integrierter Stadtteilentwicklung 
In dem breiten Spektrum an Projekten und Maßnahmen der Sozialen Stadt spiegelt sich eine Vielfalt von Handlungsfeldern integrierter Stadtteilentwicklung. Diese sollen unter besonderer Berücksichtigung nicht investiver Maßnahmen in den Integrierten Handlungskonzepten zusammengeführt und vernetzt werden. Die Dokumentation von Projekten und Maßnahmen in der Difu-Datenbank (12) ist nach 16 Handlungsfeldern aufgeschlüsselt, die im Folgenden kurz umrissen werden.
Ein zentrales Ziel des Programms Soziale Stadt ist es, die Fähigkeit der Bewohnerschaft zur Zusammenarbeit, zum Miteinander und zur sozialen Vernetzung zu stärken. In den Handlungsfeldern »Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen« sowie »Befähigung, Artikulation und politische Partizipation« sollen Selbsthilfe, Verantwortungsübernahme, Kooperation und Kommunikation gefördert werden, indem die dazu nötige Infrastruktur mit Treffpunkten, Organisation von Begegnungen und Austausch sowie Beratungs- und Betreuungseinrichtungen entwickelt wird. Schwierigkeiten ergeben sich vor allem durch mangelhafte »Sprachkenntnisse beider Seiten«, also in der Kommunikation.
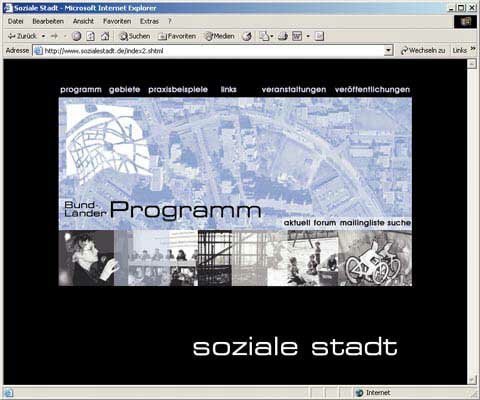 |
Soziale Stadt Portalseite Internet |
Den Handlungsfeldern »Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur« sowie »Schulen und Bildung im Stadtteil«, aber auch »Sport und Freizeit« kommt für die Organisation und Förderung des Zusammenlebens sowie für die Aktivierung vieler Bevölkerungsgruppen besondere Bedeutung zu, insbesondere dann, wenn Maßnahmen und Angebote ebenso wie die jeweiligen Akteure miteinander vernetzt sind. Vor allem, wenn sich die Schulen für den Stadtteil öffnen, übernehmen sie vielfach wichtige soziale Funktionen weit über ihre engeren Aufgaben der schulischen Bildung hinaus. Sie bieten individuelle und Elternförderung an, stellen Verbindungen zur lokalen Wirtschaft her, widmen sich der Sprachförderung und bieten als Offene Schule einen Ort als Bürgertreff und Stadtteilmittelpunkt.
Die drei Handlungsfelder »Beschäftigung«, »Qualifizierung und Ausbildung« sowie »Wertschöpfung im Gebiet« richten sich auf arbeitsmarkt-, beschäftigungs-, struktur- und sozialpolitische Ziele und umfassen damit Strategien zur Stärkung der lokalen Ökonomie. Die Steigerung der Wertschöpfung ist wesentliche Grundlage für die Entwicklung von längerfristig tragfähigen Strukturen in den Stadtteilen: einerseits durch die Herausbildung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, die im Zuge der Integration in die Ökonomie des Stadtteils entsteht, andererseits durch die gestärkte Kaufkraft als wichtigem Unterstützungsfaktor für im Quartier ansässige Betriebe. Für rund 70 Prozent der Programmgebiete wurden Defizite der lokalen Ökonomie in der ersten Difu-Befragung genannt. Dass die Angaben für entsprechende (geplante) Maßnahmen deutlich geringer ausfallen, hat viel zu tun mit der noch kurzen Laufzeit; der Großteil der Gebiete stand zum Zeitpunkt der ersten Befragung noch ganz am Anfang der Programmumsetzung. Die Hälfte der bisher in den Modellgebieten für die Soziale Stadt durchgeführten Themenkonferenzen war denn auch dem Handlungsfeld »Lokale Ökonomie« gewidmet: in Flensburg-Neustadt, in Hamburg-Altona/Lurup und in Kassel-Nordstadt.
Als traditionelle Handlungsfelder der klassischen Städtebauförderung spielen »Lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft«, »Wohnumfeld und öffentlicher Raum«, »Umwelt« und »Verkehr« auch im Rahmen der Sozialen Stadt weiter eine dominante Rolle. Gründe dafür sind einerseits ein weiterhin großer Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf vor allem in den neuen Bundesländern; andererseits wirkt sich hier die stark investiv ausgerichtete Förderung aus, die den Einsatz der Mittel für baulich-städtebauliche Maßnahmen stärker stützt als andere, z.B. sozialintegrative Maßnahmen. Zudem lassen sich mit den klassischen Städtebauförderungsmaßnahmen schneller und unkomplizierter größere Mittelvolumen binden und zum Abfluss bringen. Dies begünstigt den Eindruck eines gut funktionierenden Programms. Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen wie Mietverzicht, spezifische Belegungspolitik, Zusatzangebote gehörten auch schon zu Zeiten der behutsamen Stadterneuerung zum geläufigen Repertoire. Im Rahmen der Sozialen Stadt gewinnen darüber hinaus Ansätze wie »Wohnen Plus«, die Etablierung von Regiebetrieben der Wohnungsunternehmen und beschäftigungsorientierte Wohnumfeldmaßnahmen an Bedeutung. Auch die neuen Ansätze des Wohnraumförderungsgesetzes zur Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, wie z.B. der Kooperationsvertrag zwischen Stadt undWohnungsunternehmen, die Freistellung von Belegungsbindungen, der Erwerb von Belegungsrechten oder die Übertragung von Belegungs- und Mietbindungen, sind hier von Bedeutung.
Beim Handlungsfeld »Gesundheit« besteht noch deutlicher Nachholbedarf. Es wird bisher im Rahmen der Sozialen Stadt noch zu wenig wahrgenommen und thematisiert, wenngleich es mittlerweile verstärkt ins Blickfeld vieler Akteure rückt. Tatsächlich erweisen sich Gesundheitsförderung im Sinne eines weiten Gesundheitsverständnisses, wie es die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Ende der 80er-Jahre propagiert, das körperliches, seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden umfasst, als Schlüsselthemen in den Programmgebieten der Sozialen Stadt. Armut schränkt das zeigen viele Untersuchungen die Chancen zur Erhaltung der Gesundheit stark ein und fördert die Flucht in Risikoverhalten mit unregelmäßigen Tagesabläufen, ungesunder Ernährung und Drogenmissbrauch. Gesundheitsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern wie Konzentrationsmangel, motorische Störungen usw. werden vor allem in den Kindergärten und Schulen offensichtlich. Der Ausbau von Beratungs- und Behandlungsangeboten zur gesundheitlichen Fürsorge und Förderung in den Gebieten der Sozialen Stadt ist ein grundlegendes Element zur Verbesserung und Stabilisierung der Lebensverhältnisse.
Das Fehlen von Zusammenarbeit zwischen »Kultur und Sozialem« wurde schon in den 80er-Jahren beklagt. Bisher spielte das Handlungsfeld »Stadtteilkultur« auch in den Programmgebieten der Sozialen Stadt eine eher untergeordnete Rolle. Kulturarbeit in den benachteiligten Quartieren kann dazu beitragen, die Kommunikation im Stadtteil zu fördern, die Menschen zu aktivieren, zu beteiligen und ihr kreatives Potenzial zu fördern, Stadtteil- und Ortsgeschichte sichtbar zu machen, neue Erlebnis- und Wahrnehmungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Das Handlungsfeld »Image und Öffentlichkeitsarbeit« stellt sich als Querschnittsaufgabe der Sozialen Stadt dar, die alle anderen Handlungsfelder einbeziehen kann. Eine Korrektur des bereits bestehenden Negativimage in vielen Programmgebieten, das einer Identifikation mit dem Stadtteil als gesellschaftlichem Ort im Wege steht, sowie die Förderung der Herausbildung von Positivimages erfordern nicht nur handfeste Verbesserungen in den Quartieren, begleitet von offensiver Öffentlichkeitsarbeit. Die bisher schon praktizierten Maßnahmen zur Stärkung eines positiven Quartierimage sind sehr vielfältig. Allerdings scheint die nach innen gerichtete Öffentlichkeitsarbeit oftmals stärker ausgeprägt zu sein als die außen wirksame Medienarbeit.
Beim Handlungsfeld »Prozess- und Ergebnisevaluation, Monitoring« handelt es sich ebenfalls um eine Querschnittsaufgabe, die als grundlegender Bestandteil der Integrierten Handlungskonzepte angesehen wird. Insbesondere prozessbegleitende Evaluierung bietet die Chance, wenn erforderlich, Umorientierungen im Integrierten Handlungskonzept maßnahmenbegleitend vorzunehmen. Bei der Auswahl der Programmgebiete wurden Lücken im Wissen über die konkrete Situation deutlich, die sich auch auf die Statistik beziehen. Aussagen zum »besonderen Entwicklungsbedarf« von Stadtteilen könnten über verstärktes Monitoring mit neuen Erkenntnissen und Daten erhärtet werden.
4. |
Quartiermanagement Schlüsselinstrument für die Programmumsetzung
|
Für die meisten Länder und Kommunen ist es unstrittig, dass eine effiziente Umsetzung des Programms Soziale Stadt auf flexible, kooperative politische und administrative Strukturen angewiesen ist. Nur auf dieser Basis können die im Quartier als erforderlich angesehenen Maßnahmen, Aktivitäten, Mobilisierungs- und Revitalisierungsprozesse umgesetzt werden. Die große Mehrheit der am Programm Soziale Stadt teilnehmenden Kommunen betrachtet in diesem Zusammenhang Quartiermanagement als das geeignete Instrument, welches angesichts der komplexen Aufgaben und Ziele integrierter Stadtteilentwicklung zum Einsatz kommen soll. Dabei zeigt sich allerdings, dass sich Quartiermanagement nicht auf die Vor-Ort-Arbeit beschränken lässt, sondern die umfassende Organisation von Stadtteilentwicklung auf allen beteiligten Steuerungs- und Handlungsebenen umfasst.
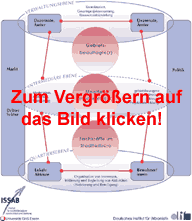 |
Quartiermanagement - Aufgabenbereiche und Organisation |
4.1 Aufgaben und Organisation von Quartiermanagement 
Im Rahmen der Programmumsetzung Soziale Stadt wird deutlich, dass in Deutschland keine Einigkeit darüber herrscht, was das Instrument Quartiermanagement im Einzelnen bedeutet und wie es eingesetzt werden sollte. Dies spiegelt sich sowohl in unterschiedlichen Bezeichnungen – Stadtteil-, Gebiets-, Quartier(s)management, -moderation oder -koordination – als auch in ebenso vielfältigen Organisationsformen wider. Diese reichen je nach Land und Kommune von herkömmlichen »top-down«-Ansätzen mit oftmals nur eingeschränkten Beteiligungsmöglichkeiten für lokale Akteure bis zur starken Verlagerung der Verwaltungsverantwortung auf die mit Quartiermanagement betrauten, allerdings durch zu hohe Erwartungen vielfach überforderten Fachkräfte vor Ort.
Auf Basis der Erfahrungen vieler Städte mit der Umsetzung einzelner Landesprogramme wie auch des Programms Soziale Stadt können einige Eckpunkte für den Entwurf eines Anforderungsprofils für effektives Quartiermanagement entwickelt werden. Diese Erfahrungen werden unter anderem vom Institut für stadtteilbezogene soziale Arbeit und Beratung (ISSAB) in Essen und dem Deutschen Institut für Urbanistik aufbereitet; eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes erfolgt derzeit im Netzknoten Quartiermanagement im Rahmen des »Netzwerks: Kommunen der Zukunft«, für den das ISSAB und das Difu die Beratung übernommen haben (Franke/Grimm 2001): Danach kann Quartiermanagement generell als strategischer Ansatz zum systematischen Aufbau von selbsttragenden sowie nachhaltig wirksamen personellen und materiellen Strukturen zur Entwicklung eines Quartiers bezeichnet werden. Er umfasst folgende Elemente:
- gezielten Einsatz der kommunalen Ressourcen;
- Einbettung des gebietsbezogenen Quartiermanagement-Prozesses in eine gesamtstädtische Entwicklungspolitik;
- Handlungsfelder und verschiedene Ebenen übergreifende Arbeitsweisen;
- Aktivierung und Befähigung (Empowerment) der Quartiersbevölkerung unter intensiver Mitwirkung der lokalen Wirtschaft, ortsansässiger Institutionen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchen, Polizei) sowie lokaler Vereine, Initiativen und Verbände.
Die zum Teil sehr differenzierten Erfahrungen derjenigen Städte, die bereits seit längerer Zeit an Landesprogrammen zur integrierten Stadtteilentwicklung teilnehmen, zeigen, dass Quartiermanagement als komplexer Prozess verstanden werden muss, der verschiedene Steuerungs- und Handlungsstrategien, Vorgehensweisen und Methoden umfasst, durch den das Zusammenwirken unterschiedlicher Funktionsbereiche realisiert wird und der sowohl auf der Verwaltungs- und der Umsetzungsebene des Quartiers als auch im intermediären Bereich angesiedelt ist (vgl. Grafik Quartiermanagement).
Nach diesen Erfahrungen (Franke/Grimm 2001) erweist sich für die Verwaltungsebene neben der Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe die Nominierung einer/s Gebietsbeauftragten mit folgenden Aufgaben als sinnvoll:
- horizontale Vernetzung der involvierten Ämter (gebietsbezogene, ressortübergreifende Zusammenarbeit),
- Steuerung des Einsatzes kommunaler Ressourcen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen/Ämtern (Regiekompetenz),
- Entwicklung von Zielen/Standards/Indikatoren,
- Gesamtprojektsteuerung/Koordination der Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts,
- Einzelprojektmanagement,
- Mittelakquisition, Finanzplanung und Finanzierungsberatung,
- Berichterstattung an politische Gremien,
- Monitoring.
Auf der Quartiersebene hat sich die Einrichtung von Vor-Ort-Büros mit qualifizierter personeller Besetzung sowie einer anforderungsgerechten Ausstattung als unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Programmumsetzung Soziale Stadt erwiesen. Zu den Aufgaben eines solchen Büros gehören:
- horizontale Vernetzung von und Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren,
- themenunspezifische und aufsuchende Arbeit/Aktivierung der Quartiersbevölkerung (unter anderem Kontaktpflege, Gewährleistung von Erreichbarkeit, Kennenlernen von wichtigen Akteuren, Kommunikationsstrukturen, Problemen und Potenzialen im Stadtteil, Anregung und Mobilisierung von Bewohnerinnen und Bewohnern, Beratung, Informationsarbeit, Bündelung von Interessen und Themen, Projektinitiierung).
Für die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure und deren Interessen im intermediären Bereich zwischen Politik, Verwaltung, Markt, Drittem Sektor und »Zivilgesellschaft« ist eine Gebietsmoderatorin oder ein Gebietsmoderator unverzichtbar, die/der unter anderem im Rahmen von Beteiligungsforen folgende Aufgaben wahrnimmt:
- Bündelung und Vermittlung von unterschiedlichen Formen des Bedarfs aus dem Quartier sowie Informationsvermittlung in das Quartier (vertikale Vernetzung zwischen »Verwaltungs«- und »Lebenswelt«),
- kreisförmige Vernetzung zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft und »Zivilgesellschaft« (unter anderem zur Aktivierung der jeweiligen personellen und materiellen Ressourcen),
- Sicherstellung des Informationsflusses sowohl zwischen Verwaltungsund Quartiersebene sowie intermediärem Bereich als auch zwischen den in die integrierte Stadtteilentwicklung involvierten Akteuren,
- Herstellung von Verfahrenstransparenz,
- Entwicklung und Stabilisierung von lokalspezifischen Kooperationsund Kommunikationsstrukturen,
- Moderation, Mediation, Dialogmanagement,
- Projektinitiierung,
- Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen.
Neben der jeweiligen Organisation der drei genannten Bereiche erscheint es ebenso wichtig, auch die Zusammenarbeit zwischen diesen Ebenen sowohl vertraglich als auch über formelle und informelle Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zu regeln (»Schnittstellenmanagment«). Dies wird vor allem bei der Überschneidung von Aufgaben bedeutsam, wenn beispielsweise sowohl das Gebietsmanagement für den intermediären Bereich als auch die vor Ort tätigen Fachleute in die Organisation des Stadtteilbüros involviert sind oder wenn bei Organisation und Moderation von Veranstaltungen neben dem zuständigen Management im intermediären Bereich auch die Verwaltung beteiligt ist. Jenseits aller Strukturen spielt für die effektive Umsetzung eines integrierten Handlungskonzepts allerdings das Kooperationsklima zwischen den beteiligten Akteuren eine entscheidende Rolle. Auf und zwischen allen drei Ebenen kommt es entscheidend auf die hier handelnden Personen und ihre Kooperationsbereitschaft an, wie Erfahrungen aus fast allen Kommunen zeigen.
4.2 Praxiserfahrungen mit Quartiermanagement 
Die Ergebnisse der Difu-Umfrage 1999/2000 zeigen, dass knapp die Hälfte der Kommunen bereits zum Zeitpunkt des Programmstarts Elemente von Quartiermanagement eingerichtet hatte. Gut 40 Prozent planten diesen Schritt mit Beginn der Programmumsetzung, während lediglich ein Zehntel zu diesem frühen Zeitpunkt weder ein Quartiermanagement geschaffen hatte noch dies in Erwägung zog.
Im jeweiligen Einzelfall hängt die detaillierte Organisation des Quartiermanagements von der Größe des Zielgebietes, den dort identifizierbaren spezifischen Problemen sowie der Kompetenz und Qualifikation der bereits vor Ort tätigen professionellen Akteure ab. So verdeutlicht die Auswertung der im Frühjahr 2001 erstellten PvO-Zwischenberichte denn auch, dass sich in den 16 Modellgebieten die Einrichtung von Quartiermanagement sowohl von Kommune zu Kommune teilweise erheblich unterscheidet als auch in der Organisation der drei Ebenen Verwaltung, intermediärer Bereich und Quartier unterschiedlich stark ausgeprägt ist:
Auf Dezernatsebene hatten im Jahr 2001 gut zwei Drittel der Modellgebiete einen übergeordneten Steuerungs- oder Lenkungskreis eingerichtet. Auf der darunter liegenden Ämterebene wurde zur gleichen Zeit nur noch bei der Hälfte der Modellgebiete eine ämter- oder ressortübergreifende Arbeitsgruppe installiert. In einigen Kommunen orientierte sich die dezernats- und ämterübergreifende Zusammenarbeit zudem noch sehr stark an der »traditionellen« Städtebauförderung, war damit nur wenig ganzheitlich ausgerichtet und berücksichtigte kaum nichtinvestive Handlungsfelder.
Knapp zwei Drittel der Modellgebiete hatten den intermediären Bereich in Quartiermanagement-Konzepte einbezogen allerdings auch hier in unterschiedlicher Form und Intensität. Nur wenige Kommunen veranstalteten in ihren Modellgebieten Stadtteilkonferenzen oder Ähnliches zu grundsätzlichen Abstimmungsfragen. Häufigere Treffen im Rahmen von »Runden Tischen« oder »Stadtteilforen« mit konkreter Projektarbeit in (Themen-)Arbeitsgruppen bot knapp die Hälfte der Modellgebiete an. In einzelnen Gebieten wurden Abstimmungsfragen im intermediären Bereich dagegen ohne öffentliche Beteiligungsmöglichkeiten bearbeitet. Auf der Umsetzungsebene sind in zwölf der 16 Gebiete Vor-Ort-Büros eingerichtet worden oder standen im Sommer 2001 kurz vor der Eröffnung, wobei sich (geplante) Stellenausstattung, Erreichbarkeit und (vorgesehene) Arbeitsschwerpunkte teilweise erheblich voneinander unterscheiden.
Insgesamt zeichnet sich damit zumindest in den Modellgebieten als Trend ab, dass vor allem die übergeordnete Steuerungsebene in der Verwaltung sowie Vor-Ort-Büros im Quartier die ausgeprägtesten Organisationsformen im Rahmen von Quartiermanagement darstellen. Eine vergleichbar starke Organisation der ressortübergreifenden Verwaltungsarbeit auf Ämterebene sowie des intermediären Bereichs war im Jahr 2001 dagegen erst bei rund der Hälfte der Modellgebiete entstanden. Die Verbindung zwischen Quartier, intermediärem Bereich und Verwaltungsebene wurde in den meisten Fällen durch die Teilnahme von Vor-Ort-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern an Sitzungen von Verwaltungsgremien hergestellt und damit nicht gesondert geregelt.
Der Erfolg von Quartiermanagement dies ist eine wesentliche Erkenntnis aus der bisherigen Programmumsetzung hängt nicht nur von der Organisation der drei Ebenen Verwaltung, Quartier und intermediärer Bereich, sondern in starkem Maße auch davon ab, dass politische Beschlüsse über integrierte Handlungskonzepte und eben jene neuen Kooperationsformen vorliegen. So erhält der gesamte Quartiersentwicklungsprozess die erforderliche »Rückendeckung« durch die Kommunalpolitik. Die Einbindung der Politik auf allen Entscheidungsebenen auch im laufenden Prozess ist eine weitere wichtige Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit von Quartiermanagement. Wenn (Lokal-)Politikerinnen und -Politiker die Einrichtung einer solchen Organisation als Machtverlust empfinden, können Konkurrenz und Blockadehaltungen an die Stelle von Partnerschaft und Unterstützung treten. Dieses »Konfliktpotenzial« kann im Vorfeld durch verbindliche Regelungen zur Beteiligung von Politik und zu Entscheidungskompetenzen von Beteiligungsgremien entschärft werden. Nur durch politische Integration entstehen echte Mitbestimmungsstrukturen im »Schatten der Hierarchie« von Rat und/oder Bezirksvertretung. Die Verantwortung für das Quartiermanagement selbst sollte an höchster Stelle innerhalb der Verwaltung angesiedelt werden, um auch von hier größtmögliche Unterstützung zu erhalten.
Von zentraler Bedeutung für ein effektives Quartiermanagement sind darüber hinaus die Überwindung von Ressortgrenzen und der Aufbau kooperativer Strukturen auf der Verwaltungsebene. Hier sollte die Vernetzungsund Bündelungsfunktion der oder dem Gebietsbeauftragten übertragen werden, während für das Management von Einzelprojekten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen beteiligten Ressorts verantwortlich sein müssen, um die oder den Gebietsbeauftragte(n) nicht mit dem operativen Geschäft im Rahmen der Programmumsetzung Soziale Stadt zu überlasten.
Im intermediären Bereich erscheint es notwendig, das Verhältnis zwischen Gebietsmoderatorin oder -moderator und Verwaltung formal und inhaltlich zu klären, um beispielsweise im Konfliktfall zwischen beiden Bereichen keine Loyalitätsprobleme der jeweils im Rahmen von Quartiermanagement verantwortlichen Akteure hervorzurufen. Eine solche Regelung kann durch vertragliche Vereinbarung erzielt werden. Gleiches gilt für die Regelung des Verhältnisses von intermediärem Bereich und Quartiersebene – auch hier erscheint es sinnvoll, Aufgaben und Formen der Zusammenarbeit über Verträge und Qualitätsvereinbarungen festzuschreiben. Intermediäre und lokale Arbeitsgremien benötigen außerdem Entscheidungsbefugnisse und materielle Ressourcen, um Beschlüsse zeitnah umsetzen zu können. Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang Verfügungsfonds, für die ebenfalls Regeln zur Entscheidung über die Mittelvergabe aufgestellt werden müssen.
Für die konkrete Arbeit im Quartier hat sich die Einrichtung eines Vor-Ort- Büros (z.B. eines Stadtteilbüros) als unverzichtbare Voraussetzung erwiesen. Beteiligung und Aktivierung der Quartiersbevölkerung basieren auf der kontinuierlichen Präsenz von Fachleuten im Gebiet sowie auf der Erreichbarkeit offener Anlaufstellen mit niedrigschwelligen Angeboten. Wenn möglich, sollten Personen oder Gruppen, die bereits vor Ort eine aktive Rolle im Quartier übernommen haben, die Aufgabe des lokalen Quartiermanagements übernehmen.
Alle mit Quartiermanagement betrauten Akteure auf der Verwaltungs- und der Quartiersebene sowie im intermediären Bereich benötigen spezifische Qualifikationen an erster Stelle müssen sie über ausgesprochen gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten verfügen. Angesichts der vielfältigen und komplexen Anforderungen an Quartiermanagement bieten einige (Fach-)Hochschulen seit Ende der 1990er-Jahre Studiengänge zur Vermittlung einer entsprechend breiten Qualifikation an.
Diese Qualifikationen, persönliches Engagement und die Bereitschaft von Quartiermanagerinnen und -managern, sich mit ihren komplexen Aufgaben zu identifizieren, fallen dagegen kaum auf fruchtbaren Boden, wenn in den Kommunen nicht zumindest mittelfristig die zur Absicherung der Quartiermanagementtätigkeiten notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen garantiert sind.
4.3 Quartiermanagement als Prozess 
Die bisherigen Erfahrungen mit der Programmumsetzung Soziale Stadt zeigen deutlich, dass erfolgreiches Quartiermanagement gleichzeitig auf politischen Beschlüssen, tragfähigen Strukturen inklusive klaren Aufgabendefinitionen und Qualitätsvereinbarungen sowie persönlichem Engagement in allen gesellschaftlichen Bereichen, in allen Handlungsfeldern und auf allen Aktionsebenen basiert. Damit dies ist in allen Programmgebieten Soziale Stadt deutlich geworden ist Quartiermanagement kein Instrument zur kurzfristigen Lösung sektoraler Teilaufgaben der Stadt(teil)entwicklung, sondern eine grundlegend neue, prozesshafte Herangehens- und Handlungsweise zur dauerhaften Entwicklung und Stabilisierung von Quartieren.
Aufgrund dieser Prozesshaftigkeit sowie der Tatsache, dass es sich bei Quartiermanagement im Rahmen der Programmumsetzung Soziale Stadt um ein neues Instrument handelt, sind bisher noch einige zentrale Aspekte zu dessen Ausgestaltung und Umsetzung vergleichsweise ungeklärt. Viele Fragen wirft beispielsweise noch das Gegenüber von »Verwaltungswelt« und »Lebenswelt« auf, das sich unter anderem im Problem der »zwei Geschwindigkeiten« äußert: dem durch die Antragstellung auf Fördermittel entstandenen zeitlichen Vorlauf der Verwaltung, ihrer zeitlichen Gebundenheit durch Vorgaben des Haushaltsrechts zur Jährlichkeit des Mitteleinsatzes und ihrem Zwang zur Einhaltung von Programmlaufzeiten und Bewilligungszeiträumen stehen die Prozesshaftigkeit, Eigendynamik, Komplexität und die damit meist deutlich anderen Geschwindigkeiten auf der Quartiersebene gegenüber.
 |
| Impulskongress Quartiermanagement (Oktober 2000), Plenum in Werk II, Leipzig-Connewitz (Bildquelle: Monika Vielitz, Berlin) |
Neue Kommunikationsprozesse entstehen nicht nur zwischen den verschiedenen Steuerungs- und Handlungsebenen, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Akteuren, die im Rahmen von Quartiermanagement zusammenarbeiten (müssen). Besonders augenfällig wird dies bei der Kooperation von im weitesten Sinne Planungs- und Sozialberufen: In den Bereichen Stadtplanung, Bau- und Wohnungswesen sowie Stadterneuerung liegt bei weit mehr als der Hälfte aller Kommunen die Federführung für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt und damit für die Einrichtung von Quartiermanagement. Gleichzeitig fordern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sozialen Aufgabenbereichen (z.B. von Jugendämtern, Sozialämtern oder Trägern der Wohlfahrtspflege) oftmals eine stärkere Rolle in der Programmumsetzung, da Aktivierung, Beteiligung und Quartiermanagement originäre Aufgaben ihrer Disziplinen seien. Eine Lösung dieses Problems kann in der Teilung der Federführung bei der Programmumsetzung zwischen Amtsbereichen mit eher städtebaulichen und solchen mit sozialen Aufgaben liegen, was allerdings bisher in nur wenigen Kommunen realisiert wird. In den meisten Fällen erscheint die Zusammenarbeit zwischen sozialen und städtebaulichen Akteuren eher noch als unzureichend und daher verbesserungswürdig. Die in Hessen praktizierte »Tandemlösung«, das heißt die Besetzung von Vor-Ort- Büros mit je einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter aus den Bereichen Planung und Sozialarbeit, kann auf der Umsetzungsebene als ein Schritt in die »richtige« Richtung betrachtet werden.
5. Aktivierung und Beteiligung 
Wesentliche Innovationen, die im Bereich Partizipation von dem Programm Soziale Stadt ausgehen sollen, sind die Schaffung ganzheitlicher quartiersbezogener Beteiligungsstrukturen, die quartiersbezogene Vernetzung lokaler Initiativen und Organisationen, die Erschließung der spezifischen Problemlösungskompetenzen auch bisher nicht organisierter Bürgerinnen und Bürger (Empowerment, Aktivierung) sowie die Einbeziehung der lokalen Wirtschaft und anderer wichtiger, lokal wirksamer Akteure in die Stadtteilentwicklungsarbeit (Franke 2002).
5.1 Organisation der Interessen vor Ort 
Bei der Umsetzung des Programms Soziale Stadt zeigt sich, dass ein von Kommune zu Kommune teilweise sehr unterschiedliches Verständnis von Aktivierung und Beteiligung vorherrscht. Oftmals ist unklar, mit welchen Techniken und mit welchen Zielen wer durch wen zu aktivieren oder zu beteiligen ist. Zudem wird vielfach darauf hingewiesen, man könne Aktivierung und Beteiligung nicht trennen, da Aktivierung immer beteiligend wirke und alle Beteiligungsformen zugleich aktivierenden Charakter hätten. Betrachtet man die Arbeit vor Ort, so lässt sich feststellen, dass viele Kommunen zwar herkömmliche, »top-down« initiierte Beteiligungsmöglichkeiten anbieten und sich davon Aktivierungseffekte erhoffen, dann aber feststellen müssen, dass die angebotenen Beteiligungsgremien nur in geringem Maße oder gar nicht von der »normalen« Quartiersbevölkerung genutzt werden. Deshalb ist es wichtig, den Aktivierungsaspekt gesondert zu betrachten.
»Stadtteilbezogene Arbeit in der Tradition von GWA [Gemeinwesenarbeit] bezeichnet einen projekt- und themenunspezifischen Prozess einer (in der Regel) mehrjährigen Aktivierung der Wohnbevölkerung, der ... vornehmlich über eine Vielzahl kleinerer Aktivierungsaktionen« darauf abzielt, die Interessen der Wohnbevölkerung zu organisieren und damit eine »Grundmobilisierung« herbeizuführen, die »Humus für größere Einzelprojekte darstellt« (Hinte 2001). Strategien der Stadtteilentwicklung ohne eine solche Mobilisierung wären ohne Fundament. Es geht »um Kommunikation, Ideenproduktion sowie Organisation von Menschen und Ressourcen«, um »an vorhandene Interessen, Aktivitäten und Bedürfnislagen anzuknüpfen und diese für das Zusammenleben im Gemeinwesen nutzbar zu machen« (Hinte 2001).
Vor diesem Hintergrund lassen sich unter Aktivierung alle Techniken verstehen, mit denen einzelne Personen oder Personengruppen im Quartier angesprochen und in Kommunikation (miteinander) gebracht werden können. Zu den Zielen von Aktivierung gehört es, Kontakt zu Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern aufzunehmen und zu pflegen, die in ihrer Lebenswelt erfahrbaren Probleme zu identifizieren und die Mitwirkungsbereitschaft bei der Stadtteilentwicklung nach dem Motto »Was wollt ihr?« zu wecken. Es handelt sich also in erster Linie um projektunspezifische, informelle und zu einem großen Teil an die Menschen direkt adressierte Vorgehensweisen: aktivierende Befragungen, Beratungsangebote, aufsuchende Arbeit, Streetwork, Vernetzung von und Vermittlung zwischen einzelnen Akteuren, Institutionen und Organisationen, Schlichtung von Interessenkonflikten (Mediation), Organisation von Versammlungen, (Stadtteil-)Festen, Veranstaltungen und Aktionen, Gebiets- und Gebäudebegehungen, Informationsangebote und -veranstaltungen. Auch quartiersbezogene Öffentlichkeitsarbeit über (mehrsprachige) Stadtteilzeitungen, Plakate, Flyer, Broschüren, Rundbriefe, Internetangebote sowie den Einsatz von Logos und Slogans ist Teil der Aktivierungsarbeit (Mohrlock u.a. 1993, S. 223 f.).
Beteiligung setzt meist auf einer eher formalen Ebene an und basiert auf mehr oder weniger geplanten Verfahren (konkretes Programm, bestimmter Ort, moderierter Ablauf) sowie konkreten Zielvorstellungen (z.B. Diskussion zu bestimmten Themen, Entwicklung von Projekten, Vertretung von Gruppeninteressen). Zu solchen Beteiligungsformen gehören Stadtteilkonferenzen, Stadtteil- oder Bürgerforen, Zukunftswerkstätten, Bürgergutachten, thematische Arbeitskreise oder -gruppen, Workshops und beteiligungsorientierte Projekte.
Über die eingesetzten Aktivierungstechniken und Beteiligungsangebote hinaus erweist es sich für die Arbeit vor Ort als unerlässlich, den Kontakt zur Quartiersbevölkerung auch über bereits bestehende Initiativen und Organisationen wie Interessengemeinschaften beispielsweise von lokalen Einzelhändlern –, Mieterforen/-initiativen/-runden/-beiräte, Bürgervereine, Elternbeiräte, Pfarrgemeinden oder Stadtteilbeiräte aufzunehmen und sie in die Vernetzungsarbeit einzubeziehen.
Die erwähnten Beteiligungsformen sind seit den 1970er- und 1980er-Jahren bekannt. Neu im Rahmen des Programms Soziale Stadt ist nun die Forderung sowohl einer gebietsbezogenen Vernetzung dieser Ansätze als auch der Ausrichtung von Organisations- und internen Managementstrukturen der Verwaltung auf diese Formen der Ressourcenaktivierung und -nutzung.
Mangelnde Entscheidungsbefugnisse auf der lokalen Ebene und damit das Fehlen von Möglichkeiten schnellen Handelns waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Hinderungsgrund für erfolgreiche Aktivierung und Beteiligung. Es ist daher deutlich geworden, dass zur Aktivierung der Bevölkerung und zur Initiierung eines Selbstorganisationsprozesses die Einrichtung von Verfügungsfonds oder Stadtteilbudgets notwendig ist, aus denen kleinere Projekte und Maßnahmen schnell und unbürokratisch realisiert werden können. Dabei spielt weniger die Summe der verfügbaren Mittel eine Rolle als vielmehr die Möglichkeit, diese Gelder unkompliziert und auf Basis demokratisch legitimierter Entscheidungsstrukturen vor Ort direkt einzusetzen.
5.2 Erfahrungen mit Beteiligung und Aktivierung 
Erfolgreiche Aktivierung und Beteiligung lassen sich vor allem in denjenigen Kommunen beobachten, die für die Programmumsetzung Soziale Stadt ein leistungsfähiges Quartiermanagement eingerichtet haben. Probleme ergeben sich dagegen vor allem dann, wenn die Arbeit mit der Quartiersbevölkerung in starkem Maße auf herkömmliche Beteiligungsverfahren im intermediären Bereich beschränkt bleibt und damit die Aktivierungsarbeit vor Ort zu geringe Bedeutung erhält. Als Folge davon werden Beteiligungsgremien in einigen Kommunen überwiegend von »Profis« besucht, während benachteiligte Bevölkerungsgruppen, um die es im Programm Soziale Stadt ja vorrangig gehen soll, kaum oder gar nicht erreicht werden.
In den 16 Modellgebieten stehen im Bereich Aktivierung vor allem (Stadtteil-)Feste, Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen sowie allgemeine Informationsarbeit im Vordergrund, während aktivierende Befragungen, aufsuchende Arbeit, Beratungsangebote und andere kommunikationsintensive Techniken seltener eingesetzt werden. Hier gibt es noch Nachholbedarf, um das Programmziel »Aktivierung« tatsächlich zu erreichen, was auch einige PvO-Teams bestätigen: Im Jahr 2001 lag der Ansatz personenbezogener Aktivierungstechniken in fünf Modellgebieten noch weitgehend brach, und für ebenfalls fünf Modellgebiete wurde dringend angemahnt, die themenunspezifische aktivierende Arbeit zu erweitern.
Bei den Beteiligungsformen in den Modellgebieten dominierten Stadtteilkonferenzen oder Stadtteilforen, meistens in Verbindung mit selbständig arbeitenden Themen-Arbeitsgruppen. Gleichzeitig waren in fünf Gebieten noch keine Beteiligungsgremien eingerichtet worden, oder Beteiligung fand nur sehr punktuell statt.
Verschiedene Beteiligungs- und Aktivierungsmethoden können erfolgreich sein, wie die vielfältige Projektlandschaft der Programmgebiete zeigt. Entscheidend ist jedoch, dass die entsprechenden Maßnahmen auf das jeweilige Gebiet und deren meist heterogene Bewohnerschaft zugeschnitten sind. Eine einfache Übertragung von Erfahrungen aus anderen Gebieten funktioniert meist nicht. Bei der Aktivierung der Quartiersbewohnerinnen und -bewohner kommt es darauf an, offen gegenüber Prozessen und Ideen zu sein und einen gut bestückten »Methodenkoffer« unter Berücksichtigung der örtlichen Ausgangssituation effektiv zu nutzen. Dabei sind Unterstützung von Ideen aus den Reihen der Bewohnerschaft und deren Mitwirkung bei der Maßnahmen- und Projektumsetzung zentrale Aspekte der Aktivierung. Die Ideen der Bewohnerschaft kollidieren jedoch oft mit konkreten Projekt-, Zeit- und Output-Vorstellungen der Verwaltung. Mangelnde Entscheidungsbefugnisse und das Fehlen eines Verfügungsfonds erschweren zudem die Arbeit. Eine wesentliche Erfahrung besteht darin, dass hinsichtlich der Realisierung von Bewohnerwünschen keine Illusionen erzeugt werden dürfen und dass Verfahren transparent gestaltet sein müssen. Dazu gehört unter anderem die Klärung der Fragen, welche Rechtsqualität oder Beschlusskraft die in Beteiligungsgremien getroffenen Entscheidungen haben, wer der Adressat von Empfehlungen oder Beschlüssen ist und wie das weitere Prozedere außerhalb der Beteiligungsgremien geregelt ist. Unabdingbare Voraussetzungen für Beteiligung und Aktivierung der Quartiersbevölkerung sind eine kontinuierliche Präsenz von Fachleuten vor Ort sowie das Angebot offener Anlaufstellen mit niedrigschwelligen Angeboten.
Schließlich sind nach bisherigen Erfahrungen aus der Programmumsetzung Soziale Stadt Aktivierung und Beteiligung ebenso wie Quartiermanagement auf den Rückhalt durch Politik und Verwaltung angewiesen, wenn sie als Instrumente und Methoden einer demokratischen Mitbestimmung tatsächlich ernst genommen werden sollen.
6. |
Soziale Stadt Zwischenbilanz und Ausblick
|
Von Beginn an gab es zum Programm Soziale Stadt gleichermaßen zustimmende wie kritische Meinungen. Die positive Resonanz bezog sich vor allem darauf, dass Bund und Länder auf die drängenden Probleme in den Städten mit einem neuen, auf Kooperation ausgerichteten Politikund Förderansatz reagierten. Skepsis und Zurückhaltung wurden dem Programm entgegengebracht, weil es manchen so schien, als sollten die gesamtgesellschaftlichen Probleme etwa Arbeitslosigkeit, Mängel des Gesundheits- und Bildungswesens auf Stadtteilebene gelöst und ein Abbau sozialstaatlicher Leistungen damit kaschiert werden. Es wird moniert, dass die eigentlichen Ursachen der Probleme keineswegs Gegenstand der Bemühungen in den Stadtteilen seien. In der Logik der Vorwürfe steht ein weiterer: dass auch die staatlicherseits propagierte »neue Verantwortungsteilung« zwischen Staat und Gesellschaft allein den Menschen vor Ort die Bewältigung der gesamtgesellschaftlich verursachten Probleme aufbürde.
Bei allen Einwänden, die darüber hinaus auch das Fördervolumen und die Restriktionen durch die Anbindung an die Städtebauförderung betreffen, besteht inzwischen aber weitgehend Einigkeit darüber, dass mit dem Programm ein richtiger Kurs gesteuert wird, wichtige Impulse für die Stabilisierung der Lebensverhältnisse in den benachteiligten Stadtteilen gesetzt wurden und erste Schritte für den Aufbau einer längerfristig tragfähigen Infrastruktur unternommen worden sind. Einvernehmen besteht auch darüber, dass eine Gesellschaft, die Solidarität und sozialen Ausgleich als Anspruch formuliert, alles daran setzen muss, integrative und aktivierende Ansätze mitzutragen und vor Ort zu stützen: Solidarität in der Stadt setzt voraus, dass alle Bürgerinnen und Bürger in allen Stadtteilen an der Entwicklung ihrer Lebenswelt teilhaben und entscheidend mitwirken. Nur so kann sich bei allen Menschen das Gefühl von Zusammenhalt und Sicherheit einstellen, können sich zuversichtliche Einschätzungen herausbilden.
6.1 Chancen und Probleme der Programmumsetzung 
Trotz der noch kurzen Laufzeit des Programms lassen die Erfahrungen mit den ersten drei Jahren Programmumsetzung in weiten Teilen eine positive Bilanzierung zu. Vieles ist vor Ort, in kommunaler und staatlicher Verwaltung sowie in der Politik in Bewegung geraten:
- Als besonders positiv wird nicht nur in den Modellgebieten die »Aufbruchstimmung« vermerkt, die mit der neuen Aufmerksamkeit für Probleme und Leistungskraft der Gebiete verbunden ist, auch wenn sich konkrete Verbesserungen in den Quartieren aufgrund der kurzen Zeit allerdings noch in Grenzen halten. In vielen Stadtteilen konnte eine unheilvolle Entwicklung zumindest gestoppt werden.
- Besonderen Beifall bei Städten und Gemeinden findet der in vielen Ländern organisierte Erfahrungsaustausch (beispielsweise in Hessen mit der »Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt HEGISS«) und in Nordrhein-Westfalen mit dem »Forum für ›Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf‹ «) zwischen den am Programm teilhabenden Städten und Gemeinden. Der Transfer von Erfahrungswissen erweist sich für die Umstellung auf neues Handeln als wichtige Grundlage.
- Trotz teilweise nach wie vor vorhandener Ressort- und Ämteregoismen auf Verwaltungsebene ist in vielen Kommunen und Ländern ressort- und ämterübergreifende Kooperation in Gang gekommen für viele eine neue Erfahrung, die manche begeistert und anspornt und von der längerfristig ein Mentalitätswandel ausgehen kann.
Die größten Restriktionen für das Programm Soziale Stadt werden darin gesehen, dass die Orientierung an der Städtebauförderung den Spielraum für nicht investive Maßnahmen und Projekte einengt und die Bewältigung der Probleme vor Ort erschwert. Das zentrale Ziel des Programms, mit dem diese Grenzen überwunden oder relativiert werden sollen, um die Kooperation zwischen den Beteiligten zu stärken und dadurch die Ressourcen für die Stadtteilentwicklung zu bündeln, ist noch lange nicht erreicht. Nicht in allen Bundesländern fühlen sich die Kommunen in ihren Bemühungen darum ausreichend unterstützt. Dies betrifft in erster Linie Schwierigkeiten bei der Mittelbündelung eine Aufgabe, die weiterhin vor allem auf den kommunalen und Vor-Ort-Akteuren lastet. Hier erweisen sich die zahlreichen Fördertöpfe mit einer Vielzahl von Ansprechpartnern und insgesamt nicht aufeinander abgestimmten Förderkonditionen (Laufzeit, Gebiets- oder Zielgruppenbezug, Modalitäten der Antragstellung) nach wie vor als nur schwer überwindbare Hürden. Die Länder sind bisher unterschiedlich erfolgreich, wenn es darum geht, die Harmonisierung ihrer Programme zu betreiben und ihren Gemeinden Arbeitshilfen an die Hand zu geben.
Auf der kommunalen Ebene sind Probleme und Restriktionen vor allem in zwei Bereichen zu konstatieren:
- Die prekäre Finanzsituation der Städte schafft oftmals für die Antragstellung Barrieren. Zunehmend zeigen sich Probleme, den kommunalen Anteil der Soziale-Stadt-Mittel aufzubringen. Hier sind viele Kommunen, besonders stark in den neuen Ländern, darauf angewiesen, von ihrem Land stärker kofinanziert zu werden.
- Trotz Aufbruch in Sachen Kooperation und Vernetzung erweist sich manche kommunale Verwaltung noch als nicht ausreichend flexibel. Teilweise werden Öffnungsansätze auch durch Vorgaben der Länder gebremst vor allem aus Gründen noch wenig eingeübter Kooperation des Verwaltungshandelns, des Beharrens auf Machtpositionen und formalen Zuständigkeitsgrenzen.
Hinsichtlich mehrerer Komplexe besteht Umsteuerungsbedarf für die Programmumsetzung auf kommunaler Ebene:
- Die Aktivierung vor allem benachteiligter Bevölkerungsgruppen muss noch deutlich verstärkt werden, denn in vielen Stadtteilen werden manche Personengruppen (z.B. Familien mit Migrationshintergrund, Langzeitarbeitslose, Jugendliche, alte Menschen) kaum oder gar nicht erreicht. Viele Aktivitäten bleiben mittelschichtorientierte Veranstaltungen.
- Der interkulturelle Ansatz muss bei der Umsetzung des Programms noch stärker greifen. Dies verweist auf die große Bedeutung der Förderung von Spracherwerb und der Organisation kulturell übergreifender Aktivitäten.
- Auch die Einbindung so wichtiger Akteure wie der Wohnungsunternehmen lässt teilweise noch zu wünschen übrig. In manchen Stadtteilen engagiert sich die Wohnungswirtschaft für die Soziale Stadt mit vielfältigen Maßnahmen (z.B. Angebote Wohnen Plus, Mieterbeteiligung, Beschäftigungsinitiativen), in vielen anderen verhält sie sich reserviert.
- Das Problem der »zwei Geschwindigkeiten« durch Handlungszwänge der »Verwaltungswelt« auf der einen Seite sowie der spontan artikulierten Bedürfnisse der »Lebenswelt« in den Stadtteilen auf der anderen Seite (bei Antragsverfahren, Bewilligungszeiträumen, Erarbeitung und Umsetzung von Integrierten Handlungskonzepten usw.) erfordert größeren Handlungsspielraum, wie er z.B. durch Zugriffsmöglichkeiten auf ungebundene gebietsbezogene Mittel eröffnet wird.
- Vielfach fehlt es an Rückhalt durch Politik und Verwaltungsspitze. Dies gilt beispielsweise für die Einrichtung des Quartiermanagements und für die Integrierten Handlungskonzepte.
6.2 Ausblick: Merkpunkte zur Weiterentwicklung des Programms 
In der ersten Phase nach Etablierung des Bund-Länder-Programms gab es angesichts der komplexen Aufgabe bei sich verschlechternden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch große Unsicherheit hinsichtlich der Verstetigung des Programms, gleichzeitig aber die Gewissheit, dass die Umsetzung des Programms mindestens zehn bis 15 Jahre in Anspruch nimmt, wenn das Ziel tragfähiger Strukturen in den Stadtteilen wirklich erreicht werden soll. Es ist daher sehr erfreulich, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien die Bedeutung einer Verstetigung dieses innovativen Stadtentwicklungsprogramms betonen.
Für 90 Prozent der Programmgebiete wurde bereits ein Quartiermanagement eingerichtet, oder es ist in Planung. Die Erfahrungen mit diesem Schlüsselelement der Programmumsetzung geben deutliche Hinweise für die Ausgestaltung eines erfolgreichen Quartiermanagements: Es muss sowohl auf politische Beschlüsse und tragfähige Organisationsstrukturen mit eindeutigen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie auf Engagement gegründet sein und alle Handlungsfelder und Ebenen (Verwaltung, intermediärer Bereich, Stadtteil) einschließen. Die in einer Reihe von Stadtteilen eingerichteten Verfügungsfonds erweisen sich als überaus hilfreiche Stützen zur Förderung von Bewohnerengagement.
Nicht in allen Kommunen wird dem Integrierten Handlungskonzept als Orientierungsrahmen und strategischem Steuerungsinstrument bislang ausreichend Bedeutung beigemessen. Hier kommt den Ländern eine tragende Rolle zu, indem sie die Bewilligung und Vergabe der Fördermittel tatsächlich an die Entwicklung und Fortschreibung qualitativ hochwertiger Handlungskonzepte binden; gute Konzepte müssen auch »honoriert« und insoweit gefördert werden. Grundsätzliche Überlegungen gründen sich deshalb darauf, die Mittelbewilligung stärker an die Qualität der Handlungskonzepte zu binden. Für den Erfolg des Programms Soziale Stadt erscheint es unerlässlich, längerfristig die Messlatte bei der Beurteilung des integrativen Gehalts, der Problemlösungskapazität und der Leistungsfähigkeit der Konzepte als Steuerungs- und Koordinierungsinstrument höher zu legen. Das heißt, man muss sich auf Qualitätsstandards für Integrierte Handlungskonzepte verständigen.
Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass dem Aufbau verlässlicher personeller und organisatorischer Infrastruktur und damit ihrer Institutionalisierung als Gerüst für die langfristig tragfähige Struktur in den Stadtteilen umsetzungsbegleitend von Anfang an stärkeres Gewicht beigemessen werden muss. Die Vielfalt von Projekten und Maßnahmen trägt nur dann zur positiven Stimmung im Stadtteil bei, wenn die Umsetzung der Projekte auf lange Sicht gewährleistet ist.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage begleitender Prozessevaluierung und Berichterstattung mit Nachdruck. Erfahrungen in den Modellgebieten machen deutlich, dass die aktivierende und dokumentierende Begleitforschung durch die PvO-Teams von den Kommunen als wichtige Unterstützung erlebt wird und deshalb auch der Wunsch nach Fortsetzung besteht.
Zwar gaben in der ersten Difu-Umfrage zwei Drittel der Gemeinden an, dass sie Erfolgskontrolle/Evaluation und Monitoring vorsehen oder bereits etabliert hätten; bei detaillierter Nachfrage zeigte sich aber, dass unter Evaluation und besonders unter Monitoring sehr Verschiedenes verstanden wird und erst in wenigen Fällen inhaltlich und methodisch ausgereifte Konzepte vorliegen. Im Schwerpunkt handelt es sich bei den bisherigen Ansätzen um die Fortschreibung der (üblichen) Statistik und Einzelbefragungen in den Programmgebieten, in der Regel als Vorbereitende Untersuchungen nach dem Städtebauförderungsgesetz. Hier zeichnet sich noch Nachholbedarf ab, denn die Evaluation ist gemäß Leitfaden der ARGEBAU »unabdingbarer Bestandteil integrierter Handlungskonzepte« (ARGEBAU 2000, S. 19). Auf Landesebene wurden auch bereits Evaluierungen in Auftrag gegeben (Bayern, Berlin, Hessen), für Nordrhein-Westfalen und Hamburg liegen bereits Evaluationsstudien vor.
Bereits Mitte der 80er-Jahre wurde mit Nachdruck aufgrund der bundesweiten Erfahrungen mit der Sanierung nach Städtebauförderung gefordert, »vorausschauend und vorbeugend das Absinken von Stadtquartieren zu Problemgebieten« zu verhindern und nicht zuzulassen, dass »soziale und räumliche Disparitäten wechselseitig verschärft werden« (Autzen u.a. 1986, S. 216). Kontinuierliche kleinräumige Beobachtung ist Basis von Prävention. Noch dominieren Nachholbedarf und Reaktion. Auch vor diesem Hintergrund sind alle vorsorgeorientierten Handlungsfelder von Sozialer Stadt (vor allem schulische und berufliche Ausbildung, Qualifizierung sowie Gesundheitsfürsorge) in besonderem Maße zu stützen, darüber hinaus aber auch der Aufbau von gesamtstädtischen Monitoringsystemen als »Seismographen« für sich abzeichnende problematische Entwicklungen in den Stadtteilen.
Anmerkungen 
(1) In dieser Difu-Umfrage sind 199 von 210 Gebieten der Programmjahre 1999 und 2000 erfasst; dies entspricht einer Rücklaufquote von 95 Prozent. ![]()
(2) Vgl. Karte des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR). ![]()
(3) Einzelheiten zu den Bündelungsleistungen von Bund und Ländern finden sich auch in der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der CDU/CSU vom 14.11.2001 (vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 14/7459). ![]()
(4) Ein vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen zusammengestellter Katalog über die Initiativen auf Bundesebene für das Programm Soziale Stadt findet sich im Internet unter sozialestadt.de/programm/foerderprogramme/uebersicht-bmvbw.shtml ![]()
(5) Nähere Informationen finden sich unter www.eundc.de ![]()
(6) Eine Programmübersicht findet sich unter sozialestadt.de/programm/partnerprogramme ![]()
(7) Hierzu weitere Informationen auf der Internetseite von gesundheitberlin.de zu Armut und Gesundheit. ![]()
(8) Soweit die verschiedenen Ebenen involviert sind. ![]()
(9) Die Richtlinie findet sich unter sozialestadt.de/gebiete/dokumente/hegiss.shtml ![]()
(10) Eine Zusammenstellung der von den Bundesländern herausgegebenen Sammlungen über die in das Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt« integrierbaren Förderprogramme finden sich im Internet unter sozialestadt.de/programm/foerderprogramme/buendelung-laender.pdf ![]()
(11) Hans Fürst, Beitrag auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Starterkonferenz, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): Dokumentation der Starterkonferenz, 1./2. März 2000 (= Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt; Bd. 4), Berlin 2000, S. 229. ![]()
(12) Im Internet unter sozialestadt.de/praxisdatenbank/ ![]()
Literatur 
![]() ARGEBAU, Ausschuss für Bauwesen und Städtebau und Ausschuss für Wohnungswesen, Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative »Soziale Stadt«, Zweite Fassung, Stand 1.3.2000, abgedruckt in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Programmgrundlagen, Berlin 2000 (Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 3).
ARGEBAU, Ausschuss für Bauwesen und Städtebau und Ausschuss für Wohnungswesen, Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative »Soziale Stadt«, Zweite Fassung, Stand 1.3.2000, abgedruckt in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Programmgrundlagen, Berlin 2000 (Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 3).
![]() Autzen, Rainer, Heidede Becker, Rudolf Schäfer und Elfriede Schmidt, Erfahrungen mit der Sanierung nach dem Städtebauförderungsgesetz Perspektiven der Stadterneuerung, Bonn-Bad Godesberg 1986 (Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Nr. 02.036).
Autzen, Rainer, Heidede Becker, Rudolf Schäfer und Elfriede Schmidt, Erfahrungen mit der Sanierung nach dem Städtebauförderungsgesetz Perspektiven der Stadterneuerung, Bonn-Bad Godesberg 1986 (Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Nr. 02.036).
![]() Becker, Heidede, Christa Böhme und Ulrike Meyer, Integriertes Handlungskonzept. Steuerungs- und Koordinierungsinstrument für die soziale Stadteilentwicklung, in: Soziale Stadt info 6, Oktober 2001, S. 2–6.
Becker, Heidede, Christa Böhme und Ulrike Meyer, Integriertes Handlungskonzept. Steuerungs- und Koordinierungsinstrument für die soziale Stadteilentwicklung, in: Soziale Stadt info 6, Oktober 2001, S. 2–6.
![]() Becker, Heidede, Thomas Franke, Rolf-Peter Löhr, Robert Sander und Wolf-Christian Strauss, Städtebauförderung und Ressourcenbündelung, Berlin 1998 (Difu-Materialien 3/98).
Becker, Heidede, Thomas Franke, Rolf-Peter Löhr, Robert Sander und Wolf-Christian Strauss, Städtebauförderung und Ressourcenbündelung, Berlin 1998 (Difu-Materialien 3/98).
![]() Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode (Hrsg.), Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Peter Götz, Dr.-Ing. Dietmar Kansy, Dirk Fischer (Hamburg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU Drucksache 14/6085 Das Programm »Die soziale Stadt« in der Bewährungsphase und seine Zukunftsperspektive für die Städte und Gemeinden, Drucksache 14/7459 vom 14.11.2001.
Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode (Hrsg.), Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Peter Götz, Dr.-Ing. Dietmar Kansy, Dirk Fischer (Hamburg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU Drucksache 14/6085 Das Programm »Die soziale Stadt« in der Bewährungsphase und seine Zukunftsperspektive für die Städte und Gemeinden, Drucksache 14/7459 vom 14.11.2001.
![]() Franke, Thomas, Aktivierung und Beteiligung im Rahmen des Programms »Soziale Stadt«, in: Soziale Stadt info 7, Februar 2002, S. 2–6.
Franke, Thomas, Aktivierung und Beteiligung im Rahmen des Programms »Soziale Stadt«, in: Soziale Stadt info 7, Februar 2002, S. 2–6.
![]() Franke, Thomas, und Gaby Grimm, Quartiermanagement: Systematisierung und Begriffsbestimmung, Themen- und Diskussionspapier vom September 2001. sozialestadt.de/programm/grundlagen (Stand: 2/2002).
Franke, Thomas, und Gaby Grimm, Quartiermanagement: Systematisierung und Begriffsbestimmung, Themen- und Diskussionspapier vom September 2001. sozialestadt.de/programm/grundlagen (Stand: 2/2002).
![]() Franke, Thomas, Rolf-Peter Löhr und Robert Sander, Soziale Stadt Stadterneuerungspolitik als Stadtpolitikerneuerung, in: Archiv für Kommunalwissenschaften (AfK), 39. Jg., H. 2 (2000), S. 243–268.
Franke, Thomas, Rolf-Peter Löhr und Robert Sander, Soziale Stadt Stadterneuerungspolitik als Stadtpolitikerneuerung, in: Archiv für Kommunalwissenschaften (AfK), 39. Jg., H. 2 (2000), S. 243–268.
![]() Freie und Hansestadt Hamburg, Stadtentwicklungsbehörde (Hrsg.), Evaluation der Maßnahmen zur Armutsbekämpfung als Bestandteil sozialer Stadtentwicklung, Hamburg 1997.
Freie und Hansestadt Hamburg, Stadtentwicklungsbehörde (Hrsg.), Evaluation der Maßnahmen zur Armutsbekämpfung als Bestandteil sozialer Stadtentwicklung, Hamburg 1997.
![]() Grimm, Gaby, Gabriele Micklinghoff und Klaus Wermker, Raumorientierung der Verwaltung. Vom Modell zur Regelstruktur: Erweiterung der Verwaltungsreform-Debatte um den räumlichen Aspekt, in: Soziale Stadt info 6, Oktober 2001, S. 13–17.
Grimm, Gaby, Gabriele Micklinghoff und Klaus Wermker, Raumorientierung der Verwaltung. Vom Modell zur Regelstruktur: Erweiterung der Verwaltungsreform-Debatte um den räumlichen Aspekt, in: Soziale Stadt info 6, Oktober 2001, S. 13–17.
![]() Hinte, Wolfgang, Bewohner ermutigen, aktivieren, organisieren. Methoden und Strukturen für ein effektives Quartiermanagement. www.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/Hinte/Quartiermanagement.htm (Stand: 9/2001).
Hinte, Wolfgang, Bewohner ermutigen, aktivieren, organisieren. Methoden und Strukturen für ein effektives Quartiermanagement. www.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/Hinte/Quartiermanagement.htm (Stand: 9/2001).
![]() ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungsprogramms für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Dortmund 2000.
ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungsprogramms für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Dortmund 2000.
![]() Krautzberger, Michael, und Birgit Richter, Neue Herausforderungen im Städtebau, in: Bauen und Siedeln, H. 3/4 (2001), S. 14–17. Lüttringhaus, Maria, Förderung von Partizipation durch integrierte Kommunalpolitik. www.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/Luettringhaus/Buergerbeteiligung.htm (Stand: 9/2001).
Krautzberger, Michael, und Birgit Richter, Neue Herausforderungen im Städtebau, in: Bauen und Siedeln, H. 3/4 (2001), S. 14–17. Lüttringhaus, Maria, Förderung von Partizipation durch integrierte Kommunalpolitik. www.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/Luettringhaus/Buergerbeteiligung.htm (Stand: 9/2001).
![]() Mohrlock, Marion, Michaela Neubauer, Rainer Neubauer und Walter Schönfelder, Let’s Organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich, München 1993 (Reihe Gemeinwesenarbeit, AG SPAK Bücher M 113).
Mohrlock, Marion, Michaela Neubauer, Rainer Neubauer und Walter Schönfelder, Let’s Organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich, München 1993 (Reihe Gemeinwesenarbeit, AG SPAK Bücher M 113).
![]() Sachs, Michael, Wohnungsunternehmen gestalten soziale Stadt, in: Bundes-SGK Sozialdemokratische Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (Hrsg.), Zukunft Stadt. Mit den Menschen für die Menschen, Berlin 2001, S. 133–141.
Sachs, Michael, Wohnungsunternehmen gestalten soziale Stadt, in: Bundes-SGK Sozialdemokratische Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (Hrsg.), Zukunft Stadt. Mit den Menschen für die Menschen, Berlin 2001, S. 133–141.
![]() Spiegel, Erika, Integrativ, kooperativ, aktivierend und umsetzungsorientiert – Konzepte und Verfahren für die soziale Stadt, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Integratives Handeln für die Stadtteilentwicklung. Dokumentation (Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 6.
Spiegel, Erika, Integrativ, kooperativ, aktivierend und umsetzungsorientiert – Konzepte und Verfahren für die soziale Stadt, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Integratives Handeln für die Stadtteilentwicklung. Dokumentation (Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 6.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 06.04.2007