soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Singen Langenrain
|
Stefan Geiss |
In Baden-Württemberg ist die Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« im Vergleich zu anderen Bundesländern durch die vom Land gesetzten Rahmenbedingungen stärker eingeschränkt. Hier wird das Bund-Länder-Programm so ausgelegt, dass die Mittel »grundsätzlich nur für investive städtebauliche Maßnahmen in räumlich abgegrenzten Gebieten eingesetzt werden« (1) können. Eine solche Vorgabe erschwert die notwendigen Managementleistungen zur ressortübergreifenden Mittelbündelung und Koordinierung der verschiedenen Akteure.
1. Gebietscharakter 
Das Modellgebiet Singen-Langenrain ist ein reines Wohngebiet. Die insgesamt rund 350 Wohneinheiten entstanden zwischen 1960 und 1976, mit der Ausnahme von zwei Mehrfamilienhäusern des sozialen Wohnungsbaus (und einem Kinderhaus), die 1991 bezugsfertig wurden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (GVV Singen mbH) und eine Baugenossenschaft (Baugenossenschaft Hegau eG) teilen sich den überwiegenden Teil des Wohnungsbestands. Zwölf Werkswohnungen sind in der Zwischenzeit im Eigentum der Mieterinnen und Mieter (überwiegend türkische Bewohnerinnen und Bewohner).
 |
| Singen-Süd (Bildquelle: Stadt Singen) |
Bei den 30 Gebäuden des Modellgebietes handelt es sich ausschließlich um viergeschossige Punkthäuser und Zeilenbauten. Ursprünglich war hier der Bau von frei stehenden Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern geplant. Ende der 50er-Jahre wurde diese Planung verworfen. Es wurden Mehrfamilienhäuser in einfacher Bauweise realisiert, um Flüchtlingen und der Bevölkerungsgruppe der Jenischen (ehemalige Landfahrer), die vorher in Baracken in direkter Nachbarschaft untergebracht waren, ein Zuhause zu bieten. Ende 1999, als die Siedlung Langenrain in das Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt« aufgenommen wurde, waren zwei Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Spätaussiedlern an das Landratsamt vermietet.
 |
Grenzen des Modellgebiets (Bildquelle: Stadt Singen) |
Der Langenrain liegt in der Singener Südstadt, zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt, und bildet die Siedlungskante der Stadt im Übergang zur offenen Flur. An das Modellgebiet selbst grenzt eine Wohnbebauung, die infolge der Entwicklung eines umfangreichen Gewerbegebiets (800 Meter breiter Gewerbe-/Industriebereich zwischen Singener Südstadt und Innenstadt) überwiegend in den 60er- und 70er-Jahren realisiert wurde (in den 80er- und 90er-Jahren Erweiterung der Wohnbebauung durch Einfamilienhäuser).
Die Bewohnerstruktur in den benachbarten Einfamilien-, Doppel-, Reihenhäusern und modernisierten Mietwohnungen (oft im privaten Eigentum der Bewohnerinnen und Bewohner) ist sozial stabil. Im Unterschied dazu wohnen im eigentlichen Modellgebiet von jeher – aus der historischen Entwicklung begründet (sehr einfache Ausstattung der Häuser der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und günstige Mieten) – sozial schwache Haushalte. Das Image ist dementsprechend traditionell negativ. Die Abweichungen des Langenrain in einigen relevanten Aspekten vom sonstigen Singen sind erheblich, wie einige demographische und sozialräumliche Merkmale zeigen.
2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale 
Der Singener Wohnungsmarkt hat sich in den letzten Jahren entspannt, weil die Bevölkerung in den 90er-Jahren erstmals stagnierte (im Unterschied zu einem rasanten Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg: Verdoppelung der Bevölkerung von 1945 bis 1990). Ende der 90er-Jahre waren die Bevölkerungszahlen sogar rückläufig. Zurzeit zeigt sich wieder ein leichter Anstieg. Der entspannte Wohnungsmarkt führte dazu, dass sozial stabile Haushalte, die eine Wahlmöglichkeit auf dem Wohnungsmarkt haben, aus dem Langenrain weggezogen sind. Aufgrund der Schlichtbauweise (zum größten Teil keine Heizung, schlechte Isolierung, hohe Zahl sehr kleiner Wohnungen usw.) zogen besonders »problematische« Haushalte zu. Mit Ausnahme der zwei neuen Mehrfamilienhäuser des sozialen Wohnungsbaus und einigen wenigen Wohnungen der Genossenschaft sind die Wohnungen nicht mehr in der Bindung und werden auch nicht durch die Stadt belegt.
Zu den zentralen Problemfeldern gehört auch, dass sich mit dem Wegzug »alteingesessener« Bewohner(-Familien) das nachbarschaftliche Leben im Langenrain verschlechtert hat. Durch den Zuzug von neuen, »problematischen« Haushalten ist das »beschützende« Milieu, das sich durch ein langes Zusammenwohnen über Jahre entwickelt hatte, zerfallen. Es entstand ein Wohnquartier voll innerer Spannungen und auch Aggressionen. Kinder und Jugendliche leben hier in einer Nachbarschaft, deren ökonomische und gesellschaftliche Beziehungsnetze schwach sind. Es entfalten sich mitunter kriminelle »Karrieren«. Im Jahr 1999 sind 30 Prozent der Jugendlichen und Heranwachsenden aus dem Langenrain straffällig geworden (in Singen insgesamt zehn Prozent).
Die offene Gestaltung der wohnungsnahen Freiflächen (asphaltierte Abstandsflächen bis an die Wohngebäude ohne schützende Pufferzonen) führt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern zu einem Gefühl der Unsicherheit und trägt zu einer geringen Verantwortlichkeit bei. Dementsprechend war das Wohnumfeld am Beginn des Programms »Soziale Stadt« sehr verwahrlost. Auf dem Abstandsgrün und an den Straßen (von allen Seiten einsehbar) standen alte Möbel, sonstiger Sperrmüll und überfüllte Mülltonnen (mit Ausnahme der direkt an die Gebäude der Wohnungsgenossenschaft angrenzenden Bereiche). Dadurch hat sich das Außenimage erheblich verschlechtert. Die Stigmatisierung führt dazu, dass Jugendliche, die sich um eine Lehrstelle bemühen, oder erwachsene Arbeitslose, die einen Arbeitsplatz suchen, allein schon wegen der Adresse auf strikte Ablehnung stoßen.
 |
Abstandsflächen ohne schützende Pufferzone (Bildquelle: empirica, Berlin) |
 |
Attraktive Lage im Übergang zur offenen Flur (Bildquelle: empirica, Berlin) |
Trotz der von Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Langenrain und aus den angrenzenden Wohngebieten im Rahmen der Starterkonferenz und bei vielen Einzelgesprächen vorgetragenen Kritik wird der Wohnstandort als solcher positiv bewertet. Daneben zählt zu den Potenzialen des Gebietes in erster Linie dessen attraktive Lage. Die weite Sicht in die freie Landschaft, die Freizeitqualitäten aufgrund der Nähe zu Wiesen, Feldern und Wäldern und die Nachbarschaft zu einer sozial stabilen Bevölkerungsstruktur sind auch die Gründe für die prinzipiell positive Einschätzung.
3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte 
Aufgrund der Standortqualitäten, die auch die Bürgerinnen und Bürger im Singener Süden (über das Modellgebiet hinaus) schätzen, hat sich die »Lenkungsgruppe« (vgl. 5. »Organisation und Management«) für eine durchgreifende Aufwertungsstrategie entschieden. Entwicklungsziel ist es, der Stigmatisierung entgegenzuwirken und mittel- bis langfristig die Tendenz zur »Ghettoisierung« umzukehren. Neben der stärkeren sozialen »Durchmischung« der Bewohnerschaft liegen die Handlungsschwerpunkte der Aufwertungsstrategie in der Modernisierung, der Privatisierung im Bestand (Eigentumswohnungen für Mieterinnen und Mieter) und dem Abriss von Teilbereichen, um zusätzlich kostengünstige Wohnangebote für den Eigentumserwerb realisieren zu können. Durch die Modernisierung und die neuen Wohnangebote sollen sozial stabile Haushalte gehalten oder neu gewonnen werden.
DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE (2000)
|
Langenrain |
Singen |
|
|
Größe |
5,2 ha |
6 177 ha |
|
Einwohnerzahl |
(1) |
43 932 |
|
Bevölkerungsverlust |
(2) |
(3) |
|
Durchschnittliche Haushaltsgröße |
1,9 Pers. |
2,3 Pers. |
|
Anzahl der Wohnungen |
350 (4) |
nicht verfügbar |
|
Leerstand |
(5) |
nicht verfügbar |
|
Anteil der Wohngeldempfänger |
nicht verfügbar |
3,1 % |
|
Arbeitslosenquote |
nicht verfügbar |
11,9 % |
|
Anteil der Sozialhilfeempfänger |
17 % |
5,9 % |
|
Anteil ausländische Bevölkerung |
46 % |
17 % |
|
Anteil der bis 18-Jährigen |
29 % |
19 % |
|
Anteil der 60-Jährigen und älter |
14 % |
27 % |
|
|
||
Da die geplante Aufwertung nur gelingen kann, wenn parallel eine soziale Stabilisierung erreicht wird, gibt es einen zweiten Handlungsschwerpunkt: Initiiert und begleitet durch die »Lenkungsgruppe« (ressortübergreifende Entscheidungen und Unterstützungen) werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren (Schulen, Kinderschutzbund, Arbeitsamt, Team der Programmbegleitung-vor-Ort) Maßnahmen umgesetzt, die die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Bewohnerinnen und Bewohner zumindest zu lindern versuchen und deren Kompetenzen mobilisieren.
Diese Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte sind als Rahmenplanung zu verstehen, die im Laufe des Verfahrens konkretisiert und fortgeschrieben wurden. Noch bevor das Modellgebiet in das Programm »Soziale Stadt« aufgenommen wurde, hat die städtische Wohnungsgesellschaft eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die sich mit der Problemsituation im Wohnquartier und möglichen Lösungsansätzen auseinander gesetzt hat (Stärken-Schwächen-Analyse, 1999 von empirica durchgeführt). Im Ergebnis wurden drei Entwicklungsszenarien skizziert, wobei das Aufwertungsszenario mit »teilweise neuer Bewohnerstruktur« vom Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft favorisiert wurde.
Mit Beginn der Aufnahme in das Programm »Soziale Stadt« hat die Stadt Singen die städtische Wohnungsbaugesellschaft als Sanierungsträgerin mit der Erstellung einer vorbereitenden Untersuchung beauftragt. Die vorbereitende Untersuchung hat die Ergebnisse der Stärken-Schwächen-Analyse aufgegriffen und konkretisiert (Festlegung, welche Häuser modernisiert bzw. abgerissen werden; erste Vorschläge für soziale Maßnahmen usw.). Parallel zur Einrichtung der »Lenkungsgruppe« wurde die Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung mit offenem Planungsverfahren in Auftrag gegeben (Auftraggeber: Stadt Singen, Auftragnehmer: Büro Both). Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung wurden in der »Lenkungsgruppe« als Integriertes Handlungskonzept fortgeschrieben (Verantwortung bei dem Quartiersmanager). Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts ist so angelegt, dass über das Überprüfen der konkreten Nachfrage letztlich entschieden wird, wie viele Häuser modernisiert bzw. abgerissen werden. Durch dieses prozesshafte Vorgehen konnte eine Fehllenkung von Kapital verhindert werden (keine Subventionen in die Modernisierung von Wohnungen, die keine Nachfrage finden). Ursprünglich war nur der Abriss von zwei Wohngebäuden und die Modernisierung der restlichen Gebäude vorgesehen. Nach der Modernisierung der ersten Gebäude hat sich herausgestellt, dass trotz der moderaten Miete von 8,50 DM/Quadratmeter die Nachfrage sehr zögerlich ist. Aus diesem Grund werden jetzt zwei weitere Gebäude abgerissen statt modernisiert.
In der »Lenkungsgruppe« hat man sich darauf geeinigt, dass auf den frei werdenden Grundstücken kostengünstige Eigenheime für Bewohnerinnen und Bewohner, die heute im Langenrain und angrenzenden Wohngebieten leben und ohne günstige Angebote kein Eigentum erwerben könnten, realisiert werden sollen. Um die Kosten für die Eigenheime möglichst niedrig zu halten, hat die »Lenkungsgruppe« (unter Hinzuziehung fachlicher Beratung) eine Argumentation zur Verhinderung eines Ausgleichsbetrags nach § 155 (4) als Stadtratvorlage erarbeitet. Darüber hinaus wird aktuell geprüft (Recherche bei anderen Projekten), inwieweit durch »professionell« gesteuerte Gruppenleistungen die Kosten verringert werden können (Ersatz für den Eigenkapitalanteil).
4. Schlüsselprojekte 
Die behutsame Modernisierung von Wohngebäuden hat zum Ziel, den Substandard abzubauen (energetische Modernisierung, Sanitäranlagen, Balkone und Wohnumfeld) und Familienwohnungen anzubieten (Zusammenlegung von kleinen Wohnungen zu familiengerechten Wohnungen). Bisher wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser, die modernisiert wurden, persönlich aufgesucht (statt »Sprechstundenmanagement«) und zur Bedarfssituation, den Wünschen und den finanziellen Möglichkeiten befragt. Für die Zeit der Modernisierung werden ihnen alternative Wohnungen angeboten, und sie haben die Option, zurückzuziehen; »Sanierungsflüchtlinge« sollen vermieden werden. Bisher konnten alle Mieterinnen und Mieter im Bestand der Wohnungsbaugesellschaft an anderen Standorten untergebracht werden, und die meisten möchten nicht zurückziehen.
 |
Modernisierung im Bestand (Bildquelle: empirica, Berlin) |
 |
»Behutsamer« Abriss (Bildquelle: empirica, Berlin) |
Ziel der »Werkstatt« für Integration und Vermittlung« ist es, den verschiedenen Bewohnergruppen mit besonderen Benachteiligungen den Zugang zu den »normalen« Angeboten (Ausbildung und Arbeitsmarkt) zu erleichtern. Im Einzelnen geht es um die Befähigung zur Bewältigung von Alltags- und Lebensproblemen:
- Kinder und Jugendliche, die noch zur Schule gehen, sollen bei Tätigkeiten, die sie persönlich interessieren, z.B. Fahrräder reparieren, einfachste Alltagsqualifikationen erlernen (Pünktlichkeit, Ausdauer) mit dem Ziel der Stabilisierung einer Lebensperspektive, deren integraler Bestandteil Erwerbsfähigkeit ist. Zielgruppe sind Jugendliche aus Familien, die in mehreren Generationen von Transferleistungen leben. Familien aus den Gruppen Jenische, Sinti und Roma sind in aller Regel in ihre sozialen Netze fest eingebunden und haben keinen Kontakt zum »normalen« Arbeitsmarkt.
- Jugendliche ohne Lehrstelle, die aufgrund ihrer isolierten Welterfahrung keinen Anreiz sehen, eine Lehrstelle zu suchen, oder Schwierigkeiten haben, sie »durchzustehen«, sollen im Rahmen einer sinnvollen Beschäftigung/Qualifikation motiviert werden. Sie sollen unter Anleitung (Handwerker, Sozialpädagoge) und individueller Begleitung Alltagsqualifikationen erlernen, um den Weg aus der Armutsfalle zu finden. Im Vordergrund stehen die Identifikation mit dem Stadtteil (sinnvolle Tätigkeiten in Absprache mit den Wohnungsunternehmen) und die Hinführung zum Arbeitsmarkt durch gezielte Persönlichkeitsbildung (Berufsreife), die sowohl den Erwerb sozialer und berufsrelevanter Kompetenzen als auch die spielerische Aneignung von Bildung (Internet, EDV usw.) umfasst.
- Allein erziehende Mütter, die bei der Organisation des Alltags überfordert sind (z.B. ihre Kinder mit gesundem Essen zu versorgen, mit Geld zu wirtschaften) sollen mittelfristig in das Projekt »Werkstatt« integriert werden. Alltagsfähigkeiten sollten nicht über eine theoretische Qualifizierung, sondern über eine praktische Tätigkeit erlernt werden. Hier bietet sich an, Essen für die Kinder aus dem Kinderhaus und eventuell auch für die Jugendlichen, die in der »Werkstatt« arbeiten, zuzubereiten (Verbindung mit wirtschaftlicher Planung und Einkaufen).
 |
Verbesserungsmaßnahmen am Kinderhaus (Bildquelle: empirica, Berlin) |
Es ist geplant, die investiven Maßnahmen der »Werkstatt« über das Programm »Soziale Stadt« zu fördern. Für die Anschubfinanzierung der nicht investiven Maßnahmen (vor allem Personal) wird zurzeit in Kooperation mit dem Arbeitsamt die Kombination mit anderen Förderprogrammen geprüft.
Mit Jugendlichen, die keine Aufenthaltsmöglichkeiten im Wohnquartier haben, wurden unter Anleitung eines Künstlers Verbesserungsmaßnahmen am Kinderhaus durchgeführt. Mittel- bis langfristig soll das Kinderhaus erweitert werden: Dort sollen Unterstützung bei Hausaufgaben und dem Einüben von Sozialverhalten angeboten und eine offene Jugendarbeit initiiert werden. Im Einzelnen geht es um folgende Maßnahmen:
- Am Rande des Wohngebiets sollen Container als »überdachter« Treff für »problematische« Cliquen Jugendlicher in den Wintermonaten aufgestellt werden (später: Integration in geplante »Werkstatt«).
- Geplant ist die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt (in Kombination mit der geplanten »Werkstatt«).
- Angeboten werden eine Einzelberatung für Jugendliche sowie das gemeinsame Aufsuchen von Ausbildungs- und Beschäftigungseinrichtungen, um »Vorurteile« und Hemmnisse abzubauen.
- Ausflüge mit Jugendlichen sollen organisiert werden (Finanzierung über Sponsoring).
5. Organisation und Management 
Die für den Langenrain geplante Nachbarschaftsentwicklung, die nicht nur eine Stabilisierung sondern eine mittel- bis langfristig durchgreifende Aufwertung des Wohnquartiers zum Ziel hat, kann nicht als ein kommunales Entwicklungsprojekt unter anderen vorangetrieben werden. Aus diesem Grund wurde eine »Lenkungsgruppe« eingerichtet. Zu deren festen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören: Fachbereich Bauen; Fachbereich Jugend, Soziales, Ordnung; Fachbereich Finanzen; Betriebe; die beiden Wohnungsunternehmen; der Quartiersmanager, der bei der städtischen Wohnungsgesellschaft angesiedelt ist. Ziel der »Lenkungsgruppe« ist es, die einzelnen Maßnahmen (inklusive Finanzierung) vorzubereiten und zu koordinieren. Sie erarbeitet Vorschläge für rechtsverbindliche Beschlüsse, die im Gemeinderat entschieden werden. Die Maßnahmen, die die Lenkungsgruppe vorbereitet und koordiniert, sind am Bedarf vor Ort orientiert.
Neben Bürgerversammlungen und verschiedenen Arbeitskreisen mit Bewohnerinnen und Bewohnern ist der »Quartiersmanager« der Vermittler zwischen dem Wohngebiet und der »Lenkungsgruppe«. Er steht in ständigem Kontakt mit der Bewohnerschaft (regelmäßiges Aufsuchen aller Haushalte und informelle Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern).
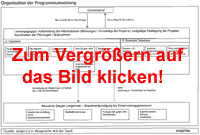 |
Organisation der Programmumsetzung |
Von Zeit zu Zeit treffen sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener institutioneller Akteure (z.B. soziale Dienste, Schulen) im Rahmen von Stadtteilkonferenzen und erarbeiten Vorschläge (Projekte, Maßnahmen) für die »Lenkungsgruppe « (beratende Teilnahme dieser Akteure). Der Prozess wird begleitet von mit Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. Experten (z.B. Grünplanern) durchgeführten Arbeitskreisen zu den jeweiligen Handlungsschwerpunkten.
Es sind erhebliche Probleme bei den nicht investiven Maßnahmen zu konstatieren. Beispielsweise soll der Quartiersmanager – so die Auslegung des Bund-Länder-Programms in Baden-Württemberg – Kontakt mit der Bewohnerschaft nur immer im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen (Modernisierung und Umzug) aufnehmen. Die soziale Stabilisierung kann überwiegend nur durch nicht investive Maßnahmen erfolgen. Da diese in Baden-Württemberg nicht über das Programm »Soziale Stadt« gefördert werden und auch keine Anschubfinanzierung möglich ist, gibt es erhebliche Hemmnisse, die nur mit einem besonderen Einsatz aller Akteure überwunden werden können: durch »ehrenamtliche« Recherchen und Mitarbeit; indem Träger gefunden werden, denen es nicht nur um die Finanzierung ihres Personals und ihrer Infrastruktur geht, sondern die sich für einen integrierten Ansatz, der sich an der Zielgruppe orientiert, engagieren (erheblich höherer Arbeitsaufwand ohne finanzielle Zusatzförderung) (2).
In der Zwischenzeit hat sich durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Verantwortlichen in der »Lenkungsgruppe« ein Gefühl der Gesamtverantwortung entwickelt, und es werden nach und nach andere Dienstleister (insbesondere Schulen) und Akteure mit ihrem entsprechenden Expertenwissen zu der »Lenkungsgruppe« hinzugezogen.
6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
In Singen wurde die Verbesserung als eine Strategie »von unten nach oben« verstanden und praktiziert:
Aktivierung und Beteiligung im Entscheidungsprozess
Im Rahmen der Stärken-Schwächen-Analyse (informelle Einzel-/Gruppengespräche und Gebietsbegehungen) und der vorbereitenden Untersuchung wurden vor Ort Informationen zum Handlungsbedarf gesammelt und durch statistische Analysen sowie durch »aufsuchende Recherchen« (persönliche Interviews in den Wohnungen) seitens des Quartiersmanagers und des PvO-Teams die auffälligen Konflikte, Probleme und Ressourcen im Wohnquartier identifiziert. Die Vor-Ort-Ermittlungen werden regelmäßig durch das PvO-Team und den Quartiersmanager aktualisiert. Parallel zur Ermittlung der Bedarfssituation aus Sicht der Bewohnerschaft wurde Expertenwissen herangezogen. Dabei wurden mit allen Akteuren, die im Gebiet selbst tätig sind, sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der wichtigsten Institutionen, die für das Quartier eine Rolle spielen, Gespräche geführt wurden.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Stärken-Schwächen-Analyse wurden die strategischen Ziele und Handlungsschwerpunkte festgelegt (»Lenkungsgruppe«) und eine Starterkonferenz durchgeführt (Integration der Bewohnerschaft in den Entscheidungsprozess). An dieser Starterkonferenz nahmen etwa 200 Bewohnerinnen und Bewohner teil. Unter Beteiligung aller involvierten Akteure wie Wohnungsunternehmen, Verwaltung, Schulen, Kindereinrichtungen usw. wurden mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam Projektideen erörtert. Jugendliche haben im Rahmen dieser Veranstaltung die Problemsituation aus ihrer Sicht (Vorbereitung durch »Cliquen-Gespräche«) dargestellt. Die Ergebnisse der Starterkonferenz wurden in der »Lenkungsgruppe« ressortübergreifend vertieft, konkretisiert und auf ihre Machbarkeit hin überprüft (rechtliche Fragen, Finanzierbarkeit). Im Anschluss an die Starterkonferenz wurden drei professionell gesteuerte Arbeitskreis-Treffen (offene Bürgerbeteiligung zum »Städtebaulichen Rahmenplan« mit jeweils zwischen elf und 27 Interessierten) durchgeführt; ihre Themen: »Siedlung/Grün- und Freiräume«, »Verkehr/Mobilität/Einkauf/ Arbeiten/Gewerbe«, »Kultur/Soziales/Infrastruktur«.
Im Rahmen einer Themenkonferenz im Februar 2002 wurden die konkretisierten und auf ihre Machbarkeit hin überprüften Einzelprojekte mit den Bürgerinnen und Bürgern (persönliche Einladung aller im Modellgebiet Wohnenden sowie jener aus den angrenzenden Wohnquartieren) sowie verschiedenen Akteuren diskutiert. Jugendliche aus dem Quartier bereicherten die Themenkonferenz durch eine musikalische Darbietung.
Angesichts der Zusammensetzung der Bevölkerung im Langenrain geht es weniger um die Beteiligung der Bewohnerschaft an einzelnen Aktionen; vielmehr gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, die bei den Betroffenen – statt einer Betreuung und Unterstützung durch Sozialstaatsleistungen – mittel- bis langfristig die Befähigung entstehen lassen, das eigene Leben ohne fremde Hilfe zu meistern. Zwei typische Beispiele zur Erreichung dieses Anliegens sind 1. die Bemühungen um »niedrigschwellige« Integrations- und Vermittlungsmaßnahmen sowie 2. die Ausrichtung des Rahmenplans für die Wohnumfeldgestaltung weniger nach städtebaulichen »Qualitäten« als nach sozialräumlichen Kriterien (nachhaltige und konfliktfreie Nutzung des Wohnumfelds). Hierzu wurden Erfahrungen aus anderen Städten recherchiert und im Rahmen eines Workshops mit den Grünplanern, dem Planungsamt und den Wohnungsunternehmen auf ihre Übertragbarkeit (hier insbesondere: nachhaltige Akzeptanz durch die Bewohnerschaft) hin erörtert. Als Nächstes sind konkrete Umsetzungsmaßnahmen mit Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner geplant.
Öffentlichkeitsarbeit
Aktionen wie die Starterkonferenz, die Themenkonferenz, Stadtteilkonferenzen, Workshops, der Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner in das modernisierte Gebäude wurden mit schriftlichen Informationen für die Presse verbunden, zum Teil wurden Journalistinnen und Journalisten persönlich eingeladen. Im Unterschied zur öffentlichen Stigmatisierung in der Vergangenheit hat sich in der Zwischenzeit eine positive Zusammenarbeit mit den Medien entwickelt. So wurde im Zeitraum von Ende 2000 bis Anfang 2002 insgesamt etwa 40 mal positiv über das Modellgebiet und das Programm »Soziale Stadt« berichtet. In den Titeln der Pressemeldungen kommt schon die beabsichtigte und in Gang gesetzte Aufwertung des Quartiers zum Ausdruck.
7. |
Fazit: Durchgreifende Aufwertung nur durch weit greifende Kooperationen
|
Durch das Baden-Württemberger Verfahren, im Rahmen des Programms »Soziale Stadt« nur investive Maßnahmen zu finanzieren, sind das ressortübergreifende Arbeiten und das Erreichen von Synergieeffekten durch Bündelung der Mittel erschwert. Hier wird mehr einem additiven und weniger einem integrativen Ansatz Rechnung getragen.
Trotz dieser vergleichsweise schlechten Rahmenbedingungen ist bisher die Kooperation zwischen sehr heterogenen Akteuren gelungen. So ist z.B. in der »Lenkungsgruppe« ansatzweise die Aufsplittung der Verwaltung überwunden. Um eine Gesamtstrategie zu entwickeln und in die Praxis umsetzen zu können, wird zurzeit die Kooperation zwischen den kommunalen Ämtern ausgedehnt: Kooperation mit Schulen und Arbeitsamt.
Es ist gelungen, nicht nur – wie oft üblich – »Hobbyprojekte« der Verwaltung und Maßnahmen, die den Wünschen artikulationsstarker Bewohnerinnen und Bewohner entsprechen, zu starten. Die Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte orientieren sich an der Stärken-Schwächen-Analyse, und die Maßnahmen beschränken sich nicht nur auf optische und direkt erfahrbare Verbesserungen (z.B. Verschönerung des Wohnumfelds, saubere Spielplätze, neue Spielmöglichkeiten, Räume für Müttertreffs usw.): Durch eine durchgreifende Aufwertungsstrategie sollen mittel- bis langfristig die Tendenz zur »Ghettoisierung « umgekehrt und eine soziale Mischung im Modellgebiet hergestellt werden. Und mit dem Projekt »Werkstatt für Integration und Vermittlung« ist geplant, die im Modellgebiet verbreitete Abhängigkeit von Sozialstaatsleistungen zu überwinden.
 |
 |
| Starterkonferenz (Bildquelle: empirica, Berlin) |
|
Die Ressourcen und Konzepte des Programms »Soziale Stadt« reichen (noch) nicht aus, um die Qualität öffentlicher Leistungen durchgreifend aufzuwerten. Schulen sowie andere Einrichtungen (z.B. Kinderhaus) in einem Wohngebiet mit einem extrem hohen Ausländeranteil (in Langenrain 50 Prozent) benötigen größere Kapazitäten und ein breiter angelegtes Leistungsangebot. Eine Schule in einer solchen Nachbarschaft muss ein »anderes« Produkt oder eine »andere« Produktkombination anbieten als etwa eine Schule in einem Villenviertel. Standardisierte »Massengüter« reichen nicht aus. Im Zeitalter der Einwanderung und der Differenzierungen in der Berufswelt mit ihren Anforderungen gilt es auch für den Staat, »lokaler« und deutlich »angepasster« an örtliche Bedingungen zu agieren. Durch das Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« wurden Türen aufgestoßen; jetzt müssen die dahinter liegenden Räume mit neuen Inhalten gefüllt werden.
Anmerkungen
(1) Bekanntmachung des Wirtschaftsministeriums über die im Jahr 2002 vorgesehenen Programme für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung, Absatz 4: Bund-Länder-Programm »Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt« (21.5.2001, Az.: 6-2521.2-02/1). ![]()
(2) In Singen konnte dieses Manko durch den »Zufall« kompensiert werden, dass für das Modellgebiet eine Projektbegleitung-vor-Ort eingerichtet wurde, die unter anderem Aufgaben des Quartiermanagements übernehmen konnte (Aufgaben der PvO: Projektsteuerung und Dokumentation). ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005