soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Schwerin Neu Zippendorf |
|
|
Cathy Cramer |
1. Gebietscharakter 
Ab 1971 erfuhr Schwerin durch die Errichtung des Industriegebiets »Schwerin-Süd« und die damit verbundene Stadterweiterung durch die drei Neubaugebiete Großer Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz einen Entwicklungsschub. Die drei Stadtteile gehören zu den größten zusammenhängenden Neubaustadtteilen in industrieller Bauweise in Mecklenburg-Vorpommern. Sie befinden sich einige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt im Südosten der Stadt, zwischen Wald und See.
Der Stadtteil Neu Zippendorf wurde, wie die beiden anderen Großwohnsiedlungen, als »reines Wohngebiet« mit guter Infrastrukturausstattung geplant und gebaut. Der Bau begann 1976 nach der Errichtung des Stadtteils Großer Dreesch. Die letzten Wohngebäude in Neu Zippendorf wurden 1980 gebaut. Von den ehemals 5 300 industriell errichteten Wohnungen liegen 25 Prozent in elfgeschossigen Hochhäusern. Eigentümer des Wohnungsbestands sind zwei Wohnungsunternehmen.
Bereits 1974 wurde der Straßenbahnbetrieb vom Stadtzentrum bis zum Berliner Platz aufgenommen. Er verbindet Neu Zippendorf mit der Innenstadt und den anderen Neubausiedlungen auf dem Dreesch. Die Straßenbahntrasse und eine vierspurige Hauptstraße zerschneiden das Gebiet in drei Quartiere.
Seit der Wende ist Neu Zippendorf durch einen starken Bevölkerungsrückgang geprägt. Zukünftig wird mit einem weiteren Bevölkerungsverlust im Gebiet durch Geburtenrückgang und Abwanderung sowohl innerhalb Schwerins als auch über die Stadtgrenze hinaus zu rechnen sein. Der mit dieser Entwicklung verbundene Leerstand wird trotz Abriss und Rückbau im Zuge des neuen Förderprogramms zum Stadtumbau weiter bestehen.
2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale 
Die zentralen Problemfelder in Neu Zippendorf stehen in engem Zusammenhang mit den demographischen und sozial-strukturellen Veränderungen seit der Wende. Befördert durch die städtische Belegungspolitik zogen vor allem sozial schlechter gestellte Haushalte, Ausländerinnen und Ausländer, Russlanddeutsche und jüdische Migrantinnen und Migranten überwiegend aus Osteuropa in das Gebiet. Neben einer hohen Fluktuation sind auch starke Veränderungen in der Sozial- und Altersstruktur der Bewohnerschaft zu beobachten; so wird die Überalterung weiter zunehmen. Indizien für eine negative Veränderung der Sozialstruktur sind unter anderem ein steigender Bedarf an Hilfen zur Erziehung, die zunehmende Zahl von Schulverweigerungen, eine unzureichende familiäre Fürsorge und die Zunahme der Mietschuldner. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen liegt unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt und ist auch etwas niedriger als in den angrenzenden Neubaugebieten Großer Dreesch und Mueßer Holz.
 |
| Die Lage der Gebiete Großer Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz (v.l.n.r.) (Bildquelle: Stadt Schwerin) |
Die aufgezeigten Entwicklungen belasten das Zusammenleben im Modellgebiet. Die verschiedenen Bewohner- und Altersgruppen haben unterschiedliche Lebensstile und Vorstellungen zur Gebietsnutzung. Sprachprobleme der Migrantinnen und Migranten erschweren die Verständigung mit der alteingesessenen Bevölkerung, damit auch die Integration. Die wenigen Integrationsangebote, Freizeiteinrichtungen und Begegnungsstätten reichen nicht aus. Obwohl dem Stadtteil Neu Zippendorf eine Zentrumsfunktion zugedacht war, fehlt es an entsprechenden Angeboten speziell im Kultur- und Bildungsbereich.
 |
Das Neubaugebiet Neu Zippendorf zwischen Wald und Schweriner See (Bildquelle: Stadt Schwerin) |
Bauliche und wirtschaftliche Probleme zeigen sich besonders rund um den Berliner Platz. Dieser war ursprünglich als Zentrum für alle drei Bauabschnitte vorgesehen. Durch den Bau von Stadtteilzentren in den beiden benachbarten Stadtteilen Mitte der 90er-Jahre hat der Platz seine Zentrumsfunktion weitgehend verloren. Das Angebot in Läden und auf dem Wochenmarkt wurde teilweise auf Billigwaren verlagert, Qualität und Vielfalt gastronomischer Einrichtungen sanken, und Ladenleerstände nahmen zu. Die Gestaltung des Platzes weist überdies ästhetische und funktionale Mängel auf.
 |
Die Außenanlagen des Jugendclubs Deja Vu müssen saniert und neu gestaltet werden. (Bildquelle: Cathy Cramer, Berlin) |
 |
Der Wochenmarkt am Berliner Platz wird rege aufgesucht. (Bildquelle: Stadt Schwerin) |
Negativ wirkt sich auch aus, dass Modernisierung und Sanierung in Neu Zippendorf nicht so weit fortgeschritten sind wie in den beiden anderen Stadtteilen.
Große Teile der Bewohnerschaft und der Gewerbetreibenden sehen das Image des Stadtteils beschädigt: durch die auch im äußeren Erscheinungsbild wahrnehmbare Zunahme von sozial schwachen Bevölkerungsgruppen, durch die Veränderungen in Einzelhandel und Gastronomie sowie durch leer stehende Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen.
Zu den Entwicklungspotenzialen Neu Zippendorfs gehören dessen räumliche Lage zwischen Wald und See, die gute Verkehrsanbindung an die Innenstadt, Flächenpotenziale durch Abriss und Umnutzung von Gebäuden, ausreichende Einkaufsmöglichkeiten sowie die bereits vorhandenen sozialen und freizeitbezogenen Infrastrukturangebote. Der Stadtteil ist mit zwei Alten- und Pflegeheimen außerdem ein wichtiger Standort für stationäre Alteneinrichtungen. Weitere Einrichtungen der offenen Altenhilfe, wie etwa der Seniorenclub, wirken sich positiv auf den sozialen Austausch zwischen den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern aus. Anfang 2001 wurde vom Verein »Hand in Hand e.V.« in Zusammenarbeit mit der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft e.G. ein Nachbarschaftstreff eingerichtet, der von einem Bewohnerbeirat verwaltet wird.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner leben schon lange im Modellgebiet und identifizieren sich mit dem Stadtteil, sie pflegen Nachbarschaften und beteiligten sich bereits sehr engagiert an der Rahmenplanung. Bei den zugezogenen Migrantengruppen sind häufig intakte Familienstrukturen vorhanden, die zur sozialen Stabilisierung im Gebiet beitragen können. Durch diesen Zuzug wurde der Leerstand gemildert.
Demographische und sozialräumliche Merkmale
|
Neu Zippendorf |
Schwerin |
|
|
Größe |
70 ha |
13 033 ha |
|
Einwohnerzahl (2000) |
8 019 |
103 084 |
|
Bevölkerungsverlust(1993–2000) |
40 % |
20 % |
|
Durchschnittliche Haushaltsgröße (2000) |
2,0 Pers. |
Pers. 2,2 Pers. |
|
Anzahl der Wohnungen (2001) |
4 497 |
59 046 |
|
Leerstand (2001) |
14 % |
13,7 % |
|
Anteil der Wohngeldempfänger (1999) |
nicht verfügbar |
11 % |
|
Arbeitslosenquote (2000) |
23,6 % |
16,3 % |
|
Anteil der Sozialhilfeempfänger (1999) |
4,5 % |
2,7 % |
|
Anteil ausländische Bevölkerung (2000) |
8,9 % |
3,3 % |
|
Anteil der bis 20-Jährigen (2000) |
20,5 % |
19,8 % |
|
Anteil der 60-Jährigen und älter (2000) |
24,9 % |
23,4 % |
Laut einer Umfrage unter den Gewerbetreibenden am Berliner Platz bekunden trotz schlechter Umsatzlage über 70 Prozent der Befragten eine hohe Standortbindung – eine gute Grundlage für die geplante Entwicklung eines lokalökonomischen Konzeptes mit den Gewerbetreibenden.
3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte 
Im Zusammenhang mit der Aufnahme Neu Zippendorfs in das Programm »Weiterentwicklung großer Neubaugebiete – Wohnumfeldverbesserungsprogramm« wurde 1998 bis 2000 ein Rahmenplan (städtebaulicher und sozialkommunikativer Teil) mit Bewohnerbeteiligung erstellt und dabei auch ein Leitbild für den Stadtteil entwickelt: »Neu Zippendorf: Attraktives Wohnen zwischen Wald und See«.
Aufgrund der Analyse der Probleme und Potenziale im Gebiet wurden im Rahmenplan folgende Ziele formuliert:
- Imageaufwertung des Stadtteils;
- Erhöhung der Bedeutung Neu Zippendorfs für die drei Neubaugebiete und die Gesamtstadt;
- Stärkung der Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen;
- Förderung der Qualifizierung im Gebiet;
- Entwicklung von Flächenpotenzialen;
- Stabilisierung von Nachbarschaften;
- Verbesserung von Freizeit- und Kulturangeboten für alle Altersklassen und Bewohnergruppen;
- Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Stadtteil; behindertengerechte Gestaltung des Wohnumfelds.
Weitere Ziele wurden von den im Rahmen der Stadtteilkonferenz entstandenen Arbeitsgruppen und dem Lenkungskreis auf Stadtteilebene entwickelt und in der Stadtteilkonferenz bestätigt:
- Integration von Ausländern und Spätaussiedlern;
- Verbesserung der Angebote für Kinder der Altersklassen 6–10 Jahre und 10–14 Jahre;
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit.
Die wichtigsten Handlungsschwerpunkte bislang sind:
- Schaffung eines Stadtteilzentrums am Berliner Platz, verbunden mit einer gestalterischen Aufwertung;
- Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule und deren Erweiterung zu einem Kommunikations- und Veranstaltungsort für den gesamten Dreesch;
- zusätzliche Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche;
- interkulturelle Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten;
- Rückbau und Abriss von Wohngebäuden, Infrastruktureinrichtungen;
- Umnutzung von Brachflächen und Infrastruktureinrichtungen;
- Abstimmung und Vernetzung von Angeboten der Initiativen und freien Träger im Gebiet.
Ein integriertes Handlungskonzept liegt noch nicht vor, soll aber prozessbegleitend entwickelt werden. Zur Antragstellung akzeptierte das Land die Rahmenplanung als ersten Baustein.
Der Schwerpunkt der Handlungsfelder und Projekte hat sich seit Beginn des Programms »Soziale Stadt« verlagert: weg von der Sanierung und Modernisierung der Wohnungen, hin zur Stärkung von sozialen Aktivitäten und zu Maßnahmen, die das Zusammenleben fördern.
4. Schlüsselprojekte 
Seit Beginn der Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« wurden verstärkt Projekte im Bereich der sozialen Infrastruktur und des Zusammenlebens entwickelt. Nachstehende Projekte sind für die Weiterentwicklung und Stabilisierung des Modellgebiets von besonderer Bedeutung und werden als Schlüsselprojekte für die Gebietsentwicklung angesehen.
Im Rahmen des Projekts Freiwilliges Soziales Trainingsjahr werden benachteiligten Jugendlichen arbeitsweltliche und soziale Kompetenzen vermittelt. Träger dieser auf drei Jahre angelegten Qualifizierungsmaßnahme ist der Internationale Bund, die Jugendlichen werden von vier Sozialpädagogen betreut. Das Projekt ist ein Baustein der bundesweiten Programmplattform »Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten« (E & C) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für die Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme wurden ehemalige Gewerbeflächen umgebaut, neben einem Büro entstand als Treffpunkt für die Jugendlichen ein Café.
Erste größere Maßnahme im Jahr 2000 war die Einrichtung des Nachbarschaftstreffs Tallinner Straße in Zusammenarbeit mit der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft e.G. (SWG) und dem Verein »Hand in Hand e.V.«. Dadurch ist ein wohnungsnaher, nichtkommerzieller Freizeittreff mit vielfältigen Angeboten für alle Altersgruppen im Stadtteil entstanden. Ein Bewohnerbeirat zeichnet für das Programm verantwortlich. Betreut wird der Treff durch eine Wohngebietsbetreuerin aus dem Team, das in den Nachbarschaftstreffs der SWG tätig ist, sowie durch eine Mitarbeiterin aus der Nachbarschaftsagentur Neu Zippendorf/Mueßer Holz. Ihre Aufgabe umfasst die mieternahe Beratung, die Förderung von Nachbarschaften und das Angebot gemeinwohlorientierter Dienstleistungen. Die Wohngebietsbetreuer sollen Ansprechpartner in Mietangelegenheiten sein, aber auch als Vertrauensperson im Hinblick auf soziale und finanzielle Probleme der Bewohnerschaft beratend tätig werden. Der Nachbarschaftstreff trägt durch dieses Konzept zur Stärkung und Förderung des Zusammenlebens und der Gemeinschaft bei. Er wurde Ende Januar 2001 eröffnet.
Die Astrid-Lindgren-Schule soll saniert und zu einem kulturellen Veranstaltungszentrum erweitert werden. Aufgrund ihrer zentralen Lage für alle drei Stadtteile ist die Schule geeignet, sozial-kulturelles Zentrum des gesamten Dreeschs zu werden. Das Konzept umfasst neben der Sanierung drei Hauptelemente:
- Verlagerung der Stadtteilbibliothek vom Großen Dreesch nach Neu Zippendorf und damit Verbesserung der Erreichbarkeit für die Bewohnerschaft des gesamten Neubaugebiets. Die Schule erhält hierfür einen Anbau;
- Überdachung des Innenhofs der Schule und damit Schaffung eines multifunktionalen Veranstaltungsorts;
- Doppelnutzung der Schulräume z.B. durch die Volkshochschule und das Konservatorium.
 |
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nachbarschaftstreffs (Bildquelle: Stadt Schwerin) |
 |
Astrid-Lindgren-Schule mit geplantem Anbau und neuer Fassadengestaltung (Grafik: Stadt Schwerin) |
Wegen der Bedeutung der Maßnahme erfolgte über die Durchführung des Projekts ein Grundsatzbeschluss in den Ausschüssen und in der Stadtvertretung. Baubeginn war im Herbst 2001, die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2003 beendet sein.
Der Umbau des Berliner Platzes umfasst die Modernisierung der Straßenbahnhaltestelle, die Sanierung und Wiedererrichtung des Brunnens sowie Verbesserungen in der ästhetischen und funktionalen Gestaltung. Die ersten beiden Maßnahmen wurden 2001 realisiert. Für die neue Platzgestaltung wurde eine Bewohner-AG gegründet, die ihre Ideen, z.B. für einen behindertengerechten Umbau, zur Verbesserung der Beleuchtung und Sauberkeit, aktiv in die Planung inbringt.
5. Organisation und Management 
Organisations- und Managementformen aus der Rahmenplanung
Bereits im Zuge der Rahmenplanung wurden eigens organisatorische Strukturen auf Verwaltungsebene, intermediärer Ebene und der Umsetzungsebene im Stadtteil aufgebaut. Auf Verwaltungsebene wurde ein Lenkungskreis eingerichtet, in dem unter Leitung des Baudezernenten der Leiter und Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes und Vertreter weiterer Ämter sowie die Geschäftsführer der beiden Wohnungsunternehmen übergeordnete Themen abstimmten. Die Arbeitsgruppe »Weiterbau Neu Zippendorf« – auch sie mit Vertreterinnen und Vertretern der direkt beteiligten Ämter – stimmte unter der Leitung des Stadtplanungsamtes die Rahmenplanung mit den verschiedenen Fachämtern und Wohnungsgesellschaften ab.
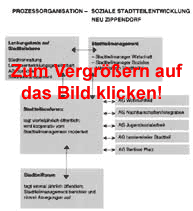 |
Prozessorganisation - Soziale Stadtteilentwicklung Neu Zippendorf |
Im Stadtplanungsamt ist seit Beginn der Erneuerung ein Mitarbeiter für die Steuerung des Weiterbaus im gesamten Dreesch zuständig. Er wird von einer Mitarbeiterin der Landesentwicklungsgesellschaft Schleswig-Holstein unterstützt, die seit 1997 als Sanierungsträger fungiert und mit der treuhänderischen Verwaltung der Fördermittel durch die Landeshauptstadt beauftragt wurde.
Zu den Planungs- und Umsetzungsschritten der Rahmenplanung, die in temporären Bewohnerarbeitsgruppen entwickelt wurden, sind vier Stadtteilforen veranstaltet worden.
Neue Organisations- und Managementformen zur Umsetzung
des Programms »Soziale Stadt«
Um dem integrativen Ansatz des neuen Förderprogramms besser entsprechen zu können, wurde die Organisationsstruktur für die Umsetzung der »Sozialen Stadt« erweitert.
Wesentliche Änderung ist die Erweiterung des oben genannten Lenkungskreises auf Verwaltungsebene um weitere relevante Ämter. Der Verwaltungs-Lenkungskreis soll die ressortübergreifende Zusammenarbeit und die Verknüpfung von Ressourcen (Finanzen und Know-how) der Verwaltung, der Wohnungsunternehmen, der Landesentwicklungsgesellschaft und des Stadtteilmanagements sicherstellen. Der für die Erneuerung im gesamten Dreesch zuständige Mitarbeiter im Stadtplanungsamt ist auch für die Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« im Modellgebiet zuständig.
Im intermediären Bereich wurde zusätzlich zu den Stadtteilforen eine Stadtteilkonferenz eingerichtet, die viermal jährlich stattfinden soll. Deren Organisation obliegt der Leiterin des Regionalbüros 3 (Amt für Jugend, Soziales und Wohnen), das unter anderem für Neu Zippendorf zuständig ist, in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanagement »Soziales«. Aufgabe der Stadtteilkonferenz ist es, Beschlussvorlagen zu Maßnahmen im Gebiet mit vorzubereiten. Aus ihrer Mitte sind Arbeitsgruppen entstanden, die regelmäßig tagen. Deren Ergebnisse werden in der Konferenz öffentlich beraten, Empfehlungen dazu ausgesprochen und auf die politische Ebene, in die Ämter, Organisationen und Initiativen vor Ort, transportiert. Daher ist es ein wichtiges Ziel, Politikerinnen und Politiker für die Arbeit in der Stadtteilkonferenz zu gewinnen.
Das Stadtteilforum bleibt als Organisationsform auch künftig erhalten und soll einmal jährlich stattfinden, um Interessierte aus der Bewohnerschaft, die sich nicht regelmäßig im Rahmen der Stadtteilkonferenz engagieren können oder möchten, über die Stadtteilentwicklung zu informieren.
Auf der lokalen Umsetzungsebene war zu Beginn des Programms »Soziale Stadt« die »Arbeitsgruppe Stadtteilmanagement« initiiert worden. Sie sollte Schlüsselpersonen aus Ämtern und Vor-Ort-Einrichtungen einbinden, die bereits während der Rahmenplanung zentrale Funktionen im Gebiet wahrgenommen hatten. Der Arbeitsgruppe gehörten an die Leiterin des Regionalbüros 3, die Stadtteilkoordinatorin Jugendhilfe, die Projektleiterin E & C des Internationalen Bundes, eine Mitarbeiterin des Stadtteilbüros, der zuständige Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes und die Programmbegleitung-vor-Ort. Die Arbeitsgruppe hatte die Aufgaben, adäquate Strukturen zur Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« zu schaffen, gemeinwesenorientierte Arbeit anzustoßen und zu befördern sowie Probleme darzustellen und in die verschiedenen Gremien einzubringen.
Die »Arbeitsgruppe Stadtteilmanagement« ging Ende 2001 im »Lenkungskreis Neu Zippendorf« (Lenkungskreis auf Stadtteilebene) auf, der auch über die Vergabe der Gelder aus dem Verfügungsfonds entscheidet. Dem Gremium gehören neben den Mitgliedern der ehemaligen »Arbeitsgruppe Stadtteilmanagement « die neu eingestellten Stadtteilmanager »Wirtschaft« und »Soziales« sowie die Leiter der im Rahmen der Stadtteilkonferenz entstandenen Arbeitsgruppen an. Getagt wird einmal im Monat, die Sitzungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtteilbüros organisiert und dokumentiert.
Seit Dezember 2001 wird die Gebietsentwicklung durch einen neu eingestellten Stadtteilmanager »Wirtschaft« und seit März 2002 durch zwei zusätzliche Stadtteilmanager »Soziales« unterstützt. Neben der Mitarbeit im Lenkungskreis auf Stadtteilebene ist es ihre Aufgabe, Projekte in den Bereichen »Lokale Ökonomie«, »Soziale Aktivitäten«, »Infrastruktur«, »Integration«, »Beteiligung und Aktivierung« sowie »Öffentlichkeitsarbeit« zu fördern und zu unterstützen. Zu ihren Sprechzeiten stehen sie für die Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteilbüro zur Verfügung.
 |
Das Stadtteilbüro am Berliner Platz (Bildquelle: Stadt Schwerin) |
Das Stadtteilbüro in Neu Zippendorf wurde 1999 eingerichtet. Es befindet sich in zentraler Lage am Berliner Platz und besteht aus einem Büro für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einem Vorraum, in dem für interessierte Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gewerbetreibende Pläne ausgestellt sind und Informationen zur Stadtteilentwicklung bereitliegen. Als Ansprechpartner stehen drei Mitarbeiterinnen zur Verfügung, zwei davon sind auch in den beiden anderen Stadtteilbüros im Großen Dreesch und im Mueßer Holz im Wechsel präsent. Zu regelmäßigen Sprechzeiten wird im Stadtteilbüro zusätzlich eine Schuldnerberatung angeboten. Ein weiterer Raum steht für Gespräche oder Gruppentreffen zur Verfügung. Hier tagt auch der Lenkungskreis auf Stadtteilebene.
6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
Die Aktivierung und Beteiligung von Bewohnerschaft und anderen stadtteilbezogenen Akteuren sowie die gebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit für Neu Zippendorf sind Aufgaben des Stadtteilmanagements. Dieses wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtteilbüros unterstützt.
Wesentliche Bedeutung für die Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner kommt dem vom Land Mecklenburg-Vorpommern Mitte 2001 bewilligten Verfügungsfonds in Höhe von jährlich 10 000 Euro zu. Er soll »dem verantwortlichen, selbstbestimmten Handeln vor Ort zur Realisierung kurzfristig umsetzbarer kleinerer Projekte« dienen. Mittel dieses Fonds können zur flexiblen Förderung von nachbarschaftlichen Aktivitäten, von Veranstaltungen zur Belebung des Stadtteillebens, zur Unterstützung finanziell Bedürftiger mit dem Ziel der Teilnahme am sozialen Leben, zur Qualifizierung im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten, zur Erstellung von Informationsmaterial usw. eingesetzt werden. Über die Mittelvergabe entscheidet der Lenkungskreis auf Stadtteilebene, die Stadtteilkonferenz erhält regelmäßig Kenntnis. Voraussetzung für die Förderung ist das Einbringen eines mindestens zehnprozentigen Eigenanteils, der auch in Form von Sachmitteln und/oder Eigenarbeit erbracht werden kann. Die Höhe der Förderung soll pro Antrag 1 250 Euro nicht überschreiten.
 |
Die Starterkonferenz zum Programmauftakt »Soziale Stadt« weckte großes Interesse. (Bildquelle: Wolf-Christian Strauss, Berlin) |
 |
Eröffnung des Nachbarschaftstreffs »Nebenan« (rechts im Bild: Oberbürgermeister Johannes Kwaschik) (Bildquelle: Stadt Schwerin) |
Schon in der Vorbereitungsphase und der Rahmenplanung selbst wurden Elemente einer dialogorientierten und aktivierenden Bürgerbeteiligung eingerichtet und umgesetzt. Hierzu zählen auf der Quartiersebene das Stadtteilbüro, die Bewohnerarbeitsgruppen und die öffentlichen Stadtteilforen. Diese Beteiligungsformen werden im Rahmen der Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« weitergeführt und auf der intermediären Ebene um die Stadtteilkonferenz und neue, themenbezogene Arbeitsgruppen ergänzt. Im Gegensatz zu den Stadtteilforen, die ein Informationsgremium sind, werden in der Stadtteilkonferenz die von den Arbeitsgruppen konzipierten Maßnahmenvorschläge in einem größeren Bewohnerkreis diskutiert und hierzu Empfehlungen ausgesprochen. Es haben sich bisher Arbeitsgruppen zu den Themen »Stabilisierung von Nachbarschaften, Integration der Zuwanderer«, »Aufwertung des Stadtteilzentrums Berliner Platz«, »Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Verbesserung der Freizeit- und Kulturangebote« und »Aufwertung des Wohnumfeldes, Erhöhung der Sauberkeit und Sicherheit« gebildet. Diese Arbeitsgruppen ermöglichen eine direkte Beteiligung der Bewohnerschaft.
Zu einzelnen Themen werden zusätzlich öffentliche Foren veranstaltet, zu denen breit eingeladen wird und die auch über die Presse bekannt gemacht werden. 2001 waren dies ein Wohnforum und ein Workshop über »Soziale und räumliche Probleme in Großwohnsiedlungen«. Hier hat die Bevölkerung die Möglichkeit, mit der Verwaltung Probleme im Gebiet zu diskutieren und Lösungen anzuregen. Weitere Beteiligungsformen für unterschiedliche Zielgruppen sind im Rahmen der intensivierten Öffentlichkeitsarbeit geplant.
Dem Stadtteilbüro kommt bei der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit durch das Stadtteilmanagement eine tragende Rolle zu. Dort hängen Pläne aus, werden Modelle ausgestellt und Interessierten die Möglichkeit geboten, sich laufend über den Planungsstand, Termine und durchgeführte Projekte zu informieren. Das Stadtteilbüro hat für seine Arbeit ein gebietsbezogenes Logo entwickelt. Vorgesehen sind auch eine Stadtteilzeitung sowie eine Broschüre über Angebote im Stadtteil für Alt und Jung – Letztere auch zur Veröffentlichung im Internet.
7. Fazit: Auf den Weg gebracht 
Der Schwerpunkt der Handlungsfelder und Projekte im Rahmen der Stadtteilentwicklung Neu Zippendorfs hat sich seit Beginn der Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« verändert: weg von (städte-)baulich dominierten Maßnahmen, hin zu sozial- und gemeinwesenorientierten Projekten, die das Zusammenleben der Bewohnergruppen fördern. Dazu beigetragen haben der kombinierte Einsatz von Mitteln aus dem Programm »Soziale Stadt« und solchen aus anderen Ressorts, ebenso die Einrichtung eines Verfügungsfonds. Ein integriertes Handlungskonzept für das Gebiet, das auch die gesamtstädtische Entwicklung mit einbezieht, ist bisher allerdings nicht erarbeitet worden.
Die Handlungsfelder »Beschäftigung«, »Qualifizierung« und »Ausbildung« sowie »Wirtschaftsentwicklung« sind zwar schon im Rahmenplan analysiert und die Stärkung der Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen im Gebiet als ein Ziel herausgearbeitet worden. Ein Konzept zur lokalen Ökonomie wird aber erst von dem Stadtteilmanager »Wirtschaft« in Zusammenarbeit mit vielen lokalen Akteuren erstellt; dabei erweist es sich im Einzelfall als durchaus mühsam, Gewerbetreibende aus dem Gebiet, potenzielle Existenzgründer, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und das Arbeitsamt zu beteiligen.
Unterstützend für die Stadtteilentwicklung in Neu Zippendorf wirkt sich die Einrichtung der Stadtteilkonferenz und der ihr angegliederten Arbeitsgruppen aus, auch wenn sich die Vertreterinnen und Vertreter der Politik dort bisher noch nicht engagieren. Die ämterübergreifende Beteiligung der Verwaltung an der Stadtteilkonferenz ist formal nicht geregelt, allerdings sind verschiedene Ämter über die themenbezogene Mitarbeit in den Arbeitsgruppen in die Stadtteilkonferenz eingebunden.
Mit dem Stadtteilbüro wurde frühzeitig eine wichtige Anlaufstelle für die Bewohnerschaft vor Ort geschaffen. Durch die Einbindung von freien Trägern und des Regionalbüros in den Lenkungskreis auf Stadtteilebene ist ein dauerhaftes Kooperationsgremium geschaffen worden. Die drei zeitlich befristeten Stadtteilmanager unterstützen den Stadtteilentwicklungsprozess zusätzlich durch verstärkte gebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit, Bewohneraktivierung und -beteiligung sowie Projektentwicklung in den Bereichen »Lokale Ökonomie« und »Soziale Aktivitäten/Zusammenleben im Stadtteil«.
Die Beteiligung der Bewohnerschaft gelang vor allem bei der Planung und Umsetzung konkreter Projekte. Bisher nicht oder nur in Ansätzen angesprochen und erreicht wurden nicht deutsch sprechende Bevölkerungsgruppen. Hier haben die beiden Stadtteilmanager »Soziales« ein wichtiges Betätigungsfeld: durch aufsuchende Arbeit und Aktivierungsstrategien die Beteiligung der Bewohnerschaft zu verstärken und deren Engagement zu fördern. Gleichzeitig haben sie die Aufgabe, die vielen Aktivitäten der freien Träger im Gebiet abzustimmen und zu vernetzen. Gemeinwesenarbeit muss mehr im Vordergrund stehen.
Die Öffentlichkeitsarbeit wird künftig zu intensivieren sein, da viele Bewohnerinnen und Bewohner Veränderungen im Gebiet nicht oder nur bruchstückhaft wahrnehmen. Verstärkte gebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit ist schon deshalb notwendig, um breiter über die Planungs- und Umsetzungsschritte zu informieren und damit das Gebietsimage aufzuwerten. Hier ist der Einsatz der Stadtteilmanager gefragt, sie werden zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Öffentlichkeitskonzept erarbeiten, um deren Informationsbedürfnissen Rechnung zu tragen und sie zur Mitarbeit zu motivieren.
Mit dem neuen Bundesförderprogramm »Stadtumbau« ergibt sich im Modellgebiet die Möglichkeit, durch Rückbau und Abriss den Leerstand zu reduzieren. Dazu wird bis Ende Juli 2002 von der Stadt in Zusammenarbeit mit den Wohnungsunternehmen ein gesamtstädtisches Stadtumbauprogramm erstellt, in dem die Entwicklung Neu Zippendorfs eine wichtige Rolle spielen wird.
Ab 2002 ist das Fördergebiet Neu Zippendorf um den Stadtteil Mueßer Holz erweitert worden, die Stadtteilmanager »Soziales« sind nun für beide Stadtteile zuständig. Dies kommt sicher der Koordination und Vernetzung der Aktivitäten in beiden Stadtteilen zugute.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005