soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Flensburg Neustadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matthias Frinken Das Modellgebiet »Soziale Stadterneuerung Flensburg-Neustadt« wurde 1999 in zwei Städtebauförderprogramme aufgenommen, das »klassische« Bund-Länder-Programm der Stadtsanierung und das neue Programm »Soziale Stadt«. Es umfasst das etwa 51 Hektar große, zu Beginn des Jahres 2000 förmlich festgelegte Sanierungsgebiet »Neustadt« und das etwa doppelt so groß angelegte Rahmenplangebiet, das ringförmig darum gelegen ist. Nur im Sanierungsgebiet wird das gesamte Spektrum der klassischen investiven Maßnahmebereiche wie Modernisierung und Instandsetzung, Straßenbau- und Ordnungsmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmenplangebiet werden lediglich Maßnahmen gefördert, die dem integrierten Ansatz der Programmatik »Soziale Stadt« entsprechen und bei denen eine enge Verflechtung mit den Lebenszusammenhängen im Sanierungsgebiet besteht (Gemeinbedarfseinrichtungen, Wegebeziehungen, Wohnumfeldverbesserung). 1. Gebietscharakter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
| (Bildquelle: Stadt Flensburg) |
Im Zentrum des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets liegt eine etwa sechs Hektar große Gewerbebrache: das zusammenhängende Gelände eines seit den 70er-Jahren nicht mehr genutzten ehemaligen Holzhandels und des 1993 abgerissenen Schlachthofes. Mehr als zehn Prozent der teilweise sehr stark modernisierungsbedürftigen Wohnungen stehen im Sanierungsgebiet leer. Das Rahmenplangebiet schließt auch industriell genutzte Flächen am Fördeufer mit ein, deren Zukunft zurzeit gesichert erscheint, sowie weitere gewerblich genutzte Flächen im Osten und überwiegend durch Wohnen und Gemeinbedarf gekennzeichnete Flächen im Westen.
 |
(Bildquelle: plankontor GmbH, Hamburg) |
Insgesamt leben im Sanierungsgebiet etwa 4 500 Einwohner, davon sind überdurchschnittlich hohe Anteile benachteiligten Bevölkerungsgruppen zuzuordnen. Die Quote der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, Migrantinnen und Migranten, allein Erziehenden oder auch jungen Menschen ohne Hauptschulabschluss ist jeweils zwei- bis dreimal so hoch wie in der Gesamtstadt.
2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale 
Die Neustadt weist eine enorm hohe Komplexität von sich überlagernden sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemkonstellationen auf, die in ihren Ursachen auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse und den ökonomischen Strukturwandel in der Region zurückzuführen sind. Gesamtstädtische und kleinräumige, lokale Probleme betreffen die Neustadt dabei gleichermaßen. Ein über Jahre entwickeltes Negativ-Image des Stadtteils sowie damit verbundene anhaltende soziale Segregation und fehlende Investitionsbereitschaft von privater Seite sind die Folge. Als zentrale Problemfelder sind neben dem Negativ-Image des Stadtteils zu nennen:
Baulich/städtebauliche Probleme: Großgemengelage mit gegenseitigen Nutzungsbeeinträchtigungen, (Gewerbe-)Brachflächen, hohe Anzahl untergenutzter Grundstücke und Gebäude, hohe Quote an Wohnungsleerstand, hohe Bebauungsdichte und hoher Versiegelungsgrad, hoher Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf, mangelhaftes Wohnumfeld, hohe Umweltbelastung durch emittierendes Gewerbe und Straßenverkehr auf Ausfallstraßen, unzureichendes Geh- und Fahrradwegenetz, mangelndes öffentliches Grün- und Freiflächenangebot sowie fehlende Spielplätze.
 |
An der Harrisleer Straße konzentrieren sich Leerstände; sie soll im Rahmen der Sanierung neu gestaltet werden. (Bildquelle: Stefanie Hagen, Stadt Flensburg) |
 |
Die Brachflächen des ehemaligen Schlachthofes ermöglichen Grünverbindungen, Spiel- und Sportflächen und neue gewerbliche Entwicklungen. (Bildquelle: plankontor GmbH, Hamburg) |
Soziale Probleme: einseitige Sozialstruktur, Segregation zum Nachteil der Neustadt, unterdurchschnittliches Haushaltseinkommen, überdurchschnittliche Abhängigkeit von Transferleistungen, niedriges Ausbildungs- und Qualifikationsniveau, soziale Spannungen, fehlende Jugendräume und Möglichkeiten der nicht kommerziellen Begegnung, unzureichende Ausstattung mit Gemeinbedarfsund Beratungsangeboten sowie mangelnde Gesundheitsversorgung und unzureichendes Vorsorgeverhalten.
Gleichwohl bietet die Neustadt aber auch vielfältige Entwicklungspotenziale für eine Umkehr der Negativentwicklung. So müssen die derzeitige kleinteilige urbane Nutzungsstruktur und die vielfältige multikulturelle Bevölkerungsmischung als Chance und als Ausgangspunkt für die Herausbildung eines ganz besonderen Charakters dieses Stadtteils angesehen werden. Ein weiteres wesentliches Potenzial stellt die Nähe zur Förde mit der naturräumlichen Situation der Hanglage zum Wasser hin dar. Brachflächen und Gebäudeleerstände bieten zahlreiche räumliche und funktionale Gestaltungs- und Umnutzungsmöglichkeiten. Damit können gleichzeitig Defizite, z.B. im öffentlichen Freiflächenbereich, beseitigt und Angebote zur Bewältigung des ökonomischen Strukturwandels geschaffen werden. Ferner ist die Herausbildung eines Stadtteilzentrums als Ort für Begegnung, Kultur und Versorgung möglich. Modernisierungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes können zur Steigerung der Lebensqualität und des individuellen Wohlbefindens im Gebiet beitragen.
Demographische und sozialrÄumliche Merkmale
|
Neustadt (1) |
Flensburg |
|
|
Größe |
51 ha (Sanierungsgebiet) |
5 644 ha |
|
Einwohnerzahl (1998) |
4 532 |
85 547 |
|
Bevölkerungsverlust(1994–1999) |
13,8% |
4,4% |
|
Durchschnittliche Haushaltsgröße (1998) |
nicht verfügbar |
nicht verfügbar |
|
Anzahl der Wohnungen |
2 490 (1998) |
43 296 (1987) |
|
Leerstand (1998) |
265 WE |
nicht verfügbar |
|
Anteil der Wohngeldempfänger (1998) |
7,0% |
3,9% |
|
Arbeitslosenquote (1998) |
30,0% |
16,4% |
|
Anteil der Sozialhilfeempfänger (1998) |
22,0% |
9,0% |
|
Anteil ausländische Bevölkerung (1998) |
24,1% |
8,6% |
|
Anteil der bis 18-Jährigen (1998) |
20,7% |
17,9% |
|
Anteil der 60-Jährigen und älter (1998) |
14,0% |
13,2% |
|
(1) Die Daten zur Neustadt basieren auf den 1999 durchgeführten Vorbereitenden Untersuchungen und beziehen sich daher weitgehend nur auf das Sanierungsgebiet. Neuere, kleinräumige Daten für das gesamte Modellgebiet sind zur Zeit noch nicht vorhanden. |
||
Gleichzeitig bietet die Neustadt Räume und Chancen, neue Bevölkerungsgruppen aufzunehmen und zu integrieren, die im Stadtteil arbeiten oder leben möchten und den Entwicklungsprozess mit beeinflussen. Diese besondere Neustädter Mischung kann zu einem positiven Stadtteil-Image führen.
3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte 
Die Entwicklungsziele für die Neustadt sind in den Vorbereitenden Untersuchungen, in der Rahmenplanung sowie im Integrierten Handlungskonzept festgelegt. Sie orientieren sich an den Qualitäten und Potenzialen des Gebietes und zielen auf die Herausbildung eines neuen positiven Images für die Neustadt.
Das Integrierte Handlungskonzept wurde im Verlaufe des Jahres 2001 unter Beteiligung der AG Neustadt und des Stadtteilmanagements sowie von Arbeitskreisen im Gebiet erarbeitet. In einem Sanierungstreff im Gebiet soll es im Frühjahr 2002 abschließend diskutiert und danach von der Ratsversammlung beschlossen werden. Es umfasst folgende Handlungsschwerpunkte, die gleichzeitig auch die wesentlichen Entwicklungsziele benennen:
- Einrichtung eines Stadtteilmanagements und -büros, Vernetzung von sozialen Aktivitäten und Gruppen im Gebiet, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit,
- Verbesserung der Wohn- und Beschäftigungssituation im Gebiet,
- Stabilisierung und Verbesserung der Lebensqualität,
- Verbesserung der Verkehrssituation, der öffentlichen Straßenräume, des Stellplatzangebotes,
- Integration von Schulen und Kulturarbeit in den Prozess der sozialen Stadtteilentwicklung,
- Verbesserung der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen im Gebiet sowie der Gesundheitslage der Bevölkerung
- Förderung der kulturellen Vielfalt in der Neustadt,
- Stärkung des Miteinanders von Migranten und deutscher Bevölkerung,
- Durchführung von Modernisierungen, Wohnumfeldverbesserungen und zielgruppenorientiertem ergänzendem Wohnungsneubau,
- Stärkung der lokalen Wirtschaft, Sicherung von Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung, Einzelhandel und Versorgung,
- Verbesserung der Angebote für Aus- und Weiterbildung,
- Verbesserung des öffentlichen Grün- und Freiraumangebotes, Herstellung eines Zugangs zur Förde, Verbesserung der stadtteilinternen Wegebeziehungen sowie der stadtteilnahen Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten,
- Verbesserung der ökologischen Situation, Entsiegelung von Flächen, Altlastenbeseitigung,
- Aufwertung der städtebaulichen Strukturen und der Stadtgestalt.
Neben den klassischen investiven Sanierungsmaßnahmen besteht ein Handlungsschwerpunkt in Bereichen, die eines längeren und interdisziplinären Entwicklungsprozesses bedürfen, bis Projekte oder Erfolge sichtbar werden. Dies betrifft vorrangig die Stärkung der örtlichen Wirtschaft und die Verbesserung der sozialen Lagen im Gebiet. So werden interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten häufig ohne große Investitionen ebenso selbstverständlich beraten und vorbereitet wie gewerbliche Großprojekte, die Neugestaltung öffentlicher Räume, Altlastensanierungen oder Betriebsverlagerungen. Einige Projekte, z.B. die Umnutzung der ehemaligen Walzenmühle oder die Wiedernutzung des ehemaligen Schlachthofgeländes, haben eine eher gesamtstädtische Dimension, andere, wie z.B. die Herausbildung eines Stadtteilzentrums, zielen auf lokale Bedürfnisse.
In einem gemeinsamen Workshop mit Stadtverwaltung, externen Planern, Bürgerinnen und Bürgern der Neustadt sowie Kommunalpolitikern im September 1999 ist man übereingekommen, dass bei jeder Erneuerungsmaßnahme im Stadtteil auch anstehenden Großinvestitionen für die Lebensqualität in der Neustadt »etwas hängen bleiben muss«! Diese Grundhaltung spiegelt sich in dem gut zwei Jahre später fertiggestellten integrierten Handlungskonzept mit mehr als 120 Projekten wider.
4. Schlüsselprojekte 
Zweifellos wird eines der wichtigsten Projekte, das voraussichtlich den gesamten Sanierungszeitraum begleiten wird, die Heranführung des Stadtteils an die Förde sein. Hierfür ist zunächst die Schaffung eines öffentlichen Platzes direkt am Ufer vorgesehen. An der Stelle ist jedoch zuvor ein fleischverarbeitender Betrieb zu verlagern und Grunderwerb zu tätigen. Über das ehemalige Schlachthof-Gelände soll dieser Platz durch eine neu anzulegende Grünverbindung mit der Neustadt verbunden werden. Verhandlungen darüber sind fast abgeschlossen. Skizzen liegen vor, aber es wird noch ein bis zwei Jahre dauern, bis erste Entwicklungen sichtbar sind.
Dagegen ist ein anderes umfangreiches und impulsgebendes Projekt sehr weit fortgeschritten: die Umnutzung der ehemaligen Walzenmühle, die seit Ende der 90er-Jahre leer steht. Sie soll in ein kultur- und medienwirtschaftliches Dienstleistungszentrum umgestaltet werden. Auf etwa 7 000 qm Nutzfläche sind außerdem quartiersbezogene Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und loftartige Wohnungsangebote in den Obergeschossen vorgesehen. Als privates Projekt mit kommunaler Trägerschaft ist die Walzenmühle auch unter Management- und Bündelungsaspekten interessant: Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro werden voraussichtlich 2,9 Millionen Euro aus der Regional- und 1,3 Millionen Euro aus der Städtebauförderung finanziert. Es entsteht ein Projekt, das die Neustädter Mischung innovativ ergänzt, indem das Kulturdenkmal des Mühlen-Ensembles erhalten bleibt und etwa 200 neue Arbeitsplätze entstehen.
 |
Der Umbau der Straße Neustadt markiert die neuen Perspektiven des Stadtteilzentrums. (Bildquelle: Stefanie Hagen, Stadt Flensburg) |
Zur Sicherung einer stadtteilbezogenen Nahversorgung, des Wohnens und soziokultureller Angebote (z.B. Volkshochschule, Treffpunkte für Vereine) wird das kleinmaßstäbliche gründerzeitliche Stadtteilzentrum als »Herz« des gesamten Erneuerungsgebietes in Verbindung mit Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sowie der Gestaltung eines Stadtteilplatzes aufgewertet und entwickelt. Dazu zählen auch die Verbesserung der Erreichbarkeit durch zusätzliche Fuß- und Radwegeverbindungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Leerständen und zielgruppenorientierte Beratungsangebote. Die Neugestaltung des öffentlichen Straßenraumes befindet sich seit Ende 2001 in der Durchführung.
Ein städtisches denkmalgeschütztes Gebäude, das früher als Sprachheilgrundschule genutzt wurde, wird zu einem Jugendprojekthaus für die langfristige Unterbringung von Gruppen in der Flensburger Neustadt umgebaut, die im sozialen Umfeld mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Seit Anfang 2001 waren die Teilnehmer des Programms »Freiwilliges Soziales Trainingsjahr« (FSTJ) im Gebäude untergebracht. Neben Betriebspraktika, gemeinnützigen kleinen Aktionen im Stadtteil und eigenen Lern- und Qualifizierungsabschnitten haben die mittlerweile etwa 25 Jugendlichen an vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung des Gebäudes mitgewirkt.
Im Laufe des Jahres wurden jedoch so umfangreiche konstruktive und bauliche Schäden am Gebäude festgestellt, dass das FSTJ im Herbst in ein nahe gelegenes Zwischenquartier umgesiedelt ist. Das Gebäude, dessen Umnutzung sehr stark vom Stadtteilmanagement mit unterstützt wird, ist aber längst zu einem Identifikationsmerkmal des gesamten sozialen Erneuerungsprozesses in der Neustadt geworden.
 |
Die zur Zeit leer stehende Walzenmühle soll als kulturwirtschaftliches Zentrum genutzt werden. (Bildquelle: plankontor GmbH, Hamburg) |
Der Lokale Aktionsplan, der dank des Programms »Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie« seit Herbst 2001 für die Neustadt entwickelt wird, bietet die Chance, Jugendliche und junge Erwachsene in die Gestaltung und Entwicklung ihres Stadtteils einzubeziehen. Der Plan ist gleichzeitig ein Vernetzungsprogramm, denn er erfordert eine enge Abstimmung der vorhandenen und geplanten Aktivitäten zwischen Akteuren und Ämtern. Für die Zusammenarbeit wurde ein Netzwerkbüro vom Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit eingerichtet. Projekte, die von im Stadtteil agierenden Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen bisher geplant wurden, aber aufgrund knapper Ressourcen nicht weiter vorangetrieben wurden, werden über das Budget des lokalen Aktionsplanes unterstützt, neue Projekte auf den Weg gebracht und Impulse gegeben. Es werden insbesondere Projekte und Aktionen unterstützt, die die Belange von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Vordergrund stellen:
- Ziel des Projekts »Musikszene Neustadt« ist die Vernetzung einer Jazz-Band und einer Stadtteilband zur Förderung der Musikszene in der Neustadt. Jugendlichen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, die an Musik interessiert sind, steht eine komplette Musikerausstattung zur Verfügung, und sie haben über Musik die Chance, sich kennen- und verstehen zu lernen.
- »Neustadt: Mein Stadtteil« ist ein Fotoprojekt der Volkshochschule, das unter anderem Jugendliche dazu animiert, sich mit ihrem Stadtteil, den dort lebenden Menschen und der Geschichte des Stadtteils zu beschäftigen. Das Projekt eröffnet andere (liebevolle) Blicke auf die Neustadt und soll zu einer Stadtteilgalerie oder Kulturwerkstatt für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt werden.
- Der »Offene Sport« mit dem Schwerpunkt Skating im Rahmen des lokalen Aktionsplanes ergänzt die vereinsgebundenen Sportangebote in der Neustadt und soll Jugendlichen, die nicht an Vereinsaktivitäten teilnehmen können (oder wollen), Chancen bieten, sich auszutoben, sich sportlich zu messen und sich sportlich miteinander zu beschäftigen.
- Ein bereits bestehender »Interkultureller Bazar« entspricht der Intention des Lokalen Aktionsplanes, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ethnien zusammenzubringen. Der Bazar soll weiterhin jährlich stattfinden und nun insbesondere Jugendliche als Mitarbeiter, Unterhalter und Besucher einbeziehen.
- Die »Raumbörse« soll alle Interessenten und potenziellen Anbieter von Räumen unter anderem für die Projekte des lokalen Aktionsplanes in der Neustadt vernetzen. Es handelt sich um einen zentralen Projektbaustein, da die Umsetzung vieler Projekte vom Raumangebot im Sinne von Ausstellungs-, Probeoder Versammlungsräumen abhängt.
Das von der Kindergarten Adelby GmbH getragene Projekt »Schutzengel e.V.« ist ein partizipatives Projekt zur Unterstützung von Eltern und Kindern durch Frühförderungsmaßnahmen. Die Arbeit des Fördervereins Schutzengel beruht auf einer Vernetzung von Institutionen und Personen im Stadtteil und wird als Pilotprojekt vom Land Schleswig-Holstein, Jugendministerium, für zwei Jahre gefördert. Der »Schutzengel e.V.« hat sich zum Ziel gesetzt, durch rechtzeitige Hilfestellung Schäden und Behinderungen bei Kindern zu verhindern. Dies wird durch verschiedene Bausteine erreicht:
- Eine Familienhebamme, die an das Diakoniekrankenhaus angebunden ist, unterstützt junge Familien in der Neustadt in der Schwangerschaft sowie nach der Geburt, und zwar weit über die üblichen, durch die Krankenkassen finanzierten Hilfen hinaus. Die Hebamme übernimmt auch die präventive Frühbetreuung.
- Eine Diakonische Hausbetreuerin unterstützt junge Familien in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Petri bei der Bewältigung ihres Alltags.
- In einem Elterntreffpunkt, der vom Flensburger ArbeiterBauverein umgebaut und zur Verfügung gestellt wird, haben Eltern Gelegenheit, über ihre großen und kleinen Sorgen miteinander zu sprechen, Tipps zur Bewältigung des Alltags, zu Gesundheits- und Erziehungsproblemen zu geben und zu erhalten oder einfach miteinander zu reden.
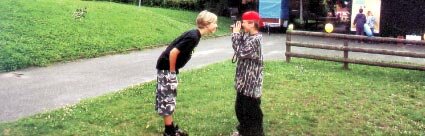 |
»Spielraumforscher« unterwegs in der Neustadt (Bildquelle: Sylvia Schröder, Stadtteilmanagement Flensburg-Neustadt) |
Im Projekt »Spielraumanalyse« waren Kinder und Jugendliche als »Spielraumforscher«, in der Neustadt unterwegs und haben mit Hilfe der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Flensburg ihr Wohngebiet untersucht und Möglichkeiten entdeckt, wo und wie sie sich im öffentlichen Raum aufhalten und spielen können. Vereine, Institutionen und interessierte Gruppen wurden von den Spielraumforschern in den Prozess mit einbezogen. Hieraus ergaben sich Aktionsvorschläge für Spielnischen, Spielecken, Spielplätze, Spielstraßen und Spielwege, einen Spielparkplatz, der zeitweise als Spiel- und Bewegungsfläche genutzt werden könnte, einen Pausenhofspielplatz, Spiellücken Baulücken und andere brachliegende Flächen –, die vorübergehend für Freizeitaktivitäten genutzt werden könnten und nicht verplantes, natürliches Spielgelände, Spielwiesen, Spielwald, Spielwasser und Spielstrand sowie Sporträume und spezielle Jugendräume. Die Aktionsvorschläge werden jeweils individuell geprüft und mit dem integrierten Handlungskonzept abgestimmt. Ein erstes Projekt ist am 26.11.2001 eingeweiht worden: Der Spielplatz Michelsenstraße, der lange verwaist war, wurde von Kindern und Jugendlichen unter Moderation einer Planerin in einem Workshop umgeplant. 18 Kinder im Alter von sieben und zwölf Jahren, die in der Umgebung des Spielplatzes wohnen, konnten ihre Vorstellungen für diesen Spielplatz verwirklichen. Während der intensiven Arbeitsphase im Workshop haben die Kinder nicht nur ihre eigenen Ideen einbringen können, sie haben auch gesehen, dass es Spaß macht, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Sie haben sich im Workshop als sozial kompetent erwiesen und (vielleicht?) neue Freunde gefunden.
5. Organisation und Management 
Seit Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen im Jahr 1998 wird der Sanierungsprozess in der Neustadt verwaltungsintern durch die ressortübergreifende AG Neustadt begleitet, die monatlich tagt. In der AG werden inhaltliche Anforderungen an die soziale Stadterneuerung, die städtebauliche Rahmenplanung und andere Fachbeiträge (z.B. Spielraumanalyse) sowie alle relevanten Einzelprojekte diskutiert. Regelmäßig wird aus der Arbeit des Stadtteilbüros berichtet.
In der zweiten Jahreshälfte 2001 wurde nach ersten Erfahrungen mit dem Programm Soziale Stadt und nicht zuletzt auch nach intensiver Diskussion über den von der Programmbegleitung-vor-Ort vorgelegten Zwischenbericht festgelegt, dass in Zukunft die beiden Verwaltungsfachbereiche »Umwelt und Planen« und »Jugend, Soziales, Gesundheit« gemeinsam und gleichberechtigt die Federführung für das Modellprojekt »Soziale Stadt/Flensburg-Neustadt« haben, vertreten durch die Leitung der Fachabteilung Sanierung und eine Stabsstelle zur Koordination von Sozialplanung. Die gemeinsame Federführung beinhaltet auch die Leitung der AG Neustadt, die Finanzplanung für das Modellgebiet einschließlich der Bemühungen um Ressourcen- und Programmbündelung sowie die Außenvertretung des Gesamtprojektes und die Aufgabenkoordination des Stadtteilmanagements.
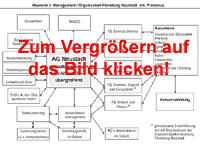 |
AG Neustadt (Grafik: plankontor GmbH, Hamburg) |
Neben der Leitung nehmen an der AG Neustadt kontinuierlich mehrere Fachvertreter aus dem Fachbereich »Umwelt und Planen«, ein Vertreter des Bereichs Gesundheit aus dem Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit, das Stadtteilmanagement, ein Vertreter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIREG) sowie jeweils ein Vertreter der übrigen beteiligten Fachbereiche teil. Je nach Einzelfall kommen weitere Fachvertreter oder auch Akteure aus der Neustadt hinzu.
 |
Umplanung des Spielplatzes Michelsenstraße in einem Workshop mit Kindern und Jugendlichen (Bildquelle: Sylvia Schröder, Stadtteilmanagement) |
Für die Steuerung von Einzelprojekten gilt, dass Einzelprojekte in fachbereichseigener Verantwortung und unter Hinzuziehung der jeweils notwendigen Kooperationspartner aus der übrigen Verwaltung vorangetrieben werden, diese jedoch in der AG Neustadt sowie im Sanierungstreff diskutiert werden. Einen besonderen Stellenwert haben diejenigen Projekte, in denen eine bauliche Sanierung und soziale Initiativen zusammengeführt werden, z.B. das Jugendprojekthaus. Hier sind Projektverantwortliche und Stadtteilmanagement gefordert, Bauplanung, Beteiligung und soziale Interessen auf einem neuen Qualitätsniveau derart in Einklang zu bringen, dass die erwünschten positiven Effekte auf den gesamten Erneuerungsprozess der Neustadt auch tatsächlich erreicht werden.
Das Stadtteilmanagement mit seinem Stadtteilbüro bildet die Schnittstelle zwischen Bevölkerung, Eigentümerinnen und Eigentümern, Gewerbetreibenden, sozialen Akteuren und Vereinen sowie der Verwaltung.
Die von der Stadt beauftragten Stadtteilmanagerinnen sehen ihre Aufgabe darin, die Bevölkerung über die soziale Stadtteilentwicklung zu informieren, Meinungen, Ideen und Wünsche aufzunehmen und unter anderem in die AG Neustadt weiterzuleiten, Initiativen zur Weiterentwicklung des Stadtteils aufzugreifen und geplante Projekte in Abstimmung mit den Beteiligten durch Vermittlung von Know-how, Kontakten, Ressourcen und Fördermitteln bis zur Realisierung zu begleiten.
6. |
Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit
|
Die Aktivierung und Beteiligung der Quartiersbevölkerung und Stadtteilakteure wird im Wesentlichen von den im Gebiet tätigen und/oder ansässigen sozialen Akteuren, durch die Fachbereiche Umwelt und Planen sowie Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt Flensburg sowie das Stadtteilmanagement initiiert und getragen. Aktivierung und Beteiligung finden auf der informellen wie auch auf der eher formellen Ebene statt.
Auf der informellen Ebene sind seit Beginn der Umsetzung des Programms Soziale Stadt Vertrauen gewonnen und Kontakte geknüpft worden, die dazu führen, dass sich Menschen im Rahmen der Sozialen Stadt engagieren. So hat die Teilnahme des Stadtteilmanagements am Neujahrsempfang einer Moschee im Gebiet dazu geführt, dass sich ein interreligiöser Arbeitskreis sowie ein Gesprächskreis muslimischer und evangelischer Frauen mit Alltagsfragen des Zusammenlebens und religiösen Fragen beschäftigten. Stadtteilfeste, Spiel- und Spaßtage und andere Aktionen haben dazu beigetragen, dass insbesondere sozial benachteiligte Menschen eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erhalten und sich zwanglos über die Soziale Stadt informieren können.
Das zentral gelegene Stadtteilbüro ist im Rahmen der sozialen Stadtteilentwicklung zu einer rege genutzten Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger geworden. Hier wird über aktuelle Vorhaben und Entwicklungen in der Neustadt informiert, und es finden informelle Gespräche genauso statt wie Einzelfallberatungen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen zum Quartier einbringen, hier werden Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Gruppen, Vereinen und Initiativen hergestellt, und es wird über soziale und kulturelle Angebote informiert.
Neben dieser eher informellen Aktivierung und Beteiligung hat das im Stadtteilbüro ansässige Stadtteilmanagement eine Reihe von stadtteilweiten, thematisch orientierten Arbeitskreisen ins Leben gerufen: AK Soziales, islamisch-evangelischer Gesprächskreis, türkisch-deutscher Frauenkreis, AK Wohnen und Wohnumfeld, AK Gewerbe. Diese Arbeitskreise sind über das Stadtteilmanagement mit der verwaltungsinternen AG Neustadt verknüpft. Über die AG Neustadt gelangen die Interessen, Vorstellungen und Projektideen der Arbeitskreise im Stadtteil zum Sanierungstreff, zum stadtweiten Sanierungsbeirat sowie zu den politischen Ausschüssen.
Neben den vom Stadtteilmanagement angeregten Arbeitskreisen haben sich bereits vor Beginn der Umsetzung des Programms Soziale Stadt die im Gebiet ansässigen Einrichtungen aufgrund drängender sozialer und ökonomischer Fragestellungen und Probleme zum Arbeitskreis Flensburg-Nord (AKFN) zusammengeschlossen. Auch hier wird über Projekte diskutiert, die dem sozialen Leben und der Beteiligung in der Neustadt zum Aufschwung verhelfen.
 |
Das zentral gelegene Stadtteilbüro: Anlaufstelle für die Stadtteilbevölkerung (Bildquelle: plankontor GmbH, Hamburg) |
Ebenfalls vor Beginn der sozialen Stadterneuerung hatte sich eine Interessengemeinschaft von Geschäftsleuten aus der Straße Neustadt zur IG Neustadt zusammengeschlossen. Sie setzt sich intensiv für eine Verbesserung der Geschäfts- und Arbeitslage in der Neustadt ein.
Alle drei Monate findet der so genannte Sanierungstreff statt. Er wendet sich an die gesamte Bevölkerung der Neustadt. Den Vorsitz führt ein Ratsmitglied, das in der Neustadt wohnt. Es wird dreisprachig (türkisch, griechisch und deutsch) eingeladen. Der Sanierungstreff hat einen informativen Charakter. Es werden keine Beschlüsse gefasst, jedoch ein Meinungsbild erstellt, das über die verwaltungsinterne AG Neustadt an die politischen Ausschüsse weitergeleitet wird. Die relativ hohen Besucherzahlen (teilweise bis 150 Menschen) deuten auf Interesse und Hoffnung auf eine positive Entwicklung des Gebietes hin.
Aktivierende und beteiligende Funktion hat auch der Verfügungsfonds, der zunächst in Höhe von jährlich 15 000 DM für das Modellgebiet eingerichtet wurde. Über den Einsatz der Mittel entscheiden die drei für die Neustadt in den stadtweit tätigen Sanierungsbeirat entsandten Betroffenenvertreter (IG Neustadt, Arbeitskreis Flensburg-Nord, Mieterforum).
Begleitet wird die Aktivierung und Beteiligung durch Öffentlichkeitsarbeit wie Pressemitteilungen, Flyer, Rundbriefe, Plakate und die Neustadt-News, ein Magazin von und für Jugendliche im Stadtteil. Mitte 2002 soll eine Stadtteil-Broschüre veröffentlicht werden, die die Rahmenplanung, die Grundzüge des Integrierten Handlungskonzeptes sowie erste Maßnahmen und Hinweise auf Beteiligungsangebote enthält. Es ist geplant, diese Broschüre dann regelmäßig fortzuschreiben.
7. Fazit: Hier tut sich was! 
Unter dem Motto »Flensburg-Neustadt Hier tut sich was!«, das alle Veranstaltungen im Stadtteil begleitet, ist die soziale Stadterneuerung der Neustadt auf einem sehr guten Weg. Die Bündelung des klassischen Sanierungsprogramms mit dem Programm Soziale Stadt setzt für den mischgenutzten Gründerzeit-Stadtteil mit seinen spezifischen Potenzialen und Chancen wichtige Impulse und wirkt in vieler Hinsicht innovativ. Die Koordinations- und Vernetzungsstrukturen vor Ort sowie die horizontalen und vertikalen Kommunikations- und Entscheidungswege nicht zuletzt die gemeinsame Federführung der Ressorts Planen/Bauen und Soziales/Jugend/Gesundheit wirken sich Erfolg versprechend in Richtung einer integrierten und sozialorientierten Stadtteilentwicklung aus.
Auch auf der Projektebene wird dies inzwischen sichtbar und spürbar. Die Umgestaltung des nördlichen Teils der Neustadt, die Umnutzung der Walzenmühle zu einem kultur- und medienwirtschaftlichen Dienstleistungszentrum sowie der ehemaligen Sprachheilgrundschule zu einem Jugendprojekthaus, die Projekte Schutzengel sowie Ergebnisse der Spielraumanalyse und des lokalen Aktionsplans bewirken, dass über die Neustadt inzwischen mit Anerkennung gesprochen wird. Die Wohnungswirtschaft entdeckt die Neustadt als Ort für neue Investitionen. Es besteht eine Nachfrage nach Raum für Handel, Gastronomie und Dienstleistung, die sich stabilisierend und ordnend auswirken wird. Dabei sind ausreichend Potenziale für soziale und gemeinwesenorientierte Projektansätze gegeben, die im Ergebnis bereits zu einer Verbesserung des Images der Neustadt geführt haben. Das Stadtteilbüro hat sich zu einem kommunikativen Dreh- und Angelpunkt im Stadtteil entwickelt.
Zurzeit ist ein großer Teil der finanziellen Mittel an teure, eher klassische investive Sanierungsprojekte gebunden, wie Straßenbau, Grunderwerb und Gebäudeumnutzungen. Dies markiert notwendigerweise den Anfangspunkt der Stadterneuerung. Über den lokalen Aktionsplan oder auch aus stadtteilbezogenen Arbeitskreisen entwickelt sich aber die Notwendigkeit, künftig auch gemeinbedarfsorientierte und kommunikative und weitere den Zielen der Sozialen Stadt entsprechende, nachhaltig wirkende Projekte und Ideen finanziell abzusichern. Bündelung von Ressourcen bedeutet hier nicht nur, Geldströme aus verschiedenen Programmen zu verbinden, sondern auch Personalstunden und Know-how, Ehrenamt und Engagement einzubringen. Um diesen Prozess zu verstetigen, sind weiterhin intensive Diskussionen zwischen allen Beteiligten (auch z.B. mit dem Land Schleswig-Holstein und dem Arbeitsamt) zu führen. Einerseits müssen fachübergreifende Projektansätze präzise ausformuliert werden, andererseits müssen aber auch bestehende Programme oder Förderrichtlinien angepasst und manchmal neu interpretiert werden.
Für die Neustadt wird ein großer Teil der angesprochenen Projekte in 2002/2003 zum Tragen kommen. Darüber hinaus ist geplant, kurzfristig das Thema »Wohnen in der Neustadt« zu intensivieren. Es bleibt aber festzuhalten, dass bei allen Anstrengungen der Prozess der integrierten Stadterneuerung in der Neustadt gerade erst begonnen hat und spürbar geworden ist. Die Beteiligten haben gelernt zu kooperieren und werden durch erste Erfolge bestätigt.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005