soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Cottbus Sachsendorf-Madlow |
|
|
Kerstin Jahnke |
|
1. Gebietscharakter 
Mit Sachsendorf-Madlow wurde 1999 die größte in industrieller Bauweise errichtete Siedlung des Landes Brandenburg als Modellgebiet in das Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt« aufgenommen. Hinsichtlich seiner städtebaulichen Erscheinung, der Bevölkerungsentwicklung und der sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben, ist dieser Stadtteil im Süden von Cottbus paradigmatisch für einen solchen Gebietstypus, der viele Städte im Osten Deutschlands prägt.
Sachsendorf-Madlow wurde zwischen 1974 und 1986 im Rahmen der planwirtschaftlichen Entwicklung der Energieregion Lausitz vor allem für die Beschäftigten des Kraftwerks Jänschwalde und des Braunkohlekombinats Cottbus errichtet, bot aber damals auch eine Wohnalternative zur vernachlässigten Innenstadt. In vier Bauphasen entstand mit rund 12 000 Wohnungen die bis heute größte zusammenhängende Plattenbausiedlung des heutigen Landes Brandenburg, in der bis 1993 bis zu 30 000 Menschen lebten.
Entsprechend den Bauphasen sind vier Wohnquartiere zu unterscheiden, die den alten Ortskern mit Einfamilienhausbebauung umschließen. Die Wohnquartiere sind wesentlich durch eine fünf- und sechsgeschossige Blockbebauung gekennzeichnet. Acht- und elfgeschossige Hochhäuser dominieren im Zentrumsbereich und markieren als städtebauliche Dominanten die Eingangssituation zum Stadtteil. Während einige Quartiere ein »grünorientiertes Wohnen« möglich machen, fallen die nicht modernisierten nördlichen »Wohnscheiben« durch ihre monotone Massivität auf. Bereits vor 1989 erzwangen Sparmaßnahmen die Beschränkung der Infrastrukturen für Handel, Sport und Freizeit auf das nötigste, sodass der Stadtteil eine typische Wohn- und Schlafstätte für eine vollbeschäftigte Industriegesellschaft wurde, die nach der Wende wenig Raum für die neu entstehenden Verhältnisse zwischen Arbeitslosigkeit und Wohlstandsentwicklung und die daraus resultierenden unterschiedlichen Lebensstile bot.
Am nördlichen Ost-West-Boulevard, der Gelsenkirchener Allee, befindet sich das Wohngebietszentrum mit Versorgungs- und Einkaufsmöglichkeiten, das im Jahre 2001 durch ein markantes Zeltdach als Fokus und Forum des Viertels hervorgehoben wurde. Trotz der zentralen Lage und der Aufwertung des Platzes sind Fluktuation und Leerstand von Läden unübersehbar. Bei geringer Kaufkraft locken die Angebote in der Innenstadt und im hinter der Autobahn liegenden Einkaufszentrum Lausitzpark, das für ganz Cottbus Handel, Kinos und Dienstleistungen »vor den Toren« anbietet. Seit 1994 wird auf einem früher verschlossenen Kasernengelände der Cottbuser Standort der Fachhochschule Lausitz entwickelt, der fünf Studiengänge, unter diesen Sozial- und Bauingenieurwesen, anbietet.
 |
| Östlicher Teil des Modellgebiets mit der »grünen Mitte« (Bildquelle: Foto Kliche, Cottbus) |
Im vergangenen Jahrzehnt hat der Stadtteil eine fast völlige Umwertung erfahren, und seine Bewohnerinnen und Bewohner haben in unterschiedlicher Weise auf die Veränderung ihrer Lebensverhältnisse und des Images ihres Wohngebietes reagiert. Wo früher aufgrund der Wohnzufriedenheit eine große Nachfrage herrschte, bestimmt heute Leerstand die Situation. Die Vollbeschäftigung im »Energiebezirk der DDR« ist einer permanent hohen Arbeitslosigkeit gewichen und mit der Ausdifferenzierung der Einkommensverhältnisse bei gleichzeitig entspanntem Wohnungsmarkt haben viele, die »es geschafft haben«, das Gebiet verlassen, während oft nachzog, wer sich anderswo keine Wohnung leisten konnte.
 |
Abgrenzung des Modellgebiets Sachsendorf-Madlow (Bildquelle: Integriertes Handlungskonzept 2001, StadtBüro Hunger; Überarbeitung) |
Heute leben in Sachsendorf-Madlow rund 17 700 Einwohner, 43 Prozent weniger als im Jahr 1993. Trotz der gravierenden Abwanderung, die allein im Jahr 2000 zu einem negativen Wanderungssaldo von acht Prozent führte, zeichnet sich die Großsiedlung auch fast drei Jahrzehnte nach dem Erstbezug durch eine junge Bevölkerung aus.
Der Anteil der 35- bis 45-Jährigen sowie der Jugendlichen liegt über dem Durchschnitt - noch immer in Folge der früheren Wohnraumbelegungspolitik der DDR, die vor allem junge Familien mit Kindern nach Sachsendorf-Madlow führte. Die sozio-ökonomischen Verhältnisse entsprachen bislang überwiegend der gesamtstädtischen Situation. Jedoch ist in den letzten Jahren ein deutliches Abfallen festzustellen, das sich auch im verringerten Qualifikationsniveau der Bevölkerung spiegelt.
2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale 
Vor dem Hintergrund der schrumpfenden Bevölkerungszahl und angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Depression sowie der hohen Fluktuation sind Leerstand, Arbeitslosigkeit, Vernachlässigung der baulichen Substanz und die zunehmende soziale Erosion die zentralen Problemfelder.
Der dauerhafte Angebotsüberhang von Wohnungen in der gesamten Region verschärft den Leerstand im »Plattenbau«: 26 Prozent leere Wohnungen im Durchschnitt belasten das Wohnen, stören nachbarschaftliche Beziehungsnetze und führen dadurch auch bei den noch Ansässigen zu der Überlegung auszuziehen. Und wo Wohnungen leer stehen, machen aufgrund von Kundenmangel auch die Läden dicht, sind die Schulen in ihrem Bestand gefährdet. Negativ wirkt sich zugleich auch der im Vergleich zu anderen Cottbuser Großsiedlungen nur geringe Sanierungs- und Modernisierungsumfang in Sachsendorf-Madlow aus, obwohl inzwischen eine Mehrheit der Anwohnerschaft auf billige Mieten hochgradig angewiesen ist. Dies alles bedroht die wirtschaftliche Zukunft aller Wohnungsunternehmen.
Hohe Arbeitslosigkeit und mangelnde wirtschaftliche Aktivitäten im Stadtteil führen zu Einkommens- und Kaufkraftverlusten: In Folge des dramatischen Arbeitsplatzverlustes, bisher ohne Kompensation im Stadtteil oder der Region, ist der Anteil der arbeitslosen Bevölkerung in Sachsendorf-Madlow auf über 26 Prozent angestiegen und liegt deutlich über dem städtischen Mittel von 17 Prozent. Als besonders kritisch muss der hohe Anteil der Langzeitarbeitslosen von 40 Prozent angesehen werden, die sich oft ohne Perspektive als Verlierer des gesellschaftlichen Wandels sehen. Da im Stadtteil bisher weder Ansätze einer über den Dienstleistungssektor hinausreichenden lokalen Ökonomie oder größerer Investitionsvorhaben bestehen, sind aus dem Stadtteil selbst heraus nur bedingt positive Impulse zu erwarten.
DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE
|
Sachsendorf-Madlow (1) |
Cottbus |
|
|
Größe |
230 ha |
15 030 ha |
|
Einwohnerzahl |
19 620 |
108 200 |
|
Bevölkerungsverlust(1995–2000) |
30,7 % |
11, 6 % |
|
Durchschnittliche Haushaltsgröße |
2,11 Pers. |
2,11 Pers. |
|
Anzahl der Wohnungen |
12 057 |
60 800 |
|
Leerstand |
3 040 WE |
9 000 WE |
|
Anteil der Wohngeldempfänger |
6,5 % |
4,5 % |
|
Arbeitslosenquote |
nicht verfügbar |
16,5 % |
|
Anteil der Sozialhilfeempfänger |
5,4 % |
3,2 % |
|
Anteil der ausländischen Bevölkerung |
3,8 % |
2,8 % |
|
Anteil der unter 18-Jährigen |
24,1 % |
18,6 % |
|
Anteil der über 60-Jährigen |
15,2 % |
24 % |
|
(1) Statistische Bezirke 0231-0235 |
||
Im letzten Jahrzehnt gebaute große Versorgungseinrichtungen am Stadtrand führen zum Attraktivitätsverlust für Investoren und behindern den Aufbau von lokalen Arbeitsplätzen. Die wirtschaftlichen Aussichten von Dienstleistungsund Handelsbetrieben in Sachsendorf-Madlow werden durch die starke Konkurrenz des unmittelbar hinter dem südlichen Stadtrand gelegenen neuen Einkaufszentrums beeinträchtigt, die vorhandenen Flächenpotenziale in der Großsiedlung entwertet.
Die Ausdünnung der Infrastruktur bei Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen sowie im kulturellen Bereich mindert die Attraktivität für die Bewohnerinnen und Bewohner: Die schlechte örtliche Versorgungssituation stellt einen erheblichen die Wohnqualität beeinträchtigenden Faktor dar, der die Abwanderung fördert und Zuzüge behindert. Auch die Verringerung des früher sehr guten städtischen Angebots kultureller Aktivitäten, die heute im Wesentlichen von Vereinen getragen werden, wird als ein Verlust an Lebensqualität empfunden, gerade wenn es mehr durch Arbeitslosigkeit »erzwungene Freizeit« gibt.
Besonders schwer wiegt, dass diese Problemfelder eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen. Um das Gebiet aus seiner Abwärtsspirale von problembedingtem Attraktivitätsverlust und in der Folge weiteren Problemverschärfungen herauszuführen, hat sich die Stadt entschlossen, an den verschiedenen Faktoren gleichzeitig und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden anzusetzen, baulich, sozial und gemeinwesenorientiert sowie durch wirtschaftliche Initiativen - also im Rahmen eines ressort- und themenübergreifend integrierten Handlungskonzepts. Dafür ist durchaus eine Reihe positiver Entwicklungspotenziale vorhanden.
 |
Problemfeld Wohnqualität: geringer Modernisierungsgrad und monotone Strukturen (Bildquelle: IRS, Erkner) |
 |
Entwicklungspotenzial Stadtumbau: Wiederverwendung von abgebrochenen Plattensegmenten für die Errichtung von Stadtvillen (Bildquelle: IRS, Erkner) |
Die räumliche Lage sowie die geringe Bebauungsdichte mit großzügigen Freiräumen zwischen den Wohngebäuden bietet gute Ansätze für eine Aufwertung der Freiflächen und der öffentlichen Räume. Durch eine gemeinsam mit den verschiedenen Bewohnergruppen entwickelte Freiraumgestaltung lassen sich Verbesserungen in der Nutzungsqualität und dem Erscheinungsbild der Siedlung erreichen. Sie wirken sowohl nach innen als Qualitätsverbesserung für die unterschiedlichen Alters- und Interessengruppen, als auch nach außen als Signal für ein besseres Image.
Mit dem bereits gefällten Beschluss zu Rückbau und einem qualitätsorientierten Stadtumbau bietet sich die Möglichkeit einer auf funktioneller Neubestimmung basierenden Umgestaltung und der notwendigen räumlichen sowie baulichen Neuorganisation des Stadtteils. Eine Anpassung an mittelfristig erwartbare quantitative Bedarfe und damit verbunden eine Verbesserung der Qualität für die Bewohnerschaft wird durch eine neue Betrachtung des Stadtteils im Gesamtkontext der Stadt möglich. Erste Beispiele, wie der Abriss einer großen »Wohnscheibe« und der folgende Bau von »Vorstadtvillen« aus recycelten Platten am gleichen Ort zeigen den Bewohnerinnen und Bewohnern die Potenziale des »Gesundschrumpfens«.
Ein großer Teil der heutigen Bevölkerung Sachsendorf-Madlows gehört noch zu den ersten Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils. Entsprechend bestehen weiterhin enge soziale Netze, die ein wesentliches Potenzial für die Entwicklung des Stadtteils darstellen, wenn es gelingt, das aktive Gemeinwesen für die Umgestaltung zu aktivieren und in diese einzubinden. In enerationenübergreifenden Aktivitäten können dabei die vielen jungen Menschen eine wichtige Rolle übernehmen, auch wenn das Gebiet für sie oft ein »Durchlauferhitzer« während der Ausbildungs- und Haushaltsgründungsphase bleiben wird.
In diesem Zusammenhang bilden die Ansiedlung der Fachhochschule Lausitz (fünf Studiengänge) auf dem Gebiet des Stadtteils und die Nähe der Brandenburgisch-Technischen Universität bisher kaum ausgeschöpfte Ansatzpunkte für eine »wissensbasierte« Entwicklung. Hochschulen bieten Arbeitsplätze (für Hochqualifizierte in Forschung und Lehre genauso wie für Reinigungspersonal), sie schaffen Wohnraumbedarf, und von leeren Wohnungen und Flächen könnten positive Impulse auf das kulturelle Leben im Stadtteil ausgehen. Gerade die Fachhochschule kann bei zunehmender Forschungsorientierung zudem als begünstigender Standortfaktor für klein- und mittelständische Unternehmen bei wirtschaftlichen Entscheidungen eingesetzt werden.
Mit dem im Südwesten auf Cottbuser Seite in enger Abstimmung mit einem Betrieb der Druck- und Medienbranche entwickelten Gewerbegebiet sind die Voraussetzungen für die Ansiedlung weiterer Betriebe gegeben. Hier arbeiten bereits über 40 Mitarbeiter und neun Auszubildende; weitere Flächen können zukünftig durch Rückbau gut erschlossen und in der Nähe von Autobahn und Wohnungen verfügbar werden.
Sachsendorf-Madlow profitiert schließlich direkt von der Durchführung der Internationalen Bauausstellung in der Lausitz durch gemeinsame Projekten bzw. die Präsenz der IBA im Stadtteil. In diesem Zusammenhang ist der IBA-Stadtpfad zu nennen, ein gleichzeitig realer und virtueller Pfad durch den Stadtteil, der Bindungen durch Identifizierung schaffen und das Image verbessern helfen soll.
Festzuhalten bleibt: Sachsendorf-Madlow hat sich vom sozial stabilen und eher bevorzugten Stadtteil zu einem sozial und wirtschaftlich »überlasteten« Gebiet entwickelt. Aber trotz der Probleme gibt es belastungsfähige soziale Netze, und das Gebiet könnte durch die Initiativen der Sozialen Stadt und einen auch von Rückbau geprägten Stadtumbau zu einer neuen Qualität finden. Signale dafür sind bereits gesetzt. Seit 1997 wird durch städtebauliche Maßnahmen an einer Verbesserung des Wohnumfelds und der Zentrumsbildung am Stadtteilplatz gearbeitet.
3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte 
Angesichts der Interdependenz, das heißt der gegenseitigen Bedingtheit und Verstärkung von Problemen und Chancen sowie aufgrund der erheblichen Bedeutung des Stadtteils für die Gesamtentwicklung der Stadt sieht es die Stadtverwaltung als erforderlich an, durch »integriertes Handeln« einen Prozess einzuleiten, der flexibel auf sich dynamisch verändernde Bedingungen reagieren hilft. Es kommt der Stadt deshalb darauf an, zu Verbesserungen im Stadtteil beizutragen und zugleich langfristig Handlungsoptionen offen zu halten, keinen »Plan«, sondern eine »pro-aktive« Stadtteilentwicklung »mit Gewinn für alle« anzuregen. Im Mittelpunkt steht die Aktivierung von Partnerschaften zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern, Stadt und Investoren, um Sachsendorf-Madlow (wieder) zu einem akzeptierten Wohnstandort zu machen. In der 1998 abgeschlossenen und mittels eines Selbstbindungsbeschlusses von der Stadtpolitik bestätigten »Städtebaulichen Rahmenplanung Sachsendorf-Madlow« wird als Leidbild »Vom peripheren Wohngebiet zum integrierten Stadtteil« formuliert, das sich in der Vorbereitenden Untersuchung zur Ausweisung als Sanierungsgebiet aus dem Jahr 2001 unter den Sanierungszielen wiederfindet. Die hierin angelegten Strategien spielen eine zentrale Rolle für das im Dezember 2001 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Integrierte Handlungskonzept als dem wesentlichen Instrument zur Umsetzung des Programms Soziale Stadt.
Angesichts des massiven Leerstands und des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs wurde eine Doppelstrategie für den Stadtteil beschlossen, die einerseits die Aufwertung und Erhaltung von langfristig zu sichernden Wohnbereichen und andererseits den Rückbau und die städtebauliche Neuordnung anderer Bereiche umfasst. Dem sozialverträglichen Stadtumbau kommt eine zentrale Rolle zu: Er soll sicherstellen, dass es keine weitere Verunsicherung über die Zukunft gibt. Denn Bewohnerschaft und Gewerbetreibende akzeptieren durchaus, dass der Stadtteil angesichts des Leerstands und der Abwanderung nur mit »harten Schnitten« eine Zukunft hat. Weitere Unsicherheit darüber, was mit dem eigenen Wohnort künftig geschieht, gibt dagegen oft den Ausschlag, sich nach einer räumlichen Alternative umzusehen.
Information, persönliches Management der Rückbaumaßnahmen und Umzugsmanagement sind in diesem Zusammenhang wesentliche Ansätze für die Vertrauensbildung. Gleichzeitig zeigen modellhafte Sanierungen und sinnvolle Nachnutzungen der frei werdenden Flächen, welche räumlichen und sozialen Visionen Realität werden können. So entstehen entlang des zentralen Boulevards helle, geöffnete Fassaden im Bestand der großen Wohnscheiben, ebenso Stadtvillen aus recycelten Platten, die Wohnraum entsprechend den veränderten Wohnwünschen anbieten.
 |
Zum Soziokulturellen Zentrum umgebaute ehemalige Kindertagesstätte im Quartier Turower Straße (Bildquelle: IRS, Erkner) |
Mit Blick auf die Wünsche und Vorstellungen der Bewohnerinnen und Bewohner liegt ein weiterer Handlungsschwerpunkt in der Sicherung und Verbesserung der ökologischen Qualität »Wohnen im Grünen«. Daneben sollen lokale soziale Selbsthilfe, die Bündelung aller Möglichkeiten zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und der lokalen Arbeitsmarktinitiativen und nicht zuletzt die Arbeit am Image des Stadtteils als Bausteine zur integrierten Entwicklung beitragen.
4. Schlüsselprojekte 
Das Schlüssel- und Startprojekt der »Sozialen Stadt« in Sachsendorf-Madlow ist der Umbau einer leer stehenden Kindertagesstätte zu einem Soziokulturellen Zentrum. Das Gebäude liegt im Innenbereich des ältesten und bisher kaum sanierten Quartiers. Mit diesem Projekt wurde der umfassende Umbau des gesamten Quartiers angestoßen, der die Modernisierung der Wohnungen, den partiellen Rückbau und die Verbesserung des Wohnumfelds einschließt. Bei den im Oktober 2000 begonnenen Baumaßnahmen wurden neben örtlichen Firmen auch mehrere Arbeitskräfte im Rahmen eines »Arbeit statt Sozialhilfe (ASS)«-Projekts beschäftigt.
 |
Eröffnung des Soziokulturellen Zentrums am 25.10.2001 (Bildquelle: IRS, Erkner) |
Mit dem Umbau zu einem Soziokulturellen Zentrum wurde ein Anlauf- und Treffpunkt sowie ein quartiersinterner Veranstaltungsort geschaffen, der den ansässigen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Initiativen zur Verfügung steht. Neben sozialen, psychosozialen und kulturellen Einrichtungen wie einer Theater-Probenbühne ist Raum für wechselnde kulturelle Veranstaltungen vorhanden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers haben auch die Möglichkeit, Mehrzweckräume kostengünstig zu nutzen, z.B. für Familienfeiern. Mit dem »Netzwerk Füreinander - Miteinander« und der »Freiwilligenagentur«, sind Akteure des Programms eingebunden, die sich die Vernetzung bestehen der Initiativen im Stadtteil und die Aktivierung von Bewohnerinnen und Bewohnern zum Ziel gesetzt haben. Das starke Interesse und die hohe Besucherzahl seit der Einweihung im Oktober 2001 zeigen die positive Resonanz, die dieses Stadtteilprojekt erfährt.
5. Organisation und Management 
In Sachsendorf-Madlow sind bereits im Zuge des seit 1997 im Stadtteil umgesetzten Förderprogramms »Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete« verschiedene integrative Organisations- und Managementstrukturen entstanden. Damit war eine Basis für die Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« geschaffen. Auch wenn die Kooperation zwischen den Akteuren anfangs nicht einfach war, ist inzwischen eine Verfahrenskultur entstanden, die alle Ebenen der Beteiligung einschließt. Mit der Ausweisung des überwiegenden Teils des Modellgebiets zu einem städtebaulichen Sanierungsgebiet hat zum Jahresende 2001 eine neue Aufgabenbestimmung stattgefunden, die sich auch in der Organisationsstruktur niederschlägt.
Federführend für die Stadtverwaltung ist das Bauverwaltungsamt, das sowohl das Programm »Soziale Stadt« wie die »Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete« umsetzt und verwaltungsintern koordiniert; es ist auch die verantwortliche Instanz für die Akteure auf intermediärer Ebene sowie vor Ort.
Prozesskoordination, Organisation des öffentlichen Diskurses und Betreuung der investiven Maßnahmen erfolgten auf intermediärer Ebene bislang durch die Gebietsbeauftragten (in Arbeitsgemeinschaft: StadtBüro Hunger und Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft [DSK]) und werden künftig vom Sanierungsträger übernommen.
Durch das Stadtteilmanagement sollen die Arbeit von Verwaltung, Investoren, sozialen Trägern und Bewohnerschaft stärker miteinander verflochten und die Integration verschiedener Handlungsstränge verbessert werden. Die kurzzeitig erprobte Zuordnung dieser hochgradig auf Flexibilität und Eigenständigkeit angewiesenen Moderatorenaufgabe zur Stadtverwaltung hat sich nicht bewährt; zukünftig wird mit dieser Funktion ein verwaltungs- und eigentümerunabhängiger Akteur beauftragt.
Um der Bürgerschaft und den Akteuren vor Ort kompetente Mitsprache zu ermöglichen, werden sie im Rahmen der »Sozialen Stadt« unterstützt und in unterschiedliche Planungs- und Entscheidungsgremien einbezogen. Dabei kommt besonders dem Bürgerverein in seinem Verständnis als »Sprachrohr« der Bewohnerschaft und dem »Netzwerk Füreinander - Miteinander« aufgrund seiner die Stadtteilakteure vernetzenden Arbeit eine wichtige Rolle bei Entscheidungsfindungen im Stadtteil zu.
 |
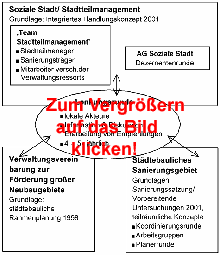 |
| Stadtteilladen an der Gelsenkirchener Allee (Bildquelle: IRS, Erkner) |
Organisation der Programmumsetzung |
Zusammengeführt wurden die unterschiedlichen Ebenen und Beteiligungsstrukturen bislang durch die im Stadtteilladen regelmäßig tagenden Lenkungsrunden sowie in daraus hervorgegangenen Arbeitsgemeinschaften oder der übergeordneten Koordinierungsrunde. Künftig wird die Lenkungsrunde den Charakter eines Informations- und Diskussionsgremiums haben, in dem die lokalen Akteure sich einbringen und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen an alle Akteure aussprechen können. An den grundsätzlich offenen Runden sollen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Verwaltungsressorts und des Stadtteilmanagements, der Sanierungsträger, der Wohnungswirtschaft, des Bürgervereins, der Internationalen Bauausstellung und der ansässigen Hochschulen teilnehmen. Je nach Thema wird diese Runde um geladene Gäste erweitert.
6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
Für die Aktivierung und Beteiligung der Quartiersbevölkerung sind die Voraussetzungen in Sachsendorf-Madlow günstig: Aufgrund der gemeinsamen Wohntradition eines großen Teils der Bewohnerschaft kann auf ausgeprägte informelle Netze aufgebaut werden. Des Weiteren ist mit mehr als 80 aktiven Vereinen, Verbänden, Organisationen und freien Trägern ein breites Spektrum an Angeboten für alle Altersgruppen und unterschiedliche Interessenfelder vorhanden, über das ebenfalls ein Großteil der Bevölkerung erreicht werden kann. Die bisher durchgeführten Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen sowie die Arbeit des Soziokulturellen Zentrums zeigen: Auch ohne umfangreiche aktivierende Arbeitsformen ist es möglich, große Gruppen der Bewohnerschaft in die Aktivitäten für den Stadtteil einzubeziehen.
 |
Einweihung des neu gestalteten Stadtplatzes beim Bürgerfest 2001 (Bildquelle: Der Sachsendorfer, Cottbus) |
Dennoch ist eine gezielte Aktivierungsarbeit unerlässlich, um eine breite Beteiligungskultur zu etablieren. Mit der Einrichtung eines Stadtteilmanagements wurde der wesentliche Grundstein hierfür gelegt. Zukünftig wird stärker auf eine aufsuchende und zielgruppenspezifische Beteiligungsarbeit sowie eine breite Öffentlichkeitsarbeit gesetzt, z.B. durch Mitarbeit in der viel gelesenen Stadtteilzeitung sowie über weitere Printmedien und das Internet. Wie bisher sollen die jährlichen Stadtteilfeste, die der »Bürgerverein« organisiert, und Bürgerversammlungen zu wichtigen den Stadtteil betreffenden Themen, zurzeit insbesondere Wohnungsrückbau, Kernstücke der Beteiligungskultur sein. Die über den Prozess der Rahmenplanung seit einigen Jahren entstandenen Arbeitskreise werden fortgeführt und deren Ergebnisse aktiv in die Stadtteilentwicklung eingebracht. Hinsichtlich Außenwahrnehmung und Bekanntheit dieser Partizipationsangebote lässt sich allerdings noch vieles verbessern. Hierin liegt eine wesentliche Aufgabe des »Netzwerks Füreinander - Miteinander«. Mit Unterstützung durch das Sozialamt sollen im Zuge des Programms »Soziale Stadt« die bereits vorhandenen Strukturen für die Entwicklung des Stadtteils verstärkt nutzbar gemacht werden.
Das aus Mitteln der »Soziale Stadt« finanzierte Soziokulturelle Zentrum sowie der Stadtteilladen im Gebietszentrum bilden die örtlichen Anlauf- und Informationsstellen für die Bewohnerinnen und Bewohner.
7. Fazit: Zwischen Abriss und qualitativem Neubeginn 
Zum jetzigen Zeitpunkt ein abschließendes Fazit über die Wirksamkeit des Programms »Soziale Stadt« in Sachsendorf-Madlow ziehen zu wollen, erscheint verfrüht. Besonders die sozialen und ökonomischen Massnahmen haben einen mittel- bis langfristigen Charakter. Bereits heute lässt sich feststellen, dass ihr Erfolg, vor allem die Herausbildung einer neuen integrativen Planungskultur, in der Nachhaltigkeit ihrer Wirkung liegt. Anfangsschwierigkeiten waren unübersehbar. Städtische Akteure und, einem besonderen ökonomischen Druck ausgesetzt, die Wohnungswirtschaft konnten anfangs die Chancen schwer einschätzen, die sich aus dem integrativen Ansatz der »Sozialen Stadt« ergaben. Inzwischen ist es zu Akzentverschiebungen gekommen. Sie stellen eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsressorts, den Akteuren und der Bevölkerung sicher, die sich unter anderem auf Bewohnermitwirkung, eine weitergehende Berücksichtigung der Alltagsprobleme, Arbeitsmarktmaßnahmen und ein kompetentes Quartier(Prozess-)Management stützt.
Mit den im Rahmen der »Sozialen Stadt« angestoßenen Projekten und Entwicklungen wird ein wichtiger Schritt in Richtung zukunftsfähiger Strukturen des Stadtteils getan. In der Verknüpfung der »Sozialen Stadt« mit dem neu aufgelegten Programm »Stadtumbau Ost - für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen« liegt eine zusätzliche Chance, eine neue Balance von sozialer Vielfalt und Kohäsion in einem baulich gestaltungsfähigen Viertel zu erreichen.
Die in Sachsendorf-Madlow im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts gewählten Ansätze lassen besonders in jüngster Zeit eine deutliche Stärkung der Artikulationskraft der Bewohnerschaft und deren engere Einbindung in die Entwicklung erkennen. Dies zeigt sich vor allem in Institutionen wie dem Soziokulturellen Zentrum, in Diskussionen im Stadtteilladen, in der Arbeit des »Netzwerks Füreinander - Miteinander« und auf Informations- und Beteiligungsveranstaltungen. Mit der Einrichtung eines Stadtteilmanagements wurde ein zentrales Instrument für Aktivierung und Beteiligung sowie die Förderung eines integrierten Vorgehens geschaffen.
Der Ausgang der gesamten Bemühungen für den Stadtteil ist durchaus noch offen. Konstatiert werden muss, dass die seit 1993 stattfindende Abwanderung der Bevölkerung bisher nicht gestoppt wurde. Im Gegenteil, sie hat sich im vergangenen Jahr wieder verschärft und ist zunehmend mit sozialer Segregation verbunden. Auf diese Dynamik wird insbesondere das Stadtumbaukonzept für die Stadt Cottbus durch Offenheit und Flexibilität reagieren und gleichzeitig sichere Schrittfolgen der Planung und der Umsetzung anbieten müssen. Der gerade begonnene Prozess der integrierten sozialökonomischen und baulichen Stabilisierung auf einem neuen Niveau braucht auch künftig die Kontinuität ressortübergreifenden Handelns der Verwaltung in Partnerschaft mit der Bürgerschaft und den wirtschaftlichen Akteuren, allen voran der Wohnungswirtschaft.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005