soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Bremen Gröpelingen |
|
|
Thomas Franke |
|
Der Stadtstaat Bremen setzt das Programm »Soziale Stadt« im Rahmen seines kommunalen Programms »Wohnen in Nachbarschaften (WiN) – Stadtteile für die Zukunft entwickeln« um, das bereits 1999 gestartet wurde. Das Handlungskonzept des »WiN«-Programms weist in Bezug auf Zielsetzung, Ressourcenbündelung, Organisationsstrukturen, Aktivierung und Beteiligung grundlegende Parallelen zum Programm »Soziale Stadt« auf, weswegen beide Förderstrategien zum Bremer Ansatz »WiN/Soziale Stadt« verknüpft worden sind. Dabei werden die »WiN«-Mittel überwiegend nichtinvestiv, die Mittel aus dem Programm »Soziale Stadt« eher investiv eingesetzt.
1. Gebietscharakter 
Das aus den drei Ortsteilen Lindenhof, Ohlenhof und Gröpelingen bestehende, 354 Hektar umfassende Modellgebiet Gröpelingen liegt im Westen der Hansestadt. Das siedlungsstrukturell sehr heterogene Gebiet wird im Süden durch altindustrielle Werftanlagen, Hafengebiete sowie die Weser, im Norden von einer Autobahn, einer Bahntrasse sowie Landwirtschaftsund Kleingartenflächen begrenzt.
 |
| Luftaufnahme von Teilen des Modellgebiets aus den 80er-Jahren (Bildquelle: Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH, Bremen) |
Gröpelingen hatte sich – basierend auf dem Ausbau von Weserhafen und Eisenbahn – während des 19. Jahrhunderts zu einem industriellen Vorort Bremens entwickelt und war bis in die Gegenwart ein traditioneller Arbeiterstadtteil. Das »Aus« kam allerdings mit der Schließung der Werft »AG Weser« im Jahr 1983 als bis dahin größtem lokalem Arbeitgeber. Damit einher ging der Verlust von mehr als 2 500 Arbeitsplätzen.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden in Gröpelingen rund 75 Prozent des Gebäudebestands zerstört. Der im Zuge des Wiederaufbaus errichtete öffentlich geförderte Geschosswohnungsbau umfasst heute etwa 65 Prozent des Bestands. Gleichzeitig weisen noch heute ganze Straßenzüge geschlossen den Bautypus des »Bremer Hauses« mit einem sehr hohen Eigentumsanteil auf.
 |
Grenzen des Modellgebiets »Gröpelingen« und des »Fokusgebiets« (Grafik: Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für Bau und Umwelt) |
Insgesamt führten der industrielle Niedergang sowie die städtebauliche »Weichenstellung« der Nachkriegszeit zu teilweise erheblichen Problemen in Gröpelingen, wovon sich der »Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf« bis heute nur in Teilen erholt hat: soziale, wirtschaftliche, ökologische und städtebauliche Probleme konzentrieren sich auf einige »Probleminseln«, während andere Bereiche Gröpelingens – nicht zuletzt aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen sowie der Umsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN – vergleichsweise intakt sind.
2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale 
Zu den zentralen Problemfeldern in Gröpelingen gehört die überaus hohe Arbeitslosenquote: Sie liegt mit 20,2 Prozent weit über dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 13,1 Prozent (ohne Bremerhaven). Unzureichende Ausbildungsangebote für Jugendliche sowie fehlende wohnungsnahe Arbeitsplätze erschweren die Situation.
 |
Geschosswohnungsbau im »Fokusgebiet« (Bildquelle: Ulrike Meyer, Berlin) |
Auch die Anzahl der Personen, die Transferleistungen empfangen, ist im Modellgebiet weit höher als im gesamtstädtischen Durchschnitt: Gröpelingen weist die höchste Sozialhilfedichte Bremens auf; im Jahr 1999 bezogen rund 16 Prozent der lokalen Bevölkerung laufende Leistungen aus der Sozialhilfe. Mangelnde Kaufkraft ist ein wesentlicher Grund für den allmählichen Niedergang des Gröpelinger Einzelhandels.
Die sozial besonders benachteiligten Haushalte konzentrieren sich auf Teilbereiche im Nordosten des Modellgebiets, die durch eine Hauptverkehrsstraße von den weniger problematischen Bereichen Gröpelingens abgeschnitten werden. Hier sind bis zu 60 Prozent des Bestands belegungsgebunden, ergänzt durch rund 600 der 1 000 Bremer »OPR-Wohnungen« zur Unterbringung von Obdachlosen. Soziale Probleme wie Alkoholismus sowie die Mehrzahl aller in Gröpelingen registrierten Delikte finden sich in diesen »Probleminseln«, die zudem Verwahrlosungstendenzen sowohl in der Bausubstanz als auch im Wohnumfeld aufweisen.
Angesichts der Größe und der geschilderten Heterogenität Gröpelingens ist es schwierig, Entwicklungspotenziale für das gesamte Modellgebiet zu identifizieren. Eher kann dies für Teilbereiche gelingen:
Potenzial Gebietsstruktur: Neben den beschriebenen »Probleminseln« weist das Modellgebiet viele vergleichsweise intakte Bereiche auf, die positiv auf die benachteiligten Quartiere im Gebiet ausstrahlen können.
Städtebauliche Potenziale: Das Modellgebiet liegt innenstadtnah und ist sowohl per Individualverkehr als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Preiswerter Wohnraum und kleinteilige städtebauliche Strukturen können als Potenziale für die Ansiedlung neuer Haushalte (Studierende, junge Menschen) betrachtet werden. Der hohe Eigentümeranteil im Gebiet ist Basis für Bewohnerstabilität und eine positive Identifikation mit Gröpelingen.
DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE
|
Gröpelingen |
Bremen Stadt |
|
|
Größe |
354 ha |
40 428 ha |
|
Einwohnerzahl (1999) |
25 445 |
540 330 |
|
Bevölkerungsverlust(1995–1999) |
1,8 % |
1,6 % |
|
Durchschnittliche Haushaltsgröße (2000) |
1,9 Pers. |
1,92 Pers. |
|
Anzahl der Wohnungen (2000) |
13 389 |
281 204 |
|
Leerstand |
nicht verfügbar |
nicht verfügbar |
|
Anteil der Wohngeldempfänger |
nicht verfügbar |
nicht verfügbar |
|
Arbeitslosenquote |
21,5 %(1) (1999) |
13,5 % (2000) |
|
Anteil der Sozialhilfeempfänger (1999) |
15,8 % |
9,5 % |
|
Anteil der ausländischen Bevölkerung (2000) |
22,6 % |
12,5 % |
|
Anteil der unter 18-Jährigen (1999) |
18,3 % |
16,5 % |
|
Anteil der über 60-Jährigen (1999) |
36,5 % |
25,1 % |
|
(1) Arbeitslosenziffer |
||
Potenziale im Bereich lokale Ökonomie: Zwar wird der allmähliche Niedergang von (deutschem) Einzelhandel und Dienstleistungen beklagt, doch findet sich in Gröpelingen gleichzeitig eine vitale ethnische Ökonomie, die diesem Trend entgegenzuwirken scheint. Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen können mit Sanierungs-, Modernisierungsund Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Modellgebiet gekoppelt werden.
Potenziale im Bereich bürgerschaftliches Engagement/ Gemeinwesen/ soziale Infrastruktur: Viele Akteure vor Ort beschreiben die Einwohnerinnen und Einwohner des Modellgebiets trotz unterschiedlicher sozialer Situation und ethnischer Herkunft als sehr offen, sodass Integrationsarbeit für ein besseres Zusammenleben hier noch vergleichsweise erfolgreich sei. Der Anteil an Migrantinnen und Migranten im Modellgebiet liegt mit 22,6 Prozent weit über dem gesamtstädtischen Durchschnitt (12,5 Prozent); in Teilen existiert eine türkische »Parallelwelt« neben der deutschen, allerdings in Form eines friedlichen Nebeneinanders, sodass hier Potenziale für eine weitere Annäherung gesehen werden. In Gröpelingen gibt es eine Vielzahl von Vereinen, Organisationen und Initiativen, die das soziale Zusammenleben fördern.
 |
Kleinteilige städtebauliche Strukturen mit hohem Anteil an Wohneigentum (Bildquelle: Ulrike Meyer, Berlin) |
Potenzial Maßnahmen- und Programmvielfalt: In Gröpelingen wurden und werden verschiedene Förderungsprogramme und Maßnahmen – auch jenseits der Programme »WiN« und »Soziale Stadt« – umgesetzt, die nahezu alle Teilgebiete und -bereiche betreffen (insbesondere EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN, »Sofortprogramm Innenstadt und Nebenzentren «, klassische Städtebau- und Wohnungsbauförderung).
3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte 
Die Erarbeitung von Entwicklungszielen für das heutige Modellgebiet »Soziale Stadt« wie auch für neun weitere Bremer sowie ein Bremerhavener Programmgebiet fand bereits 1998 im Rahmen der Erarbeitung des Handlungsprogramms »Wohnen in Nachbarschaften (WiN) – Stadtteile für die Zukunft entwickeln« statt. Zu den formulierten Zielen gehören unter anderem:
- Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse einzelner Zielgruppen (junge Menschen, Frauen),
- Förderung und Unterstützung des Engagements und der aktiven Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern an der Quartiersentwicklung unter anderem in »lokalen Foren«,
- Unterstützung der Zusammenarbeit lokaler und lokal wirksamer Akteure,
- Effektivitätssteigerung des Mitteleinsatzes durch Bündelung personeller und finanzieller Ressourcen,
- Förderung der privaten Investitionsbereitschaft.
Diese Programmziele beziehen sich auf sechs Handlungsfelder:
- Wohnungsbestand und Neubau,
- Städtebau,
- wirtschaftliche Effekte und regionale Ökonomie,
- Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung,
- gemeinwesenbezogene Prävention und Integration,
- soziale und kulturelle Netzwerke/Förderung von Eigeninitiative und Selbstorganisation.
Der Stadtteilbeirat Gröpelingen hat Ende 2000 eine Fokussierung des Mitteleinsatzes aus dem Programm »WiN/Soziale Stadt« auf die im Nordosten des Modellgebiets liegenden besonders benachteiligten »Probleminseln« beschlossen (»Fokusgebiet«). Handlungsschwerpunkte sollen sein:
- Rückbau von Schlichtwohnungen und Ersatzbebauung,
- Maßnahmen an den Wohngebäuden/Modernisierungsmaßnahmen,
- Veränderungen in der Belegungspolitik und der Belegungspraxis von Wohnungsbaugesellschaften,
- Privatisierung von Geschosswohnungsbau/Reihenhäusern,
- Verbesserungsmaßnahmen im öffentlichen Freiraum, bei Wegeverbindungen und Grünflächen,
- Beschäftigungsmaßnahmen im Wohnumfeldbereich/AB-Maßnahmen,
- Entwicklung der sozialen Infrastruktur,
- soziale Integration von Migranten- und benachteiligten deutschen Familien,
- präventive Angebote für Jugendliche.
4. Schlüsselprojekte 
Aus der Projekt- und Maßnahmenvielfalt im Modellgebiet wurden als Schlüsselprojekte solche ausgewählt, die dem Programmcharakter »Soziale Stadt« in besonderem Maße entsprechen:
Die Projekte JOB-TREFF WEST im Jugendfreizeitheim Gröpelingen sowie RAZ-Mobil im Bremer Westen dienen der Unterstützung von Jugendlichen in Bezug auf Bildungserwerb und Berufsfindung. Zu den konkreten Maßnahmen zählen die Betreuung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern bis zum Schulabschluss unter dem Slogan »Ran an die Zukunft – RAZ«, die Unterstützung von Schulabgängerinnen und Schulabgängern bei der Berufsfindung, die Vermittlung von Praktikumsstellen, die Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen, individuelle Beratung und Langzeitunterstützung einzelner Jugendlicher, die Kopplung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten mit Freizeitaktivitäten sowie sozialpädagogische Maßnahmen für Jugendliche mit schulischen und sozialen Problemen. JOB-TREFF WEST und RAZ-Mobil arbeiten eng mit Schulen und Betrieben zusammen.
Die gewaltpräventive Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen lokalen Akteuren in konflikthaften Situationen ist das Ziel des Projekts »Schlichten in Nachbarschaften«. Dafür wurde im Januar 2002 eine Schlichtungsstelle mit niedrigschwelligen Angeboten im »Fokusgebiet« als Anlaufstelle für Konfliktbeteiligte eingerichtet; gewaltpräventive Initiativen im »Fokusgebiet« ergänzen das Projekt, welches mit anderen Organisationen und Institutionen in Gröpelingen zusammenarbeitet.
Im vom Amt für Soziale Dienste betriebenen Gemeinschaftshaus Stuhmer Straße wird an zentralem Ort eine Vielzahl sozialer Dienstleistungen angeboten. Dazu gehören unter anderem ein offener Hort, soziale Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Vermittlung von gemeinnützigen Tätigkeiten im Rahmen einer »Nachbarschaftsbörse«, Raumangebote für Versammlungen und Besprechungen oder die Vorbereitung und Durchführung von Festen. Seit Januar 2002 ist hier zudem das Büro des »lokalen Managements« untergebracht. Die Angebote des Gemeinschaftshauses Stuhmer Straße werden durch in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Einrichtungen – Streetball-Platz, betreuter Kinderspielplatz, Streichelzoo – ergänzt.
 |
Bewohner streichen ihren Hausflur. (Bildquelle: Kay Borchers, Bremen) |
 |
Job-Treff West im Freizeitheim Gröpelingen (Bildquelle: Job-Treff West, Bremen) |
Zu den wichtigen Maßnahmen im »Fokusgebiet« gehören seit mehreren Jahren die Verbesserung von Wohnungen und Wohnumfeld mit umfassender Bewohnerbeteiligung sowie die Förderung der Eigeninitiative in der Bewohnerschaft des Quartiers. In Kooperation von Amt für Soziale Dienste und Bremischer Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH werden zusammen mit Bewohnerinnen und Bewohnern verschiedene identitätsstiftende Maßnahmen geplant und umgesetzt, so die gemeinschaftliche Gestaltung von Außenanlagen und Kinderspielplätzen, Pflanzaktionen, die Renovierung von Treppenhäusern und Eingangsbereichen, Müllbeseitigungen sowie gemeinsame Feste.
5. Organisation und Management 
Aufgrund der Integration des Programms »Soziale Stadt« in das Bremer Programm »Wohnen in Nachbarschaften (WiN) – Stadtteile für die Zukunft entwickeln« wurden hier keine neuen oder ergänzenden Organisationsund Managementstrukturen für die Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« geschaffen. Quartiermanagement findet in Bremen allgemein auf einer zentralen Ebene (»Ressortübergreifende Arbeitsgruppe«) und einer lokalen Ebene (»Lokales Management«) statt. Von dieser im Rahmen des Programms »WiN« typischen Organisationsstruktur wurde bei der Umsetzung der »Sozialen Stadt« im Modellgebiet Gröpelingen bisher abgewichen; seit Anfang 2002 hat aber eine Angleichung an die in den meisten »WiN«-Gebieten üblichen Strukturen stattgefunden.
Verwaltungsebene
1. Die beiden für die Programme »WiN« und »Soziale Stadt« federführenden Senatoren für Bau und Umwelt sowie für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales haben eine gemeinsame Geschäftsführung »Wohnen in Nachbarschaften (WiN)/Soziale Stadt« eingerichtet, deren Hauptaufgabe die Steuerung, Organisation und Weiterentwicklung des gesamten »WiN/Soziale Stadt«-Prozesses ist. Dazu gehören unter anderem die Prüfung von Projektanträgen auf Erfüllung der Programmvoraussetzungen, das Controlling und Monitoring von Mitteleinsatz und -abfluss, die Verteilung der Mittel analog einer laufzeitbezogenen »Gebietsquotierung «, die Anleitung und Begleitung von Fachkräften des »lokalen Managements « bei der Programmumsetzung, die ressortübergreifende Programmdokumentation sowie die Geschäftsführung der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe »WiN«. Die Geschäftsführung ist außerdem Informations- und Anlaufstelle für lokale und lokal arbeitende Akteure.
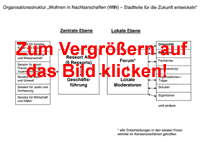 |
Organisationsstruktur "Wohnen in Nachbarschaften (WiN) - Stadtteile für die Zukunft entwicklen" |
2. Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der federführenden Senatoren sowie der Senatoren für Inneres, Kultur und Sport, für Bildung und Wissenschaft, für Justiz und Verfassung, für Wirtschaft und Häfen sowie der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau stimmt über Projektanträge aus den zehn »WiN/Soziale Stadt«-Gebieten ab, vergibt Finanzierungszuschüsse aus dem Programm »WiN/Soziale Stadt« gemäß Vorlagen der Geschäftsführung »WiN/Soziale Stadt« und ist damit oberstes Lenkungsorgan für die Programmabwicklung.
3. Die Steuerungsrunde »WiN/Soziale Stadt« bereitet unter anderem Beschlussvorlagen in Grundsatzangelegenheiten und im Hinblick auf die Lenkungsfunktion der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe vor.
Intermediärer Bereich
Für Quartiermanagement-Funktionen im intermediären Bereich zwischen Politik, Verwaltung, Markt, Drittem Sektor und »Zivilgesellschaft« ist im Januar 2002 in Gröpelingen (»Fokusgebiet«) analog zu den anderen neun »WiN«-Gebieten ein »Bürgerforum« unter Leitung eines »lokalen Managers« als Diskussions- und Beteiligungsgremium eingerichtet worden.
 |
Anlaufstelle im »Fokusgebiet« - Das Gemeinschaftshaus Stuhmer Straße (Bildquelle: Foto-Studio Penz GmbH, Bremen) |
Lokale Umsetzungsebene
Auf der Programmumsetzungsebene des Modellgebiets mit seinen unterschiedlichen Quartieren finden sich verschiedene soziale Einrichtungen und Projekte, von denen allerdings bis vor kurzem keines die Aufgaben eines lokalen Quartiermanagements übernommen hat. Dies änderte sich Anfang 2002 mit der Einrichtung des »lokalen Managements«, das die Vor-Ort-Arbeit vor allem im »Fokusgebiet« intensivieren und vernetzen sowie die verschiedenen zum Einsatz kommenden Förderprogramme auf der Umsetzungsebene zusammenführen soll.
6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
Beteiligungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung und andere Stadtteilakteure sind bisher überwiegend im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen und der Umsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN in Teilgebieten Gröpelingens geschaffen worden. Partizipation erfolgte daher in erster Linie projektund maßnahmenbezogen in zeitlich und inhaltlich klar definierten Bereichen. Darüber hinaus lagen Beteiligungsmöglichkeiten bis Ende 2001 fast ausschließlich auf der politischen Ebene, d.h., sie wurden durch die gewählten Stadtteilbeiratsmitglieder wahrgenommen. Seit Januar 2002 werden im »Fokusgebiet« lokale Foren veranstaltet, in denen vor allem die Quartiersbevölkerung zusammenkommt und unter anderem über Anträge auf »WiN/Soziale Stadt«-Mittel berät.
Aktivierungsstrategien richten sich im Rahmen einzelner Maßnahmen und Projekte verschiedener Programme - und damit innerhalb begrenzter (Zeit-)Räume - an bestimmte Zielgruppen (Mädchen, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Arbeitslose). Ebenfalls projektspezifisch - beispielsweise zur Wohnumfeldverbesserung - wird versucht, mit gezielten Maßnahmen unterschiedliche Personengruppen anzusprechen und sie für eine Zusammenarbeit in ihrem Quartier zu gewinnen. Die Erreichbarkeit der Bevölkerung, insbesondere von Migrantinnen und Migranten, wird allerdings als insgesamt unzureichend bewertet.
Mit dem Aktionsprogramm »Wir für Gröpelingen« wird das Zusammenleben im Modellgebiet besonders gefördert, indem Mittel für die Durchführung von bürgerschaftlich initiierten Maßnahmen vergleichsweise formlos zur Verfügung gestellt werden. Das Programm gewinnt damit den Charakter eines Verfügungsfonds, der zwar in anderen Bremer »WiN«-Gebieten, nicht aber in Gröpelingen eingerichtet worden ist.
 |
Bremen - Gröpelingen Kinderfest im Streichelzoo (Bildquelle: Kay Borchers, Bremen) |
Im Modellgebiet Gröpelingen gibt es viele gebietsbezogene Ansätze der Öffentlichkeitsarbeit: Eine Internetseite (www.groepelingen.de) sowie verschiedene Stadtteilzeitungen bieten Informationen zu Förderprogrammen und Projektfortschritten, Veranstaltungen, Beratungsangeboten, zur Stadtteilgeschichte und zum interkulturellen Zusammenleben. In einem Branchenführer stellen sich Einzelhandel, Dienstleistungen, Einrichtungen, Vereine und Initiativen vor. Mittels der seit drei Jahren laufenden Imagekampagne »Gröpelingen macht sich!« konnte ein Gemeinschaftsgefühl im Sinne einer »Corporate Identity« insbesondere bei Einzelhändlern und Dienstleistern im Modellgebiet aufgebaut werden. Bislang existiert für Gröpelingen allerdings noch kein Gesamtkonzept für eine modellgebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit.
7. Fazit: »Gröpelingen macht sich - weiter so!« 
Bereits vor dem Start des Programms »Soziale Stadt« sind in Gröpelingen vielfältige Unterstützungsstrukturen aufgebaut, verschiedene Förderprogramme eingesetzt sowie Projekte und Maßnahmen erfolgreich durchgeführt worden. Als weitere Stufe der Entwicklung kann die Ausweisung des besonders benachteiligten »Fokusgebiets« im Nordosten des Modellgebiets betrachtet werden.
Im Rahmen des Programms »WiN/Soziale Stadt« sind Ziele und Handlungsfelder für Gröpelingen ausgearbeitet worden, allerdings fehlt zurzeit noch ein übergeordnetes, unter Beteiligung lokaler und lokal wirksamer Akteure erarbeitetes Integriertes Handlungskonzept, aus dem dezidierte Entwicklungsstrategien für das Modellgebiet, Projekt- und Maßnahmenvorschläge, ein Finanzierungsplan sowie der Aufbau einer für die Umsetzung notwendigen Organisations- und Managementstruktur hervorgehen. Derzeit basiert der integrative Aspekt der Programmkulisse auf den für das kommunale Förderprogramm »Wohnen in Nachbarschaften (WiN) - Stadtteile für die Zukunft entwickeln« erarbeiteten Leitlinien inklusive sechs integrierter Handlungsfelder sowie auf Akteurskontakten insbesondere im Rahmen der Steuerung der verschiedenen lokal wirksamen Förderprogramme.
Die bisherigen Organisations- und Managementstrukturen zur Programmumsetzung »WiN/Soziale Stadt« sind auf der Verwaltungsebene stark, im intermediären Bereich und vor Ort dagegen eher schwach entwickelt. Nach Öffnung und thematischer Erweiterung der Stadtteilbeiratssitzungen sowie der Einrichtung eines lokalen Managements im Fokusgebiet bleibt abzuwarten, ob sich hierdurch das organisatorische Gewicht der Quartiersentwicklung auf die Umsetzungsebene vor Ort verlagert. Insbesondere für eine stärkere und vor allem kontinuierliche Aktivierung und Beteiligung der Quartiersbevölkerung sollten nach Einschätzung der Programmbegleitung-vor-Ort (Difu-Team) die projektunspezifische Arbeit vor Ort erweitert sowie offene Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden, wie sie in den anderen Bremer »WiN«-Gebieten bereits zu finden sind.
Die modellgebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit weist viele Elemente auf, ist in Teilen allerdings noch verbesserungswürdig. Insgesamt fehlt im Rahmen der Programme WiN und Soziale Stadt eine gebündelte Öffentlichkeitsarbeit, die das Augenmerk - beispielsweise unter Verwendung von (mehrsprachigen) Flyern und Plakaten - noch stärker als bisher auf die unterschiedlichen Belange des Gebiets lenkt oder lokale Akteure stärker zu Wort kommen lässt. Ein Orientierungsrahmen für ein solches Konzept könnte die intensive Öffentlichkeitsarbeit sein, die - wenn auch überwiegend »top down« initiiert - im Zuge der Sanierung und der Umsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN in Teilbereichen des Modellgebiets geleistet wurde.
Aus Sicht der Programmbegleitung-vor-Ort sollten identitätsstiftende Maßnahmen wie die Imagekampagne für die lokalen Einzelhändler und Dienstleister auch auf andere Akteurskreise sowie die lokale Bevölkerung ausgeweitet werden, um die bisherigen positiven Entwicklungen noch stärker in der Innen- und Außenwahrnehmung des Gebiets zu verankern.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005