soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
4.2 Bausteine und Handlungsfelder
Trotz der großen Bedeutung, die Bund und Länder dem Integrierten Handlungskonzept beimessen, zeigt die Umsetzung des Programms Soziale Stadt, dass sowohl im Hinblick auf die Erarbeitung als auch auf die Fortschreibung weiterhin Unsicherheit besteht. So wurden bis Mitte des Jahres 2002 erst für elf der 16 Modellgebiete Integrierte Handlungskonzepte erarbeitet (1) . Darunter bildet Hannover mit einem bereits 1997 im Rahmen der vorlaufenden Sanierung aufgestellten "Aktionsprogramm integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost", das in ein "gesamtstädtisches Zielkonzept gegen zunehmende sozialräumliche Segregation" eingebunden ist, einen Sonderfall (2) .
Anstelle von neu entwickelten Integrierten Handlungskonzepten kommen in den anderen Modellgebieten noch eher städtebaulich ausgerichtete Rahmenpläne zum Tragen (beispielsweise in den Modellgebieten Leinefelde - Südstadt, Nürnberg - Galgenhof/Steinbühl, Schwerin - Neu Zippendorf), die in Einzelfällen um Elemente integrierter Ansätze ergänzt wurden. Etwas differenzierter wurde für Halle - Silberhöhe vorgegangen; dort gibt es die "Entwicklungskonzeption Halle-Silberhöhe - Städtebauliches Leitbild unter dem besonderen Aspekt des Überangebotes an Wohnraum" als Konzept "aus städtebaulicher und wohnungswirtschaftlicher Sicht" sowie das "Handlungskonzept zum URBAN-21-Antrag" als "sozialverträgliche Begleitung des städtebaulichen Umstrukturierungsprozesses" (3) .
In der bundesweiten Befragung wird für 63 Prozent der Programmgebiete (141 Gebiete) angegeben, dass ein Integriertes Handlungskonzept bereits vorliegt, und für weitere 21 Prozent (46 Gebiete), dass ein entsprechendes Konzept erarbeitet wird. Diese zusammen 187 Programmgebiete stellen für die Auswertung der Befragung die differenzierte Grundgesamtheit dar, auf die Fragen zu Details der Integrierten Handlungskonzepte bezogen sind. Für doch immerhin 13 Prozent (29 Gebiete) wird das Vorhandensein eines Integrierten Handlungskonzepts verneint.
Im Vergleich der Bundesländer fällt auf, dass in sieben Ländern für alle ihre Gebiete Integrierte Handlungskonzepte entweder bereits vorliegen oder in Arbeit sind: Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Die Angaben für die Programmgebiete in drei Bundesländern lassen auf größere Zurückhaltung schließen: Für zehn der insgesamt elf Gebiete in Bremen wird mit "nein" geantwortet, für das elfte keine Angabe gemacht; auch für gut ein Drittel der 15 rheinland-pfälzischen Programmgebiete spielen die Integrierten Handlungskonzepte offenbar keine Rolle; außerdem bleiben die Befragungsergebnisse in diesem Punkt auch für Berlin unklar, wo ebenfalls für gut ein Drittel der 14 erfassten Gebiete ein Integriertes Handlungskonzept verneint wird oder keine Angabe erfolgt ist.
Über die Qualität der Konzepte ist mit diesen Angaben noch keinerlei Aussage möglich. Einschätzungen dazu können erst unter Berücksichtigung der Antworten zu den Bausteinen und Handlungsfeldern der Integrierten Handlungskonzepte vorgenommen werden.
![]() Bausteine Integrierter Handlungskonzepte
Bausteine Integrierter Handlungskonzepte
Aus Erfahrungen mit der Programmbegleitung vor Ort in den Modellgebieten, Anforderungen der Länder, vorliegenden Integrierten Handlungskonzepten und aus vielen Fachdiskussionen lassen sich mehrere Bausteine ableiten, die als Fundament für einen leistungsfähigen Einsatz des Instruments Integriertes Handlungskonzept dienen können. Diese Bausteine sind nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen, da Integrierte Handlungskonzepte unter anderem dadurch charakterisiert sind, dass verschiedene Prozesse parallel ablaufen. Es geht um Gleichzeitigkeit beispielsweise von Zielformulierung und Realisierung erster Projekte, um ein wechselwirkendes und sich ständig erneuerndes System, wozu auch die Fortschreibungen beitragen sollen. Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen, dem Land mit der bislang längsten Tradition integrierter Stadtteilentwicklung, haben deutlich die Notwendigkeit gezeigt, gleichzeitig einerseits Ziele und Leitvorstellungen weiterzuentwickeln und andererseits Teilschritte bereits umzusetzen. Insbesondere so genannte Schlüssel- oder Leitprojekte können Impulse geben und damit die Beteiligungsmotivation im Quartier erhöhen sowie zur Identitätsentwicklung und Imageverbesserung beitragen.
Die Bausteine können je nach spezifischer Situation in den Programmgebieten unterschiedliche Ausprägungen haben. Deshalb sind sie nicht als fest gefügte Konzeptstruktur zu verstehen, sondern als Merkposten für Fragen, die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts erläutert und geklärt werden sollten (4):
Im Bereich der Identifizierung von Problemen und Potenzialen sowie der Klärung von Handlungsbedarfen und damit der Analyse der Ausgangssituation geht es in den Integrierten Handlungskonzepten um die folgenden Teilschritte:
- Zusammenführung bereits vorhandener Untersuchungsergebnisse, Entwicklungsprogramme, Planungen und Maßnahmen aller wichtigen Handlungsfelder sowie Bestandsaufnahme von Initiativen und Aktivitäten im Quartier: Die Integrierten Handlungskonzepte können in vielen Fällen auf Untersuchungen oder Planungen aus Vorlauf-Aktivitäten aufbauen. So liegen beispielsweise für 80 Programmgebiete Vorbereitende Untersuchungen vor.
- Begründung der Auswahl und Abgrenzung des Gebiets (bei 76 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts), Analyse seiner gesamtstädtischen Bedeutung und Funktion (5) : Für das Antragsverfahren ist im Vergleich mit der gesamtstädtischen Situation der Nachweis des "besonderen Entwicklungsbedarfs" zu führen. Dieser setzt eine entsprechende Datenlage und Untersuchungen voraus, die häufig in den Städten und Gemeinden noch nicht vorhanden sind. Er kann zum Anlass genommen werden, Monitoringsysteme aufzubauen, die dann auch für die Evaluierung der Programmumsetzung genutzt werden können.
- Benennung der zentralen Problemfelder und Entwicklungspotenziale auf Basis einer Strukturanalyse (bei 93 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts): Mit der Analyse von Stärken und Schwächen des Stadtteils wird ermittelt, welche zentralen Probleme vorrangig zu lösen sind und auf welche Potenziale und Ressourcen dabei im Gebiet gebaut werden kann.
Im Bereich der Formulierung von Leitvorstellungen oder Leitbildern und von Zielen sowie den daraus abgeleiteten Maßnahmen und Projekten zeigen sich besondere Schwierigkeiten, die in der Forderung einerseits nach Konkretisierung der Ziele und andererseits nach Klärung der jeweiligen Lösungskapazität von Projekten und Maßnahmen münden. Während im ARGEBAU-Leitfaden als bundesweite Geltung beanspruchendem Strategiepapier die Ziele auf einer allgemeinen Ebene bleiben müssen (etwa wenn als Ziel formuliert wird, "soziale Problemgebiete zu selbständig lebensfähigen Stadtteilen mit positiver Zukunftsperspektive zu machen" (6) ), geht es für die Programmgebiete darum, die allgemeinen Ziele vor dem Hintergrund der realen Gebietssituation zu operationalisieren. Konkret und nachvollziehbar werden die Ziele in der Regel erst, wenn gleichzeitig Strategien, Maßnahmen und Projekte entwickelt werden, mit denen diese Ziele erreicht werden können. Häufig sind die Ziele im Umkehrschluss zu den Problemen formuliert.
- Formulierung eines Leitbildes für die Stadtteilentwicklung, Vernetzung und Operationalisierung von Zielen verschiedener Handlungsfelder (bei 96 Prozent der Programmgebiete sind "Leitlinien, Entwicklungsziele" Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts): Auf Basis von Ergebnissen der Stärken- und Schwächenanalyse sowie dem Aufspüren von Ressourcen lassen sich Zielvorstellungen für die Zukunft des Stadtteils erarbeiten. Dabei geht es auch um die Festlegung von zentralen Leit- und Oberzielen sowie die Definition spezifischer Entwicklungsziele für die einzelnen Handlungsfelder. Als hilfreich erweist sich dabei auch die Berücksichtigung von Zielhierarchien und absehbaren Zielkonflikten.
- Einbindung der Entwicklungsziele für den Stadtteil in das gesamtstädtische Entwicklungskonzept: Erfolg bei der Umsetzung des Programms Soziale Stadt hängt unter anderem auch davon ab, inwieweit es gelingt, gebietsbezogene Maßnahmen, Projekte, Verfahren und Strategien programmatisch mit der gesamtstädtischen Entwicklungspolitik zu verknüpfen und die gesamtstädtischen Wirkungszusammenhänge nicht aus dem Blick zu verlieren. Die gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzepte brauchen die Einbindung in gesamtstädtische Konzepte, damit ausgeschlossen werden kann, dass problematische Entwicklungen nur sozialräumlich verschoben werden oder dass quartiersbezogenen Strategien durch übergeordnete Politiken entgegengewirkt wird. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Wohnungs- und Infrastrukturpolitik.
- Darstellung von Strategien, Maßnahmen und Projekten (bei 99 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts) mit Angabe von Trägern, Adressaten, Finanzierung, Zeitplan der Umsetzung usw.: Um dem integrativen Anspruch des Konzepts gerecht zu werden, sind in diesem Zusammenhang die vielfältigen Handlungsfelder einer integrierten Stadtteilentwicklung zu berücksichtigen. Dabei kommt Mehrzielprojekten, bei denen der integrative Gehalt bereits im Projekt verankert ist, eine besondere Rolle zu.
Ein weiterer wichtiger Komplex, der bei den Integrierten Handlungskonzepten bisher noch häufig vernachlässigt bleibt, betrifft Überlegungen zur Umsetzungsprogrammatik und zur Bündelung möglicher Finanzierungsquellen und damit die eher instrumentelle Zieldimension des Programms (Modernisierung des politischen und administrativen Handelns sowie Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte). Unter den Leitthemen Vernetzung, Koordination und Kooperation stehen die folgenden Bausteine des Integrierten Handlungskonzepts:
- Angaben zur Organisation und zur Projektsteuerung sowie zum Management (bei 76 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts): Dies betrifft Vorschläge zum Aufbau von Organisationsstrukturen mit lokalem Quartiermanagement, Lenkungs- oder Steuerungsgruppen, ressort- und ämterübergreifender Organisation, Stadtteilforen usw. und schließt auch die Regelung von Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnissen sowie horizontale und vertikale Vernetzungsstrukturen ein.
- Strategien zur Aktivierung und Beteiligung (bei 73 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts) von Quartiersbevölkerung und Stadtteilakteuren: Hier ist zu klären, wie und durch wen direkte Ansprache erfolgt, inwieweit Entscheidungsstrukturen dezentralisiert (Quartierbudgets, Verfügungsfonds) und welche Strategien der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden sollen.
- Kosten- und Finanzierungsübersicht mit geschätzten Gesamtkosten und Finanzierungsplan (bei 69 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts) sowie Angaben zum Zeitablauf und Umsetzungsplan (bei 62 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts): Dabei ist das gesamte Spektrum von Finanzierungsmöglichkeiten zu berücksichtigen, das von öffentlichen Fördermitteln (Kommune, Bund, Land, Europäische Union) über private Mittel (im Rahmen von privaten Investitionen, öffentlich-privaten Partnerschaften, Sponsoring, Spenden und Stiftungen) bis zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln reicht.
Die Evaluierung der Programmumsetzung (7) gilt als "unabdingbarer Bestandteil der Integrierten Handlungskonzepte" - so ist es im ARGEBAU-Leitfaden ausgeführt. Damit ist der Bereich Umsetzungs- und Qualitätskontrolle angesprochen. Es erscheint nötig, sich kontinuierlich im gebietsöffentlichen Diskurs über Erfolg, Misserfolg und Änderungsbedarf zu verständigen und damit die Konzepte - quasi als lernende Systeme mit lernenden Akteuren - an gewandelte Bedingungen anzupassen. Zu diesem Komplex gehören die folgenden Bausteine:
- Konzept für eine begleitende Prozessevaluierung und Vorbereitung der Ergebnisevaluierung (bei 30 Prozent der Programmgebiete Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts): In diesem Zusammenhang geht es besonders darum, die Fragen zu präzisieren, die mit der Evaluation beantwortet werden sollen. Geht es beispielsweise um die Analyse von "Gebiets-Effekten" oder um die von "Governance-Effekten" oder um beides? (8) Im Zuge von Erfahrungsaustausch lassen sich Qualitätsansprüche und Qualitätskriterien vergleichen und begründet einschätzen. Hier kommt insbesondere den Ländern eine zentrale Rolle zu.
- Monitoring als Aufbau einer kontinuierlichen kleinräumigen differenzierten Sozialberichterstattung: Gebietsauswahl aufgrund des Kriteriums "besonderer Entwicklungsbedarf" der Stadtteile und Evaluation der Programmumsetzung sind auf eine ergiebige Datenlage oder den Auf- und Ausbau entsprechender Beobachtungssysteme angewiesen.
- Entwicklung von Verstetigungsstrategien: Die Situation in Programmgebieten, in denen die Förderung absehbar ausläuft (9) , zeigt, wie nötig es ist, die längerfristige Tragfähigkeit von Maßnahmen und Projekten in den Konzepten stärker zu berücksichtigen.
|
Abbildung 31: Bausteine der Integrierten Handlungsprogramme (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
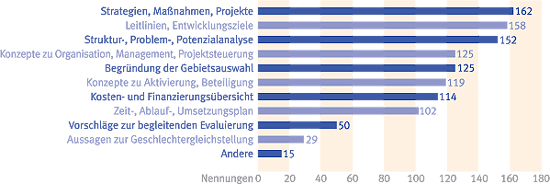 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Bei den 164 Programmgebieten, für die Angaben zu den Bausteinen ihrer Integrierten Handlungskonzepte gemacht wurden, dominieren als Konzeptbestandteile Aussagen zu Strategien, Maßnahmen und Projekten, zu Leitlinien und Entwicklungszielen sowie Struktur-, Problem- und Potenzialanalysen. Jeweils für etwa drei Viertel der Konzepte sind außerdem noch die Begründung der Gebietsauswahl, Konzepte zu Organisation, Management und Projektsteuerung sowie zu Aktivierung und Beteiligung vorhanden. Auch eine Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie Zeit-, Ablauf- und Umsetzungsplan sind im Großteil der Konzepte enthalten. Lücken werden bisher noch bei den Vorschlägen zur begleitenden Evaluierung sichtbar. Das Schlusslicht bilden Aussagen zur Geschlechtergleichstellung (Gender Mainstreaming), die bisher nur in Hamburg bei allen vier Konzepten sowie bei einigen Konzepten in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz thematisiert wird. In deutlich mehr als einem Drittel der Gebiete, in denen ein Integriertes Konzept vorhanden ist oder erarbeitet wird (56 Programmgebiete), sind diese Konzepte sehr umfassend angelegt. Sie enthalten alle Bausteine mit Ausnahme von Gender Mainstreaming und Evaluation.
![]() In die Konzepte einbezogene Handlungsfelder
In die Konzepte einbezogene Handlungsfelder
Die Antworten auf die Frage nach den in die Konzepte einbezogenen Handlungsfeldern lassen erste Rückschlüsse auf den integrativen Gehalt der Konzepte zu. Inwieweit werden die Konzepte dem Anspruch gerecht, gebietsbezogen baulichräumliche mit sozialen, ökonomischen, kulturellen, ökologischen usw. Ansätzen in Maßnahmen und Projekten zu verknüpfen - beispielsweise durch die Vernetzung von traditionellen Wohnumfeldmaßnahmen mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsprojekten oder Kooperationen/Partnerschaften zwischen Schulen und lokalen Wirtschaftsunternehmen?
Die Befragungsergebnisse stimmen erst einmal optimistisch. Für fast 90 Prozent der Integrierten Handlungskonzepte (146 Programmgebiete) wird die Berücksichtigung von zehn und mehr Handlungsfeldern gemeldet. Inwieweit hier tatsächlich auch Vernetzungen konzipiert sind, entzieht sich auf Basis der Befragungsdaten der Auswertungsmöglichkeit. Tatsächlich wird vor allem von den Ländern beklagt, dass die Handlungsfelder in den Konzepten manchmal isoliert nebeneinander stehen (10) . Vorausgesetzt es kommt bei der Umsetzung der Integrierten Handlungskonzepte auch zur wirklichen Vernetzung der Handlungsfelder und Realisierung von gebietsbezogen mehrzielorientierten Maßnahmen und Projekten, ließe sich auf eine Erfüllung des Anspruchs "integrativ" schließen.
|
Tabelle 7: In die Integrierten Konzepte einbezogene und besonders wichtige Handlungsfelder (n=187; Zweite Befragung Difu 2002) |
||||||
|
Handlungsfeld |
einbezogen |
besonders wichtig |
||||
|
abs. |
% |
Rang |
abs. |
% |
Rang |
|
|
Wohnumfeld und öffentlicher Raum (Sicherheit) |
155 |
82,9 |
1 |
83 |
44,4 |
2 |
|
Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur |
153 |
81,8 |
2 |
88 |
47,0 |
1 |
|
Image und Öffentlichkeitsarbeit |
148 |
79,1 |
3 |
65 |
34,7 |
5 |
|
Kinder- und Jugendhilfe |
147 |
78,6 |
4 |
67 |
35,8 |
4 |
|
Sport und Freizeit |
142 |
75,9 |
5 |
32 |
17,1 |
11 |
|
Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen |
140 |
74,9 |
6 |
79 |
42,2 |
3 |
|
Schulen und Bildung im Stadtteil |
137 |
73,3 |
7 |
60 |
32,1 |
6 |
|
Beschäftigung |
135 |
72,2 |
8/9 |
51 |
27,3 |
9 |
|
Stadtteilkultur |
135 |
72,2 |
8/9 |
44 |
23,5 |
10 |
|
Verkehr |
131 |
70,0 |
10 |
23 |
12,3 |
13 |
|
Qualifizierung und Ausbildung |
130 |
69,5 |
11 |
59 |
31,5 |
7 |
|
Lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft |
126 |
67,4 |
12 |
55 |
29,4 |
8 |
|
Familienhilfe |
107 |
57,2 |
13 |
15 |
8,0 |
16/17 |
|
Umwelt |
106 |
56,7 |
14 |
15 |
8,0 |
16/17 |
|
Seniorenhilfe |
104 |
55,6 |
15 |
17 |
9,1 |
15 |
|
Wertschöpfung im Gebiet |
87 |
46,5 |
16 |
21 |
11,2 |
14 |
|
Befähigung, Artikulation und politische Partizipation |
77 |
41,2 |
17 |
27 |
14,4 |
12 |
|
Gesundheit |
73 |
39,0 |
18 |
7 |
3,7 |
19/20 |
|
Prozess- und Ergebnisevaluation |
63 |
33,7 |
19 |
9 |
4,8 |
18 |
|
Monitoring |
49 |
26,2 |
20 |
7 |
3,7 |
19/20 |
|
Anderes |
10 |
5,3 |
21 |
6 |
3,2 |
21 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||||||
Aus Tabelle 7 lässt sich nicht nur erkennen, wie häufig die einzelnen Handlungsfelder in die Konzepte einbezogen sind; deutlich wird auch, dass es von dieser Rangfolge leichte Abweichungen gibt, wenn es um die Beantwortung der Frage nach den jeweils fünf als besonders wichtig erachteten Handlungsfeldern geht.
(1) Dabei werden mehrere Konzepte den Anforderungen hinsichtlich Leitbild-Entwicklung, Beteiligung und Einbindung in gesamtstädtische Konzepte nur ansatzweise gerecht. So hat beispielsweise das Integrierte Handlungskonzept für das Modellgebiet Berlin-Kreuzberg - Kottbusser Tor eher den "Charakter eines Rechenschaftsberichts gegenüber der Verwaltung ... weniger den einer zielorientierten Gesamtbilanz"; Beer/Musch, "Stadtteile ...", S. 83. ![]()
(2) Aus Sicht des PvO-Teams ein "ambitioniertes und komplexes Konzept" mit "hochgesteckten" Zielen (Geiling und andere, Begleitende Dokumentation, S. 97 und S. 112). ![]()
(3) Stefan Geiss, Julia Kemper und Marie-Therese Krings-Heckemeier, Programmbegleitung des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt" - Modellgebiet "Halle-Silberhöhe", Sachsen-Anhalt. Endbericht, Berlin 2002, S. 36. ![]()
(4) Die Grundgesamtheit stellen im Folgenden die 187 Programmgebiete dar, für die ein Integriertes Handlungskonzept bereits vorliegt oder erarbeitet wird. Dabei konnten aber offenbar hinsichtlich mehrerer (23) der in Arbeit befindlichen Konzepte noch keine Angaben zu den Bausteinen gemacht werden. Alle Prozentangaben in den folgenden Abschnitten beziehen sich daher auf die 164 Programmgebiete (74 Prozent aller von der Befragung erfassten Gebiete), für die entsprechende Angaben gemacht werden konnten. ![]()
(6) ARGEBAU-Leitfaden, Kapitel 3, 1. Abs, siehe Anhang 9. ![]()
(7) Vgl. dazu weiter Kapitel 9. ![]()
(8) Dazu Uwe-Jens Walther, Gesichtspunkte zu einer Evaluation des Programms Soziale Stadt. Papier für die konstituierende Sitzung der Expertenkommission am 11. September 2002 in Berlin (unveröffentlichtes Typoskript). ![]()
(9) Dies trifft gegenwärtig vor allem für die 35 nordrhein-westfälischen Programmgebiete zu, die aus dem Landesprogramm "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" nur bis zum Durchführungsende der Maßnahmen in das Programm Soziale Stadt übergeleitet wurden. ![]()
(10) Hierzu beispielsweise Anmerkungen von Andreas Distler im Rahmen des Podiumsgesprächs "Qualitätsstandards für leistungsfähige Integrierte Handlungskonzepte", abgedruckt in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Integratives Handeln, S. 235. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005