soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
2.1 Aufbau eines bundesweiten Netzwerks
Wegen des hohen Bedarfs an Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit zum neuen Programm stand der Aufbau eines bundesweiten Netzwerks im Mittelpunkt der ersten Arbeitsschritte. Es wird von mehreren Säulen getragen: von zentralen und dezentralen Veranstaltungen, einem kontinuierlichen Berichtswesen, dem Internet-Forum zur Sozialen Stadt sowie zahlreichen Informations- und Kooperationsgesprächen mit Einrichtungen, Verbänden, kommunalen Dienststellen, der ARGEBAU und anderen. In den bundesweiten Erfahrungsaustausch sind nicht nur alle Städte und Gemeinden einbezogen, die sich mit quartiersbezogenen integrierten Handlungsansätzen befassen, sondern auch die URBAN-Städte sowie die EFRE-Fördergebiete "Erneuerung von innerstädtischen Problemgebieten" (Ziel-1 und Ziel-2).
![]() Zentrale und dezentrale Veranstaltungen
Zentrale und dezentrale Veranstaltungen
Bundesweite (zentrale) Veranstaltungen dienten als Informations- und Diskussionsplattform für alle am Programm Interessierten und Beteiligten. Diese vom BMVBW und dem Difu durchgeführten Veranstaltungen wurden im Rahmen der Veröffentlichungsreihe "Arbeitspapiere zur Sozialen Stadt" dokumentiert (1) :
- Auftaktveranstaltung am 5. Juli 1999 im Schöneberger Rathaus in Berlin nach Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum neu aufgelegten Programm Soziale Stadt (mit fast 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern): Hier wurde das neue Programm durch das BMVBWvorgestellt. Nationale Erfahrungsberichte zu vergleichbaren integrativen Ansätzen der Stadtteilentwicklung aus Großbritannien und den Niederlanden machten vor allem deutlich, dass die Umsetzung eines so ambitionierten Programms großes Engagement und einen langen Atem - auch bei der Politik - voraussetzt.
- Starterkonferenz am 1. und 2. März 2000 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin (mit mehr als 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern): Nach einer Präsentation der Partnerschaftsprogramme "Soziale Stadt" sowie "Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten" (E & C) durch Bundesbauminister Reinhard Klimmt und Bundesfamilienministerin Christine Bergmann standen erste Erfahrungsberichte aus den 16 Modellgebieten der Sozialen Stadt im Mittelpunkt. Dabei ging es vor allem um die zentralen strategisch ausgerichteten Themenbereiche des Programms: Bündelung der Ressourcen, Management und Organisation sowie Aktivierung und Beteiligung.
- Zwischenbilanz-Kongress "Die Soziale Stadt - Zusammenhalt, Sicherheit, Zukunft" am 7. und 8. Mai 2002 in der "Arena" in Berlin-Treptow (mit mehr als 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern): Im Mittelpunkt stand ein erstes Resümee der Erfahrungen mit dem Programm Soziale Stadt. Dabei wurde von vielen Referentinnen und Referenten sowie den Mitwirkenden an den Podiumsdiskussionen - auch vom Bundeskanzler - betont, dass die Entwicklung der benachteiligten Stadtteile Testfälle für die Stadt der Zukunft darstelle. Mit längerfristiger Perspektive (vor allem Sicherung des Bestands von Projekten und des Engagements aller Akteure) sei es erforderlich, Verfügungsmöglichkeiten über Ressourcen und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen sowie das ressortübergreifende und gebietsorientierte Verwaltungshandeln zu stärken.
 |
Abbildung 2: |
Darüber hinaus waren zwei bundesweite Impulskongresse als Arbeitsveranstaltungen angelegt, bei denen weniger Vorträge als vielmehr der Erfahrungsaustausch in einer Vielzahl von Arbeitsgruppen im Vordergrund standen:
- Impulskongress "Quartiermanagement" am 26. und 27. Oktober 2000 in "Werk II" in Leipzig (mit etwa 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern): In drei Podiums- und 13 Arbeitsgruppengesprächen ging es um ein breites Themenspektrum, das die Vielfalt der Aufgaben des Quartiermanagements widerspiegelt (Arbeitsgruppenthemen waren beispielsweise "Zusammenarbeit der Akteure", "Aktivierung der Bevölkerung", "Einbeziehung der örtlichen Politik", "Chancen und Probleme der Bündelung", "Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen", "Miteinander von Deutschen und Migranten", "Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft" usw.).
- Impulskongress "Integratives Handeln für die soziale Stadtteilentwicklung" (etwa 370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) am 5. und 6. November 2001 in der Zeche Zollverein in Essen: Zentrales Thema war der praktische Umgang mit den Integrierten Handlungskonzepten, die gemäß Verwaltungsvereinbarung und Leitfaden der ARGEBAU maßnahmebegleitend entwickelt und fortgeschrieben werden sollen. Neben Plenumsbeiträgen und Podiumsdiskussionen dienten vor allem insgesamt zwölf Arbeitsgruppen dazu, Einzelaspekte zu vertiefen, unter anderem zu den Themen "Bewohnerbeteiligung", "Qualitätskriterien für Integrierte Handlungskonzepte", "Ressort- und fachübergreifende Bündelung und Vernetzung", "Integriertes Handlungskonzept und Neues Steuerungsmodell", "Erfolgskontrolle und Monitoring". Insgesamt wurde eine noch große Unsicherheit über Inhalte und Verfahren bei der Aufstellung, Weiterentwicklung und Fortschreibung der Integrierten Handlungskonzepte sichtbar. Umgekehrt zeigte sich aber auch, dass in vielen Programmgebieten ernsthafte Anstrengungen unternommen werden, einen über die klassische Sanierung hinausgehenden breiteren Ansatz unter Beteiligung weiterer Akteure zu verfolgen.
 |
Abbildung 3: |
Neben den zentralen gab es eine Reihe von dezentralen Veranstaltungen, mit denen unter Beteiligung des Difu Informationen über das Programm und Umsetzungserfahrungen vermittelt und diskutiert wurden. Beispielsweise hat das Difu zwei bundesweite Netzwerke-Treffen veranstaltet, zu denen die bereits vorhandenen Länder-Netzwerke (in Hessen die "Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt - HEGISS" und das "Forum für ,Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf'" in Nordrhein-Westfalen) sowie solche Netzwerke eingeladen waren, die sich zu thematisch verwandten Politikbereichen gebildet haben. Das erste Treffen fand am 12. November 1999, das zweite am 5. Februar 2001 - jeweils in Berlin - statt. Während beim ersten Treffen das Kennenlernen der Netzwerke im Vordergrund stand, war das zweite als Austausch über die Handlungsfelder Jugend (erste Erfahrungen mit E & C) und Lokale Ökonomie angelegt. Daneben bestehen Kontakte zu übergreifenden Netzwerken, beispielsweise zum Netzwerkknoten "Quartiersmanagement" im Netzwerk "Kommunen der Zukunft" (der Bertelsmann Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung und KGSt) sowie zum URBAN-Netzwerk.
Unter Beteiligung des Difu fanden außerdem mehrere Regionale Veranstaltungen zur Einführung des Programms Soziale Stadt statt:
- am 15. und 16. November 2000 die zweiteilige Auftaktveranstaltung des Freistaates Bayern zum Programm Soziale Stadt im Rahmen der Initiative "Bayerische Innenstädte: attraktiv - lebenswert - unverwechselbar" in Nürnberg;
- am 23. November 2000 die saarländische Auftaktveranstaltung "Starterkonferenz: Erfahrungsaustausch im Saarland" in Völklingen;
- am 19. Dezember 2000 die erste Transferveranstaltung zum Programm Soziale Stadt in Mecklenburg-Vorpommern;
- am 12. Februar 2001 die Auftaktveranstaltung Rheinland-Pfalz zur Sozialen Stadt in Koblenz.
Darüber hinaus veranstaltete das Difu in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern mehrere Tagungen, um zum Handlungsfeld Integrative Stadtteilentwicklung zusätzliche Impulse für Kooperation und Erfahrungsaustausch zu geben:
- am 21. und 22. September 2000 zusammen mit dem Verein für Kommunalwissenschaften die Tagung "Sozialarbeit im sozialen Raum" zu Fragen der Sozialraumbildung aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin (2) ;
- am 10. und 11. Mai 2001 zusammen mit dem Verein für Kommunalwissenschaften und der Regiestelle E & C des Sozialpädagogischen Instituts (SPI) die Fachtagung "Auf dem Weg zur solidarischen Stadt - Kooperation von Stadtentwicklung und Jugendhilfe";
- am 2. und 3. Juli 2001 zusammen mit dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) und Viterra AG das Fachgespräch "Wirtschaften im Quartier - zur Rolle der Wohnungsunternehmen im Rahmen der integrierten Stadtteilerneuerung" in Bochum (3) ;
- am 30. November und 1. Dezember 2001 zusammen mit Gesundheit Berlin e.V. und anderen Veranstaltern den Kongress "Gesundheitsziele gegen Armut. Netzwerke für Menschen in schwierigen Lebenslagen" (6. Kongress Armut und Gesundheit) in Berlin (4) ;
- am 6. und 7. Dezember 2002 zusammen mit Gesundheit Berlin e.V. und anderen Veranstaltern den Kongress "Orte der Gesundheitsförderung. Die Gesundheitspotenziale von Menschen in schwierigen Lebenslagen stützen" (7. Kongress Armut und Gesundheit) in Berlin.
Außerdem diente ein Strategie-Workshop der Klärung, inwieweit und wie die Kooperation zwischen verschiedenen Interessengruppen zugunsten einer verbesserten Bündelung von Mitteln für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt optimiert werden kann (5) . Der Workshop "Ressourcenbündelung auf Bundes- und Landesebene" fand am 12. Dezember 2000 in Berlin statt. Eingeladen waren kommunale Vertreterinnen und Vertreter sowie die Städtebauförderungsreferentinnen und -referenten der Länder. Im Mittelpunkt stand der Austausch über Erfahrungen mit der Bündelung von finanziellen und personellen Mitteln.
![]() Berichtswesen zur Sozialen Stadt
Berichtswesen zur Sozialen Stadt
Die zweite Säule des bundesweiten Netzwerks wird durch den Ausbau eines kontinuierlichen Berichtswesens zur Sozialen Stadt gebildet. Dazu gibt das Difu mit den "Soziale Stadt infos" und den "Arbeitspapieren zum Programm Soziale Stadt" zwei Veröffentlichungsreihen heraus (6) . In einem etwa vierteljährlichen Rhythmus erscheint seit Juli 2000 der Newsletter "Soziale Stadt info". Er ist inzwischen regelmäßig einem thematischen Schwerpunkt der Sozialen Stadt gewidmet und enthält in der Regel neben einem Positionspapier des Difu und Praxisberichten zum jeweiligen Schwerpunktthema die Rubrik "Soziale Stadt - meine Sicht", mehrere Kurzberichte und Veranstaltungshinweise. Der Newsletter stößt auf großes Interesse und wurde inzwischen von mehr als 1300 Personen abonniert (7) .
|
Übersicht 1: Soziale Stadt infos |
||
|
Nr. |
Schwerpunktthema |
Auflagenhöhe |
|
Nr. 1 |
Ohne Schwerpunktthema |
6 400 |
|
Nr. 2 |
Schwerpunktthema Quartiermanagement |
2 400 |
|
Nr. 3 |
Ohne Schwerpunktthema |
2 050 |
|
Nr. 4 |
Ohne Schwerpunktthema |
1 950 |
|
Nr. 5 |
Schwerpunktthema Lokale Ökonomie |
2 000 |
|
Nr. 6 |
Schwerpunktthema Integrierte Handlungskonzepte |
4 700 |
|
Nr. 7 |
Schwerpunktthema Aktivierung und Beteiligung |
3 500 |
|
Nr. 8 |
Schwerpunktthema Zusammenleben im Stadtteil |
4 200 |
|
Nr. 9 |
Schwerpunktthema Ressourcenbündelung |
3 200 |
|
Nr. 10 |
Schwerpunktthema Kultur im Stadtteil |
2 500 |
|
Nr. 11 |
Schwerpunktthema Gesundheitsförderung |
2 500 |
|
Nr. 12 |
Schwerpunktthema Schule und Bildung |
2 700 |
|
Nr. 13 |
Schwerpunktthema Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit |
ca. 2 700 |
|
Nr. 14 |
Schwerpunktthema Internationale Erfahrungen |
ca. 2 700 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||
Die "Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt" erscheinen in unregelmäßigen Zeitabständen und dienen in erster Linie dazu, Veranstaltungen zu dokumentieren und Grundlagenpapiere publik zu machen.
|
Übersicht 2: Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt |
||
|
Band |
Titel |
Auflagenhöhe |
|
Vorbereitungspapiere zum Bund-Länder-Programm Stadtteile mit |
1 500 |
|
|
Auftaktveranstaltung zum Bund-Länder-Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf die Soziale Stadt. Beiträge der Referenten |
1 250 |
|
|
Programmgrundlagen |
2 100 |
|
|
Dokumentation der Starterkonferenz |
1 650 |
|
|
Impulskongress Quartiermanagement. Dokumentation |
1 300 |
|
|
Fachgespräch Wirtschaften im Quartier. Dokumentation |
1 200 |
|
|
Impulskongress Integratives Handeln für die soziale Stadtteilentwicklung. Dokumentation |
1 500 |
|
|
Kongress Die Soziale Stadt Zusammenhalt, Sicherheit, Zukunft. Dokumentation |
1 200 |
|
|
Good Practice in Neubauquartieren. Eine Analyse |
1 000 |
|
|
Good Practice in Altbau- und gemischten Quartieren. Eine Analyse |
1 000 |
|
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||
Zum bundesweiten Zwischenbilanz-Kongress Anfang Mai 2002 erschien ein Begleitbuch (8) mit Kurzberichten über Programmumsetzung und Erfahrungen in den 16 Modellgebieten, einem Querschnittsbeitrag "Drei Jahre Programm Soziale Stadt - eine ermutigende Zwischenbilanz", dem so genannten Transferpapier mit europäischen und amerikanischen Erfahrungen zur integrierten Stadtteilentwicklung sowie einem Beitrag zur Situation in den U.S.A. Der Querschnittsbeitrag wurde auch ins Englische übersetzt und als "Occasional Paper" (9) sowie im Internet- Forum veröffentlicht. Im Internet zugänglich sind auch die ins Englische übersetzten Kurzberichte über die 16 Modellgebiete.
Als dritte Säule des bundesweiten Netzwerks wurde das Internet-Forum im Januar 2000 online geschaltet (sozialestadt.de). Hier können Informationen zum Programm und zu verwandten Themen über das Programm hinaus, zu den Programmgebieten und zu Praxisbeispielen, zu Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Literatur sowie eine thematisch sortierte Linksammlung abgerufen werden. Darüber hinaus ist ein interaktives Diskussionsforum Bestandteil des Internetangebots. Diese Diskussionsplattform ist für alle Interessierten offen zugänglich gestaltet, um möglichst viele Akteure der Stadtteilarbeit zu ereichen und ihnen eine Beteiligung am Austauschprozess zu ermöglichen. Außerdem steht im Internet- Forum eine Freitextsuche zur Verfügung, mit der nach einzelnen Begriffen oder nach Begriffsverknüpfungen gesucht werden kann.
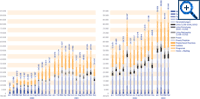 |
Abbildung 4: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Die Angebote und Inhalte des Internet-Forums werden ständig erweitert und fortgeschrieben. Ein "Meilenstein" in der Entwicklung des Internet-Forums war die Freischaltung der Projektdatenbank im Frühjahr 2001 (Menübereich Praxisbeispiele). Diese Datenbank enthält Informationen über Projekte und Maßnahmen, die für eine erfolgversprechende Programmumsetzung typisch und hilfreich sind - vorwiegend in den Gebieten des Programms Soziale Stadt. Die Datenbank wird unter anderem durch Hinweise der Akteure aus den Programmgebieten laufend aktualisiert und ergänzt. Im Frühjahr 2003 waren 250 Projekte in der Datenbank dokumentiert (10) . Zu den einzelnen Projekten finden sich hier jeweils die Zuordnung zu Handlungsfeldern, eine kurze Projektbeschreibung, Informationen zu Projektträgern und -beteiligten, zur Finanzierung und Laufzeit sowie Ansprechpartner und Veröffentlichungshinweise. Über ein Suchmenü kann der Datenbestand nach verschiedenen Merkmalen erschlossen werden (beispielsweise nach Handlungsfeldern, Zielgruppen, Finanzierungsarten, Bundesländern, Städten, Gebieten, Gebietstypen und Lage in der Stadt). Ferner ist im Internet-Forum eine Literaturdatenbank zum gesamten Themenspektrum des Programms Soziale Stadt abrufbar (Veröffentlichungen von Bund, Ländern, Städten und Programmgebieten sowie Arbeitshilfen, Forschungsberichte und Texte der verschiedensten Institutionen). Auch diese Datenbank wird ständig fortgeschrieben; sie enthielt im Frühjahr des Jahres 2003 insgesamt 688 Einträge (Stand März 2003).
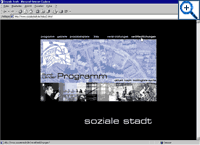 |
Abbildung 5: |
Dass sich das Internet-Forum als Säule des bundesweiten Netzwerks bewährt hat, zeigt sich unter anderem am kontinuierlichen Anstieg der inhaltlichen Abrufe. Der bisherige Höhepunkt wurde im Mai 2002 erreicht, als sich die Zahl der Abrufe gegenüber dem Vormonat um etwa 25 000 auf etwas mehr als 80 000 Abrufe erhöhte (11) . Von den einzelnen Menübereichen des Internet-Angebots sind die Rubriken "Veröffentlichungen" und "Gebiete" durchgängig am stärksten nachgefragt worden.
(1) Vgl. Übersicht 2. ![]()
(2) Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Hrsg.), Sozialarbeit im sozialen Raum. Dokumentation der Fachtagung am 21. und 22. September 2000 in Berlin, Berlin 2001 (Aktuelle Beiträge zur Kinderund Jugendhilfe, Bd. 27). ![]()
(3) Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Fachgespräch "Wirtschaften im Quartier". Dokumentation der Veranstaltung am 2. und 3. Juli 2001 in Bochum, Berlin 2002 (Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 6). ![]()
(4) Raimund Geene, Carola Gold und Christian Hans (Hrsg.), Armut und Gesundheit. Gesundheitsziele gegen Armut: Netzwerke für Menschen in schwierigen Lebenslagen, Berlin 2002 (Materialien für Gesundheitsförderung, Bd. 10). ![]()
(5) Ein ursprünglich zum Thema "Kooperation zwischen Stadtentwicklung und Arbeitsförderung" für November 2002 geplanter zweiter Workshop sollte gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeit und dem Berliner Beschäftigungsträger gsub durchgeführt werden. Er musste wegen der Umorientierungen der Bundesanstalt für Arbeit leider entfallen. ![]()
(6) Sie können auch im Internet abgerufen werden (sozialestadt.de). ![]()
(7) Der Standardverteiler enthält darüber hinaus etwa 700 Adressen (Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Programmgebiete auf kommunaler und gebietlicher Ebene). Die sehr unterschiedliche Auflagenhöhe ergibt sich aus der tatsächlichen Nachfrage nach den einzelnen Heften. ![]()
(8) Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Die Soziale Stadt. Eine erste Bilanz des Bund-Länder- Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt";, Berlin 2002. ![]()
(9) Heidede Becker, Thomas Franke, Rolf-Peter Löhr und Verena Rösner, Socially Integrative City Programme . An Encouraging Three-Year Appraisal, Berlin 2003 (Occasional Paper des Deutschen Instituts für Urbanistik). ![]()
(10) Vgl. die Liste der in der Projektdatenbank enthaltenen Projekte im Anhang 6. ![]()
(11) Dieser sprunghafte Anstieg kann als Effekt des Kongresses "Die Soziale Stadt - Zusammenhalt, Sicherheit, Zukunft" gewertet werden, der am 7. und 8. Mai 2002 in Berlin stattfand. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 06.04.2007