soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Ludwigshafen Westend |
|
|
Delia Schröder |
|
1. Gebietscharakter 
In Rheinland-Pfalz wurde als Modellgebiet für das Programm »Soziale Stadt« das Ludwigshafener Quartier Westend ausgewählt. In diesem rund 30 Hektar großen Gebiet in innerstädtischer Lage leben rund 4 000 Menschen. Das Westend hat eine multikulturelle Bevölkerung mit einem wachsenden Anteil von jungen Migrantinnen und Migranten. Vier von zehn Bewohnerinnen und Bewohnern sind nicht deutscher Herkunft; ihr Anteil ist in den Schulklassen noch höher. Wenngleich die Unter-18-Jährigen im Vergleich zur Gesamtstadt anteilig nur leicht überwiegen, geht der Trend seit einigen Jahren doch deutlich hin zu einer »Verjüngung« - insbesondere unter den Nichtdeutschen. Im Westend leben zunehmend mehr Kinder und Jugendliche. Ebenso sind Bevölkerungsgruppen hier besonders stark vertreten, deren Lebenssituation durch sozioökonomische Zwänge geprägt ist, wie z.B. Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, allein Erziehende, Arbeitslose. Kennzeichnend ist außerdem, dass die Fluktuation unter der Quartiersbewohnerschaft recht hoch ist.
 |
| (Bildquelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen, Stadtvermessung) |
Charakteristisch für das Westend ist die weitgehend aus den 30er-Jahren stammende, meist fünfgeschossige, stark verdichtete Blockrandbebauung in Klinkersteinen mit Ergänzungen aus den 50er-Jahren. Diese so genannte Westendsiedlung, die in einem orthogonalen Schachbrettmuster angelegt wurde, galt als klassisches Arbeiterwohngebiet und bildet den Ursprung des heutigen Quartiers. Die Abkehr von der Blockrandbebauung wurde in den 70er-Jahren im Norden vollzogen. Die Neubautätigkeit seit 1980 brachte rund 40 Prozent aller bestehenden Wohnungen - vornehmlich im südlichen Bereich des Quartiers - hervor, in dem bis zu zwölfgeschossige Wohnblocks und Studentenwohnheime entstanden sind.
 |
(Bildquelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen, Stadtvermessung) |
Das Westend wird von Hauptverkehrsachsen umringt, die eine große Barrierewirkung haben und das Gebiet vom direkt sich anschließenden Zentrum Ludwigshafens und den übrigen benachbarten Stadtteilen abgrenzen. Der Hauptbahnhof und die Schienenführung bilden zusätzliche »Abriegelungen«.
Die Mehrzahl der Gebäude im Westend wird ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt. Rund 830 der insgesamt 2 460 Wohnungen sind im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaft »GAG Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau« und zum großen Teil Sozialwohnungen. In den Randbereichen des Quartiers findet man auch eine Mischnutzung von Wohnen und Kleingewerbe, eine rein gewerbliche Nutzung von Gebäuden stellt eher die Ausnahme dar. Kleinere Lebensmittelgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe spielen für die Versorgungslage der Bevölkerung eine wichtige Rolle.
 |
Überdimensionierter Bahnhofsvorplatz und Hochstraße im Hintergrund: Wer will sich hier wiederfinden? (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
 |
Kinder im Westend: Sie sind die Zukunft. (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
Die soziale Infrastruktur ist mit drei Kindertagesstätten, einem Hort, einer Grundschule, einem Seniorenwohnheim und mehreren städtischen Einrichtungen ausreichend ausgebaut. Zum Nachteil der Kinder im Quartier sind zwei der vier Spielplätze allerdings in schlechtem Zustand und ungünstiger Lage.
2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale 
Am offensichtlichsten treten Probleme in den Bereichen Städtebau und Umwelt zutage. Im Westend sind dies Gestaltungsdefizite im Wohnumfeld und auf den wenigen Freiflächen sowie mangelnde Sauberkeit im öffentlichen Raum. Besonders zum Tragen kommen in diesem Zusammenhang der Bahnhofsvorplatz und die angrenzenden Flächen, die aufgrund überholter gesamtstädtischer Entwicklungsvorstellungen aus den 70er-Jahren überdimensioniert und städtebaulich ungeordnet sind. Außerdem war auf den Einwohnerversammlungen zur »Sozialen Stadt« immer wieder zu hören, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner ein Unsicherheitsgefühl aufgrund von unübersichtlichen und dunklen »Ecken« im Westend empfinden.
Bei allen städtebaulichen Mängeln hat das Westend aber auch einen gewissen »Charme«. Die für die Region sehr untypischen roten Klinkerbauten, Straßengrün und Innenhöfe, die durch die Blockrandbebauung entstanden sind, führen zu einer durchaus angenehmen Atmosphäre und einer entwicklungsfähigen Gesamterscheinung. Hinzu kommt, dass das Quartier sich in einer günstigen Lage zwischen City und Bahnhof befindet und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sehr gut ist.
Nachteilig auf die Lebensqualität wirken sich wiederum die teilweise nicht mehr zeitgemäßen Zuschnitte und Ausstattungen der Wohnungen aus. Hier zeigt sich ein hoher Sanierungs- und Modernisierungsbedarf, will man Defizite wie Klein- und Niedrigstandardwohnungen oder das Fehlen von Außenflächen beheben. Teilweise trifft der Modernisierungsbedarf auch auf die öffentlichen Einrichtungen zu, so etwa bei der Grundschule.
DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE
|
Westend |
Ludwigshafen |
|
|
Größe |
30,5 ha |
7 700 ha |
|
Einwohnerzahl (2000) |
3 969 |
165 636 |
|
Bevölkerungsverlust (1995–2000) |
5,6 % |
3,3 % |
|
Durchschnittliche Haushaltsgröße (1999) |
1,6 Pers. |
2,0 Pers. |
|
Anzahl der Wohnungen (2000) |
2 460 |
82 210 |
|
Leerstand |
nicht verfügbar |
nicht verfügbar |
|
Anteil der Wohngeldempfänger (2000) |
3,5 % |
nicht verfügbar |
|
Arbeitslosenquote (1999) |
23,4 % |
11,7 % |
|
Anteil der Sozialhilfeempfänger (2000) |
9,5 % |
4,2 % |
|
Anteil ausländische Bevölkerung (2000) |
40 % |
19,9 % |
|
Anteil der bis 18-Jährigen (2000) |
18,8 % |
17,8 % |
|
Anteil der 60-Jährigen und älter (2000) |
18 % |
24 % |
Probleme im Zusammenleben der Menschen sind in erster Linie auf die sozioökonomischen Belastungen der Bewohnerinnen und Bewohner zurückzuführen. Diese Belastungen finden ihren Ausdruck in einer Arbeitslosenquote, die mit 24 Prozent fast doppelt so hoch ist wie in der Gesamtstadt, einem sehr hohen Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern sowie vielen allein Erziehenden mit der »Doppelbelastung« durch Familie und Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus bergen Unterschiede in der Alltagskultur der verschiedenen Nationalitäten Spannungspotenziale für das nachbarschaftliche Zusammenleben. Schließlich führt die relativ hohe Fluktuation der Bewohnerschaft dazu, dass sich ein stabiles Gemeinwesen nur schwer ausbilden kann. Für Zuziehende ist die Integration umso schwerer, weil es im Westend an öffentlichem Leben fehlt. Es gibt weder Vereine oder Initiativen noch tradierte Formen des Begegnens im öffentlichen Raum.
Trotzdem wird einem gerade bei einem Gang durch das Quartier deutlich, wo Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung und die Säulen der Zukunft liegen: Es sind die vielen Kinder, die hier zusammen leben und auf dem Schulhof oder in den Kitas zusammenkommen. Sie waren auch bei den bisherigen Aktionen im Rahmen der »Sozialen Stadt« die am meisten begeisterten und motiviertesten Akteure.
3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte 
Bezug nehmend auf die wichtigsten Problembereiche und Entwicklungspotenziale im Westend wurden in einem ersten dem Stadtrat vorgelegten Handlungskonzept vier allgemeine Entwicklungsziele formuliert:
- Vor dem Hintergrund der Konzentration sozial und ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen im Quartier mit den daraus resultierenden Problemen im Zusammenleben werden eine »Stabilisierung der Bewohner/innen und deren soziale und wirtschaftliche Integration« angestrebt.
- Weitere übergeordnete Ziele sind die »Bewahrung des Quartiers vor weiterer sozialer Abwärtsbewegung und dessen Aufwertung«. Einander bedingende und verstärkende Negativentwicklungen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Armut, schlechten Wohnverhältnissen, Kriminalität usw. prägen nicht nur die Lebensqualität der Bewohnerschaft, sondern auch das Image des Quartiers. Das Programm »Soziale Stadt« soll dazu beitragen, sich selbst verstärkende negative Prozesse aufzuhalten und das Quartier bis auf durchschnittliches städtisches Niveau aufzuwerten.
- Die »Integration des Quartiers in den Stadtteil und das städtische Gesamtgefüge« stellt ein wichtiges Ziel dar, wenn man verhindern will, dass das Quartier zu einem ausgegrenzten und ausgrenzenden Sozialraum wird. Um der Gefahr der Gettoisierung entgegenzuwirken, wird eine konsequente räumliche und entwicklungspolitische Einbindung in den Stadtteil und die Gesamtstadt angestrebt.
- Das Ziel der »Entwicklung eines zukunftsfähigen Gebiets mit adäquater baulicher, infrastruktureller und sozialer Qualität« steht für die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen im Quartier Ludwigshafen-Westend. Damit sollen Defizite im Wohnungsbereich ebenso wie solche bei der infrastrukturellen Ausstattung des Quartiers angegangen werden. Man will bessere Rahmenbedingungen für ein lebendiges und kommunikatives soziales Zusammenleben schaffen und über so genannte weiche Standortfaktoren letztlich auch eine ökonomische Aufwertung in Gang setzen.
Die allgemeine Zielformulierung wurde im Zuge eines städtebaulichen Rahmenplans weiterentwickelt. Aus der städtebaulichen Analyse heraus wurden für vier Bereiche folgende städtebauliche Zielsetzungen formuliert:
- Baustruktur: Einbindung der Randbereiche des Quartiers in den städtischen Raum, Erhaltung der Strukturen im Kernbereich mit zusätzlicher Schaffung einer »Mitte« im Quartier;
- Nutzung: grundsätzliche Erhaltung der Nutzungsgliederung bei einer Verbesserung des Angebots an Wohnungen und der Standortvoraussetzungen für das örtliche Gewerbe;
- Verkehr: Nutzung der Potenziale der »Stadt der kurzen Wege« mit Verbesserung der Verkehrsbedingungen vor allem für Fußgänger, Radfahrer und den Öffentlichen Personennahverkehr;
- Grün-/Freiflächen: qualitative Aufwertung vorhandener Grün- und Freiflächen und deren Nutzbarmachung als öffentlicher Aufenthaltsraum bzw. Spielplatz
Mit der Spezifizierung der städtebaulichen Ziele für das Quartier Westend und der Darstellung von 14 entsprechenden Handlungsfeldern und einer Reihe von Projektvorschlägen ist eine erste Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts erfolgt (vgl. Übersicht nächste Seite).
4. Schlüsselprojekte 
Zu den ersten Aktionen im Rahmen der »Sozialen Stadt« im Westend gehörten Einwohnerversammlungen und die Einrichtung des Bürgerbüros. Damit wurden die Weichen gestellt für eine beteiligungsorientierte und bewohnergetragene Umsetzung des Programms. Für die verantwortlichen Akteurinnen und Akteure sind gerade die Stimmen der Bevölkerung wichtig, um nicht an den Menschen »vorbeizuplanen«. Neben vielen kleinen Einzelaktionen über das ganze Jahr hinweg gab und gibt es einige Projekte, die vor dem Hintergrund der speziellen Situation im Westend von besonderer Tragweite sind und die eine nachhaltige Wirkung erwarten lassen.
|
HANDLUNGSFELDER (HF) |
AUSGEWÄHLTE VORSCHLÄGE FÜR MAßNAHMEN UND PROJEKTE |
|
HF Sozialstruktur |
- Angebot barrierefreier Wohnungen |
|
|
- Angebot von Eigentumswohnungen |
|
|
- sozialverträgliche Modernisierung |
|
HF Bau- und Nutzungsstruktur |
- Ergänzung der Bebauung |
|
|
- Entwicklung des vorhandenen Gebäudebestands |
|
HF Soziale Infrastruktur |
- Neugestaltung Schulgelände |
|
|
- Verlagerung der Schulsportanlage |
|
|
- Freiflächengestaltung (Gelände Westendhaus, Psychologische Beratungsstelle, Kindertagesstätte) |
|
|
- Räume für Altentreff |
|
HF Kultur |
- Anbindung an das Kulturangebot der City |
|
|
- Installation von Kunstobjekten |
|
HF ruhender Verkehr |
- Erhöhung der Anzahl privater Stellplätze |
|
- Parkraumbilanz |
|
|
HF Straßenräume |
- Konzeption Straßenraumgestaltung |
|
HF Öffentlicher Personennahverkehr |
- Stadtbahngerechter Ausbau der Haltestelle Bgm.-Kutterer-Straße |
|
|
- Aufwertung der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof |
|
|
- Verlagerung der Abfahrtsstelle Regionalbusse |
|
HF Radverkehr |
- Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder |
|
HF Fußgängerverkehr |
- Verbesserung der Fußwegeverbindung |
|
HF öffentliche Freiflächen |
- Erneuerung Spielplätze und Integration in das Umfeld |
|
HF private Freiflächen |
- Innenhofbegrünung |
|
|
- Kleinkinderspielplätze |
|
HF Umweltschutz |
- Gestalterische Einbindung der Wertstoffbehälter |
|
|
- Neuordnung der Müllentsorgung der GAG |
|
|
- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen und Altstandorte |
|
HF Grundstücke |
- Neuordnung der Grundstücksverhältnisse GAG/Stadt |
|
HF Bau- und Planungsrecht |
- bau- und planungsrechtliche Absicherung von Projekten/Aufstellung von Bebauungsplänen |
|
|
Quelle: isoplan |
Da wäre z.B. die Schulhofumgestaltung der Erich Kästner-Grundschule. Dieser Baumaßnahme, durch die der Schulhof zu einer attraktiven Spielfläche geworden ist und die zu einer erheblichen Aufwertung der Spielflächenqualität im Westend insgesamt beigetragen hat, ging im Jahr 2000 eine Kinderkonferenz mit 400 »kleinen« Teilnehmerinnen und Teilnehmern voraus. Die Veranstalter führten zusammen mit den Kindern Workshops zu verschiedenen stadtteilbezogenen Themen durch, wie z.B. Gymnastik, Spiel und Tanz für Senioren und Kinder, Exkursionen mit Kindern durch das Westendviertel, eine Mal- und Zeichenaktion zur Quartiergestaltung. Im Mittelpunkt stand jedoch der Workshop zur Schulhofgestaltung, dessen Ergebnisse - wie auch die der anderen Workshops - bei der großen Konferenz in der Turnhalle vorgestellt wurden. Die Kinder diskutierten ihre Vorschläge mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt. Heute kann ein Ergebnis der Konferenz besichtigt werden: der neue Schulhof, der im Dezember 2001 eingeweiht wurde.
 |
Balkonprogramm: Endlich Frischluft - deutlicher Gewinn an Lebensqualität. (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
Zu sehen sind auch die ersten Modernisierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Wohnungsbaugesellschaft GAG, die für eine deutliche Anhebung des Wohnstandards und eine Aufwertung des Gebiets sorgen. Neben der Sanierung und Zusammenlegung von Wohnungen findet vor allem das »Balkonprogramm« großen Zuspruch in der Bevölkerung. Mit dem Anbau von modernen Balkonen in Stahl- oder Aluminiumkonstruktion an GAG-Gebäuden soll eine schnelle und spürbare Verbesserung der Wohnqualität erreicht werden. Positiv hervorzuheben ist dabei auch die Tatsache, dass die GAG das Prinzip der Beteiligung mitträgt und an die Auswahl der Balkone und der Gebäudefronten Informations- und Abstimmungsprozesse mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gekoppelt hatte.
 |
Neue Schulhofgestaltung: großer Pausenspaß (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
Ein sehr wichtiger Akzent wurde außerdem mit dem Straßenfest 2001 im Westend gesetzt. Zum ersten Mal, solange sich die »Westendler« zurückerinnern können, gab es auf den Straßen ein buntes Treiben, an dem sich viele Bewohnerinnen und Bewohner, Geschäftsleute und viele Einrichtungen aktiv beteiligten. Neben zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche boten einige Hobby-Folklore-Gruppen auf der Bühne ein multikulturelles Programm. Das Fest hatte vor allem deshalb einen so hohen Stellenwert, weil es viele Akteurinnen und Akteure bei der Planung und Organisation und viele Bewohnerinnen und Bewohner beim Feiern zusammenbrachte und dem recht unbeteiligten Nebeneinander im Westend etwas entgegensetzt wurde, das in dieser Form in den nächsten Jahren fortgeführt werden soll.
Auf die hohen Belastungen der Bevölkerung durch Arbeitslosigkeit reagierten die Akteurinnen und Akteure der »Sozialen Stadt« mit lokalen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. So existiert eine Anlaufstelle »JOB XXL«, die das Freiwillige Soziale Trainingsjahr mit Jugendlichen aus und in dem Quartier durchführt, sowie eine Maßnahme für Langzeitarbeitslose. Neben dem Ziel, die betroffenen Personen (wieder) in den Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, wird versucht, einen Bezug zum Quartier herzustellen. Immer wenn sich bei Projekten und Aktionen im Westend eine sinnvolle Gelegenheit bietet, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinbezogen. So sind sie mittlerweile schon als »nette Helfer« bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bekannt.
 |
Folklore auf dem Straßenfest. (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
 |
Die geplante Neugestaltung der Bahnhofstraße, der Verbindungsachse zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt, sieht die Begrünung, die Einrichtung von Aufenthalts- und Treffpunkten und eine optische Aufwertung vor.
5. Organisation und Management 
Die koordinierende, ressortübergreifende Arbeitsweise bei der Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« wird dadurch sichergestellt, dass verschiedene Bereiche der Verwaltung gemeinsam mit externen Partnern in einer übergreifenden Projektstruktur zusammengefasst werden. Um die Bürgermitwirkung weiter zu verbessern, sollen die bisher stattfindenden Einwohnerversammlungen und die projektbezogenen Planungs- und Informationsgespräche in Zukunft zu (themenbezogenen) Quartiersforen weiterentwickelt werden.
Das Quartiersforum wird als eine Arbeitsgruppe verstanden, der neben der Projektleitung, dem Quartiermanagement und dem Ortsvorsteher auch andere Institutionen sowie Akteurinnen und Akteure aus dem Gebiet angehören sollen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger treten bei den Einwohnerversammlungen dem Forum bei. Das Quartiersforum sollte mehrmals im Jahr zusammenkommen, über mögliche und bereits geplante Maßnahmen im Quartier beraten und sich an der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen beteiligen.
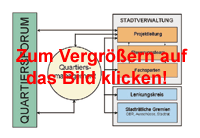 |
Quartiersforum |
Hat das Quartiersforum Projektideen entwickelt und ausgearbeitet, so sollen diese in den Lenkungskreis, dem die Fraktionsvertreterinnen und -vertreter aus dem Stadtrat und die Ortvorsteher angehören, eingebracht werden. Der Lenkungskreis berät über die Projekte und gibt sie gegebenenfalls mit seiner Empfehlung weiter an die zuständigen Gremien der Stadtverwaltung, die gemeinsam mit dem Quartiermanagement für die Projektvorbereitung und -umsetzung zuständig sind.
Die für die Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« zuständigen Stellen der Stadtverwaltung sind:
- die in der »Stabsstelle Dezernatsübergreifende Planungsaufgaben« angesiedelte Projektleitung; sie ist verantwortlich für die Antragstellung und die Verwaltung des Programms, bringt sich auch koordinierend in die Maßnahmeumsetzung ein und arbeitet eng mit dem Quartiermanagement zusammen;
- das Steuerungsteam, als fach- und spartenübergreifendes Kommunikationsgremium, das grundsätzliche Sachverhalte und Entwicklungsziele für das Soziale-Stadt-Gebiet diskutiert und die verwaltungsinterne Vorgehensweise vorbereitet;
- die verschiedenen Fachsparten der Stadtverwaltung, die von der Initiierung bis zur Umsetzung der Maßnahmen in den Prozess miteingebunden sind; sie sollen am Mitwirkungsprozess im Quartiersforum teilnehmen - bis hin zur eigenverantwortlichen Umsetzung der Projekte.
Dem Stadtrat obliegt die Entscheidung, ob Projekte tatsächlich realisiert werden, das heißt, die zuständigen Ausschüsse empfehlen die Umsetzung von Einzelmaßnahmen. Der Hauptausschuss stimmt einmal im Jahr einem Maßnahmenkatalog für das laufende Programmjahr zu. Änderungswünsche werden an die zuständigen Fachsparten zur Modifizierung und Wiedervorlage weitergeleitet.
 |
Bürgerbüro WestendTreff: Hier ist jede/r willkommen. (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
Das Quartiermanagement hat als Schnittstelle zwischen Programmverwaltung und Bevölkerung im Gebiet wichtige Aufgaben, wie Präsenz vor Ort zu zeigen, die Bürgerbeteiligung zu initiieren und zu koordinieren sowie Projekte vorzubereiten und durchzuführen. Andere Aufgabenbereiche sind die quartierbezogene Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisation und Moderation von Versammlungen bzw. des Quartiersforums. Die Quartiermanagerin nimmt außerdem an verwaltungsinternen Gremien teil.
6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
In dem Integrierten Handlungskonzept für das Programmgebiet Ludwigshafen-Westend sind die Bürgerbeteiligung und die Kooperation aller relevanten Akteurinnen und Akteure vor Ort als zentrale Grundsätze für die Planungs- und Umsetzungsphase verankert. Grundlegende und langfristige Veränderungen sind nur möglich, »wenn die Bürgerinnen und Bürger dies mittragen und bereit sind, sich zu engagieren. Dies bedeutet aber auch, dass sie umfassend informiert und in die Prozesse miteingebunden werden. Ebenso müssen alle gesellschaftlichen Kräfte vor Ort wie soziale Institutionen, Kirchen, Wohnungsbaugesellschaften etc. miteinbezogen und ihre Ressourcen genutzt werden«, heißt es in dem Konzept.
Bei der Umsetzung des Programms steht den Akteurinnen und Akteuren gemäß dieses formulierten Anspruchs eine Reihe verschiedener Aktivierungs- und Beteiligungsformen sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Verfügung.
Aktivierungstechniken werden vor allem von der Quartiermanagerin eingesetzt, die über informelle Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Gewebetreibenden sowie sonstigen Akteurinnen und Akteuren versucht, »Mitstreiterinnen und Mitstreiter« für das Programm »Soziale Stadt« im Westend zu gewinnen. Eine sehr wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch so genannte Multiplikatoren, also z.B. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätten und Schulen, der Jugend- und Frauentreffs, Geistliche usw. Der ständige Kontakt und die Zusammenarbeit mit diesen Akteurinnen und Akteuren ermöglicht es, mehr über die Wünsche und Bedürfnisse in der Quartiersbewohnerschaft zu erfahren und umgekehrt die Ideen der »Sozialen Stadt« an sie heranzutragen. Punktuell wurden auch Quartier-Begehungen als Aktivierungstechnik eingesetzt, so unter anderem zum Thema »Sicherheit«.
Als Beteiligungsformen haben sich Stadtteilkonferenzen und Arbeitskreise bewährt. Diese kommen immer dann zum Einsatz, wenn zu einem bestimmten Thema ein Projekt entwickelt werden soll. Die Arbeitsgruppen, die gebildet wurden, um z.B. das Straßenfest oder Kunstprojekte auf den Weg zu bringen, setzten sich aus einer Reihe von Akteurinnen und Akteuren zusammen, die die Vorbereitung und Organisation verantwortlich übernahmen. Diese Methode hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Nicht bewährt hatte sich mangels Interesse dagegen eine Zukunfts- bzw. Planungswerkstatt mit Jugendlichen zur Gestaltung von Freiflächen im Quartier. Als unmittelbar beteiligungsorientierte Aktivitäten sind beispielsweise die Kinderkonferenz oder auch die Aktion »Sauberes Westend« zu nennen.
 |
Fahnenprojekt: Kinder (be)malen ihre Welt. (Bildquelle: Stadt Ludwigshafen) |
Die Öffentlichkeitsarbeit zum Programm »Soziale Stadt« zählt zu den zentralen Aufgaben des Quartiermanagements. Sie übernimmt im Hinblick auf die Transparenz der Planung und Umsetzung wie auch zur Aktivierung der Bevölkerung eine wichtige Funktion. Die größte Rolle spielt die Zeitung »Im Westend zu Haus«. Sie wird seit August 2000 von der Stadt Ludwigshafen alle zwei Monate mit einer Auflage von 3 000 Exemplaren herausgegeben und an alle Haushalte im Westend verteilt. Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich über den aktuellen Stand der Programmumsetzung, einzelne Aktionen und Veranstaltungen oder über die Geschichte ihres Quartiers informieren und auch selbst darüber berichten. Neben dieser dauerhaften Maßnahme zur Information der Bewohnerschaft im Westend finden auch kleinere, einmalige und dennoch sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen statt. So umfasst der »Kunstweg« mehrere Einzelprojekte, die über den gesamten Zeitraum des Programms »Soziale Stadt« zur Belebung und Verschönerung des öffentlichen Straßenraums beitragen sollen. Bei dem »Fahnenprojekt« bemalten Kinder aus dem Westend zusammen mit einem Künstler Stoffbahnen und zogen am 7.9.2001, einem Aktionstag von UNICEF, mit den Fahnen zum Rathaus. Danach wehten die buntbemalten Tücher - mit einer kleinen »Winterpause« - vor der städtischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern im Westend.
7. |
Fazit: Öffentlichkeit herstellen, Strukturen aufbauen - das Westend auf dem Weg zu einem (er)lebbaren Quartier
|
Das Westend ist ein Quartier, das einen sehr eigenen Charakter hat - man darf gespannt sein, wie es sich in der Zukunft entwickeln wird. Die Potenziale liegen in der Quartiersgestalt und in der lebendigen Mischung der Bewohnerschaft. Mit dem Blick nach vorne können auch die vorhandenen Schwierigkeiten besser angepackt werden. Das Programm »Soziale Stadt« hat hier bereits wichtige Akzente gesetzt. Mit der Verbesserung der Wohnsituation durch Modernisierungsmaßnahmen trifft man den »Nerv« der Bevölkerung und knüpft an deren unmittelbare Bedürfnisse an. Außerdem haben die durchgeführten Projekte allesamt dazu beigetragen, dass das Gebiet für die Menschen »erlebbar« wird. Endlich hat man das Gefühl, dass »sich etwas bewegt«. Die Akteurinnen und Akteure der »Sozialen Stadt« fühlen sich aufgrund der Resonanz auf die bisher durchgeführten Projekte weitgehend bestätigt. In Zukunft sollen zusätzliche Themenbereiche belegt werden, wie z.B. »Kriminalitätsprävention« und »Lokale Ökonomie«. Was die Verwaltung und Organisation des Programms anbelangt, hat man mit der aktuellen Struktur bereits auf eine neue Situation reagiert, nämlich dass nunmehr drei weitere Gebiete in Ludwigshafen zu Programmgebieten der »Sozialen Stadt« erklärt wurden. In Zukunft wird es also auch darum gehen, im gesamtstädtischen Rahmen Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten sinnvoll zu koordinieren und voneinander zu lernen.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005