soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
3.1 Auswahlverfahren
Auswahl und Festlegung der Programmgebiete sind zu allererst ins Ermessen der Städte und Gemeinden gestellt; die kommunalen Vorschläge werden dann durch das Land als mittelvergebender Instanz anerkannt oder abgelehnt. Der "besondere" Entwicklungsbedarf, der die Aufnahme ins Programm Soziale Stadt begründet, setzt den gesamtstädtischen Vergleich voraus, denn es muss nachgewiesen werden, dass für die ausgewählten Gebiete im Vergleich zu anderen Stadtteilen ein dringlicherer Handlungsbedarf besteht, ihrer Entwicklung deshalb eine höhere Priorität einzuräumen ist und Ressourcen verstärkt in diese Quartiere zu lenken sind. Dabei sollte das Auswahlverfahren transparent und nachvollziehbar sein, um auch kommunalpolitisch legitimiert werden zu können.
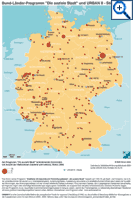 |
Abbildung 18: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Eine fundierte Auswahl der Programmgebiete erfordert detailliertes kleinräumiges Bestandswissen bezüglich der gesamten Stadt, das allerdings erst in wenigen Kommunen (z.B. Berlin, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, Wiesbaden) durch den Aufbau kontinuierlicher sozialräumlicher Beobachtungs- und Berichtssysteme oder gezielt beauftragte Untersuchungen vorhanden ist (1) . In vielen anderen Gebieten werden Sozialdaten der amtlichen Statistik zur Begründung der Auswahl herangezogen, wobei aber kleinräumig eher selten Daten zur sozialen Lage verfügbar sind. Außerdem lässt sich mit der Beschreibung sozialräumlicher Differenzierungen auf Basis der amtlichen Statistik nur ein unscharfes Bild zeichnen, das durch qualitative Befunde noch konturiert werden muss (2) .
Die Gebietsauswahl gründet sich für 87 Prozent der Programmgebiete (193 Gebiete) auf Untersuchungsergebnisse: vor allem auf eigens im Vorfeld der Beantragung erarbeitete Gutachten (41 Prozent aller Programmgebiete), Vorbereitende Untersuchungen (37 Prozent), Rahmenplanungen (34 Prozent) und immerhin für 16 Prozent auf Befunde von kleinräumiger gesamtstädtischer Raumbeobachtung. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass angesichts der verschärften sozialräumlichen Segregation, der zunehmenden Bedeutung integrativer Stadtteilentwicklung und dem lauter werdenden Ruf - vor allem der Politik - nach Programmevaluation und Controlling der Aufbau von Monitoringsystemen sowie Sozialraum- und Segregationsanalysen noch in weiteren Kommunen an Bedeutung gewinnen werden (3) . Damit könnten auch die Methoden der Gebietsauswahl zunehmend verfeinert werden.
Für eine ganze Reihe von Programmgebieten ergaben sich Auswahl und Zuschnitt aus den Prämissen zu Vorläuferprogrammen, die für fast die Hälfte (109) aller Gebiete eine Rolle spielen. Einige Bundesländer setzen die Mittel aus dem Programm Soziale Stadt gezielt als Ergänzung in bereits bestehenden Fördergebieten ein, beispielsweise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Niedersachsen, für die eine Festlegung als Sanierungsgebiet Fördervoraussetzung ist. Ein Großteil der nordrhein-westfälischen Programmgebiete gehört z.B. bereits zum 1993 aufgelegten Landesprogramm "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf". Für 40 Prozent aller Programmgebiete gilt, dass sie ganz oder teilweise auch Sanierungsgebiete sind, für acht Gebiete überlagern sich Förderungen aus den Programmen Soziale Stadt und EU-URBAN, und ein gutes Viertel der Gebiete ist gleichzeitig EFREFördergebiet (Ziel 1/Ziel 2).
Auch in manchen Modellgebieten gründet sich die Gebietsauswahl auf vorgeschaltete Untersuchungen. In Berlin wurde für das Kreuzberger Gebiet Kottbusser Tor - wie für alle Berliner Programmgebiete - die Gebietsauswahl auf die Ergebnisse eines von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie 1997 in Auftrag gegebenen Gutachtens gestützt; in dieser Sozialstudie ging es darum, "den sozialräumlichen Wandel in der Stadt nach der Vereinigung zu analysieren und problematische Entwicklungen in Teilräumen zu identifizieren" (4) . Die Ergebnisse dieser auf qualitative (Befragung aller 23 Bezirke) und quantitative Methoden (Auswertung der amtlichen Statistik und des Sozialstrukturatlas 1997) gestützten Studie bildeten nicht nur die Grundlage für die Auswahl der ersten Berliner Quartiersmanagement- und Soziale Stadt-Gebiete, sie dienten auch dazu, ein gesamtstädtisches Monitoringsystem zu entwickeln.
Das Modellgebiet Bismarck/Schalke-Nord in Gelsenkirchen wurde bereits 1994 als "Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf" unter Anwendung von Kriterien wie Bildungschancen, Wohnraumversorgung und Sozialhilfedichte festgelegt. Die Gebietsauswahl fand durch eine 2000/2001 durchgeführte Sozialraumanalyse (5) nachträgliche Bestätigung. Diese Studie war auf zwei räumliche Ebenen bezogen: einerseits die Analyse der Strukturen und ihrer Entwicklungen im Ruhrgebiet, um die Position der Stadt Gelsenkirchen im Städtenetz des Ruhrgebiets zu beschreiben, andererseits die Analyse der innerstädtischen Sozialraumstrukturen in Gelsenkirchen selbst. Die Untersuchungsergebnisse bildeten im Jahr 2001 für die Stadt die Basis für die Auswahl ihres zweiten Gebiets im Programm Soziale Stadt, Gelsenkirchen - Südost.
Für die Auswahl des Gebiets Leipziger Osten stützte sich die Stadt auf den "ämterund dezernatsübergreifend erarbeiteten Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung". Als Kriterien für die Auswahl wurden sowohl städtebaulichstrukturelle als auch soziale Befunde und Indikatoren berücksichtigt. Die so genannten Identifikationseinheiten, Räume, von denen angenommen wird, dass sie "von der Mehrzahl der dort lebenden Menschen als ,mein Stadtteil' bezeichnet" werden, wurden als Begründungshilfe für die Abgrenzung des Programmgebiets herangezogen (6) .
Mehrere Modellgebiete sind bereits im Rahmen von vorlaufenden Programmen gefördert worden, bevor sie ins Programm Soziale Stadt aufgenommen wurden: Für Bremen - Gröpelingen bestand schon vor dem Programmstart Soziale Stadt eine "differenzierte Förderkulisse", sodass hier erste Bündelungserfolge zu verzeichnen waren (7) . Dies gilt auch für Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord, wo bereits im Rahmen des nordrhein-westfälischen Landesprogramms eine Vielzahl von Projekten entwickelt und durchgeführt wurde. Cottbus - Sachsendorf-Madlow und Schwerin - Neu Zippendorf wurden vorher schon im Rahmen des Programms Weiterentwicklung großer Neubaugebiete (WENG) gefördert, Hannover - Vahrenheide, Nürnberg - Galgenhof/Steinbühl, Singen - Langenrain sowie teilweise der Leipziger Osten und Bremen - Gröpelingen im Rahmen von traditioneller Städtebauförderung.
Hinsichtlich der Gebietsabgrenzung fällt in diesem Zusammenhang auf, dass in einem Teil der Fälle die Grenzen des bestehenden Sanierungsgebiets vor Aufnahme in das Programm Soziale Stadt überdacht und modifiziert worden sind, beispielsweise in Bremen und Leipzig; in einem anderen Teil wurden die eher unter siedlungsstrukturellen und funktional-städtebaulichen Aspekten für die baulichräumliche Sanierung festgelegten Gebietsgrenzen im Zuge der Überleitung in das Programm Soziale Stadt (8) trotz der veränderten Programminhalte nicht korrigiert (9) .
(1) Vgl. dazu weiter Kapitel 9.3 "Bedeutung von Evaluierung und Monitoring in der bisherigen Praxis". ![]()
(2) Hartmut Häußermann und Andreas Kapphan, Sozialorientierte Stadtentwicklung. Gutachten im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, Berlin 1998, S. 28 (Berlin StadtEntwicklung, Bd. 18). ![]()
(3) Vgl. dazu beispielsweise Heiko Geiling, Zum Verhältnis von Gesellschaft, Milieu und Raum. Ein Untersuchungsansatz zu Segregation und Kohäsion in der Stadt, Hannover 2000, S. 11 ff. (Typoskript, agis-texte). ![]()
(4) Häußermann/Kapphan, S. 21 ![]()
(5) Klaus-Peter Strohmeier, Sozialraumanalyse Gelsenkirchen, stadträumliche Differenzierungen von Lebenslagen und Lebensformen der Bevölkerung, Armut und politischer Partizipation. Materialien und Analysen zur Begründung der Auswahl eines Stadtteils mit besonderem Erneuerungsbedarf. Abschlussbericht, Bochum 2002 (unveröff. Typoskript). ![]()
(6) Christa Böhme und Thomas Franke, Programmbegleitung vor Ort im Modellgebiet Leipziger Osten. Endbericht, Berlin 2002, S. 22. ![]()
(7) Thomas Franke und Ulrike Meyer, Programmbegleitung vor Ort im Modellgebiet Bremen - Gröpelingen. Endbericht, Berlin 2002, S. 22; bereits vor dem Start kamen verschiedene Programme zum Einsatz: z.B. Gemeinschaftsinitiative URBAN, "Sofortprogramm Innenstadt und Nebenzentren", "Wohnen in Nachbarschaften - WiN" (S. 42 f.). ![]()
(8) Im Fall von Hannover - Vahrenheide als eine Überleitung in ein Sanierungskonzept, das ein "integriertes Verfahren zur sozialen Erneuerung" einschließt (Geiling und andere, Begleitende Dokumentation, S. 1). ![]()
(9) Geiling und andere, Begleitende Dokumentation, S. 93: "Die von der Stadt vorgenommene Gebietsabgrenzung ist entsprechend der baulich notwendigen Modernisierungsmaßnahmen sinnvoll, nicht jedoch den Zusammenhalt im Stadtteil zu stärken und alltägliche Abgrenzungen zu überwinden". Vgl. dazu auch Marie-Therese Krings-Heckemeier, Meike Heckenroth und Stefan Geiss, Programmbegleitung des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt", Singen-Langenrain. Endbericht, Berlin 2002, S. 20: "Die ursprünglich geplante Gebietsabgrenzung wurde nicht verändert". ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005