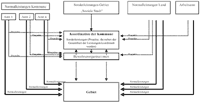soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Teil II: Von der Sozialen Stadt zur umfassenden Nachbarschaftsentwicklung - Anregungen zur Veränderung der Programmkonzeption.
Organisation und Abwicklung im Programm
|
Effizientes Verwaltungshandeln wie allgemein staatliches Handeln erfordern Spezialisierung und jeweils hohe technokratische Fähigkeiten. Staatliche und kommunale Leistungen werden in der Regel in einem raumfreien Kontext bereitgestellt. Bezeichnend ist die noch immer vorkommende Verteilung der Fälle im Jugendamt oder Sozialamt auf Bearbeiter nach Alphabet. Symptomatisch ist auch die Aussage mehrerer Vertreter von Arbeitsämtern: "Für uns sind alle Arbeitslosen gleich". Das unverbundene Nebeneinander der Leistungen und der Organisationen bleibt in vielen Fällen völlig unproblematisiert. Die Adressaten werden als Individuen mit bestimmten Berechtigungen, Ansprüchen und Problemen behandelt. Die Leistung gilt als Lösung des Problems. Die Defizite der Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebietes sind durch die Defizite im beruflichen und sonstigen Leben anderer Bewohnerinnen und Bewohner bedingt. Wer mit Arbeitslosen zusammenlebt, wird selbst leichter als in anderen Gebieten von Arbeitslosigkeit betroffen. Daraus speist sich die Forderung nach der Festlegung von Sozialräumen, die dann Gegenstand von Politik werden. Als zweite wichtige Begründung für die Bildung solcher Räume lassen sich räumliche Nachfragekonzentrationen anführen. Jugendämter müssen abschätzen, wie Jugendliche mit welchen Eigenschaften in einem bestimmten Gebiet leben, um ihre Planungen von räumlich bezogenen Dienstleistungen und sozialer Infrastruktur entsprechend auszurichten. Die zweite, mehr handfeste Begründung wird ständig praktiziert. Die Ausweisung von Gebieten für aufeinander bezogene Entwicklungsmaßnahmen stellt noch die Ausnahme dar. Strohmeier kommt für das Ruhrgebiet zu dem Ergebnis, dass etwa 190 statistische Zählbezirke die Kriterien für Nachbarschaften mit besonderem Entwicklungsbedarf erfüllen, aber nur ein Bruchteil in entsprechende Programme aufgenommen wurde. Räumliche Entwicklungspolitik für belastete Nachbarschaften steht auch quantitativ erst am Anfang.
In den Ländern werden unter unterschiedlichen Überschriften Sondermittel bereitgestellt, die den Kommunen auf Antrag ermöglichen, in speziellen Gebieten über einen längeren Zeitraum Sondermaßnahmen zu realisieren. Die Mittel können mit Geldern und Maßnahmen aus anderen Programmen kombiniert werden. Der Zeithorizont der Maßnahmen beträgt in der Regel vier bis sechs Jahre. Die Maßnahmen werden zusätzlich zu den weiterlaufenden "normalen Maßnahmen" der Kommunen und Länder bewilligt. Die Normalmaßnahmen (Schulen, Infrastruktur, Sozialtransfers, Polizei) übersteigen die Kosten der Sonderprogramme um ein Mehrfaches. Die im Umfang bedeutenderen Normalleistungen oder sonstigen Leistungen werden zu wenig als Potenzial für eine räumliche Entwicklungspolitik zugunsten der belasteten Gebiete gesehen. Sie werden nicht systematisch daraufhin überprüft, ob sie wirksamer für die Entwicklung des Gebiets eingesetzt werden können (z.B. Sozialhilfe als Lohnergänzung und nicht als Lohnersatz). Ein Kernproblem entsteht aus der Neigung, sich auf Einzelprojekte zu konzentrieren. So wird z.B. ein Schulhof saniert, ohne die Schule in ihrem gesamten Spektrum in eine Defizitanalyse einzubeziehen (z.B. Drop-out-Quoten, Schuleschwänzen usw.). Im Endeffekt wurde dann eine partielle, aus dem Gesamtzusammenhang gerissene Einzelmaßnahme finanziert.
Für die Abwicklung der Sondermaßnahmen im Programm Soziale Stadt oder in ähnlichen Programmen wird in der Regel in der Kommunalverwaltung ein besonderes Koordinierungsgremium gebildet. Die folgende Abbildung verdeutlicht Entscheidungsabläufe und Zuständigkeitsverteilungen. Grundsätzlich bleibt die bestehende Organisation in ihren fachlichen Spezialisierungen und damit auch im Fehlen von spezifischen räumlichen Zuständigkeiten in Kraft. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Das für die räumliche Entwicklung meist zuständige Stadtplanungsamt koordiniert alle Sondermaßnahmen zugunsten der festgelegten Gebiete. Allerdings verfügt das Amt kaum über Kompetenzen, um die Qualität der Maßnahmen zu beurteilen und um eine Entwicklungsstrategie für das Gebiet insgesamt zu formulieren. Schwach entwickelt ist eine zentrale Verantwortung für eine Entwicklungskonzeption, die alles Fachwissen berücksichtigt und bei der jede Fachverwaltung sich auch verantwortlich für die allgemeine Entwicklungsaufgabe sieht. Koordinierung ist nicht genug. Die Maßnahmen werden durch einen dezentralen Suchprozess in der Verwaltung in Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern festgelegt und dann überwiegend von den Fachämtern umgesetzt. Teile der Maßnahmen können allerdings auch in der Zuständigkeit der Quartiersmanager realisiert werden. Die Abgrenzungen sind hier fließend. Es gibt weder feststehende Organisationsschemata noch gleichförmige Arbeitsteilungen zwischen Verwaltung und Quartiersmanagement. Das ist verständlich, denn solche Organisationsformen sind immer maßnahmenbezogen und auch von Personen abhängig. In der Regel werden allerdings die bürgernahen oder die kleineren Projekte durch die Vor-Ort-Kapazitäten umgesetzt. Die üblichen Regeln der öffentlichen Mittelverwendung bleiben in Kraft. Unabhängig von den Sondermaßnahmen werden laufend, aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Bestimmungen, ganz unterschiedliche Zahlungsströme und Maßnahmen im Gebiet abgewickelt. Andere Prioritäten würden wahrscheinlich gesetzt, wenn eine starke Vor-Ort-Organisation auf der Grundlage eines verabschiedeten Programms über einen gewichtigen Teil der Mittel verfügen könnte, die für die Bewohner eingesetzt werden, und dabei in der Ausgestaltung und Mittelverwendung einen - allerdings unter lokaler Kontrolle - gewissen Entscheidungsspielraum erhielte. Die Nachbarschaften benötigten dazu einen kontrollierenden "Aufsichtsrat" (1), der eine fachliche und finanzielle Kontrolle ausübt.
Vor Ort werden integrierende Nachbarschaftsorganisationen als Scharnier zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung geschaffen, die in den einzelnen Bereichen - insbesondere bei Maßnahmen, die bestimmten lokalen Interessen und Wünschen der Bürgerschaft entsprechen - für die Umsetzung im Detail verantwortlich sind. Sie finden durch ihre intensiven Kontakte mit den Bewohnern heraus, welche Maßnahmen deren Ziele und Interessen entsprechen. Sie sind darüber hinaus meist dafür verantwortlich, möglichst viele Bewohner oder Zielgruppen an der Umsetzung zu beteiligen. Meist sind die örtlichen Organisationen personell und von ihrer Kompetenz her zu schwach, eine strategische Rolle in der Weiterentwicklung der Programme zu übernehmen. Ihr Status reicht z.B. in der Regel nicht aus, Schulen, Arbeitsämter oder Polizei an einen Tisch zu bringen, um an einem Entwicklungskonzept zu arbeiten und eine kooperative Umsetzung zu vereinbaren. Meist führen die Fachämter und nicht die Nachbarschaftsorganisationen vor Ort die Maßnahmen durch - allein wegen des erforderlichen technischen und rechtlichen Spezialwissens. Einfluss und Gestaltungskapazität der Quartiersmanager sind sehr von den persönlichen Fähigkeiten abhängig, weil im Einzelfall keine festen Mitzeichnungsrechte oder Weisungsbefugnisse bestehen. Gebietsmanager müssen sich sehr stark durch ihre eigene persönliche Autorität durchsetzen. Allerdings sind sie, wenn sie sich geschickt verhalten, Sprachrohr der Bewohnerschaft und verschiedener Bewohnergruppen, die zum Teil durchaus schlagkräftig organisiert sind. Akzeptiert man die Forderung, dass aus den Programmen der sozialen Stadt umfassende Konzepte der Nachbarschaftsentwicklung entstehen sollten, die langfristig (zehn Jahre und mehr) orientiert sind und vor allem die Defizite in der Bildung von Humankapital und am Arbeitsmarkt überwinden, dann muss man auch für eine weit stärkere Organisation vor Ort und stärkere lokale Kontrolle durch gemischt zusammengesetzte Gremien eintreten. Alle relevanten Anbieter von öffentlichen Leistungen müssen in diese Organisation eingebunden sein. Die Gebiete müssen dann über Budgets verfügen, die durch Beschlüsse vor Ort in ihrer Struktur verändert werden können. Die jetzigen Organisationsformen sind darauf programmiert, einige Projekte vor allem im Bereich der Verbesserung der Lebensqualität zu realisieren. Sie reichen für umfassende Entwicklungskonzepte nicht aus. Vor allem die meist sehr kleinen örtlichen Verfügungsfonds, die für einzelne "Bürgerprojekte" bereitgestellt werden, sind Ausdruck für dieses Verständnis. Beispielsweise werden die Mieterbeiratfeste in Siegen-Fischbacherberg vom Stadtteilbüro vorfinanziert. In Schwedt wird ab 2002 dem Gebietsmanagement ein so genannter Aktionsfonds zur Verfügung stehen. Die anvisierten Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte werden über einen Finanzierungsvertrag zwischen dem Stadtteilmanagement und dem Antragsteller (alle Akteure vor Ort) beschlossen. Über die Vergabe der Mittel des Aktionsfonds entscheidet zuvor der "Vergabebeirat Soziale Stadt", der aus vier Bewohnern, zwei Vertretern von Institutionen und einem Gewerbetreibenden besteht.
Neben den Gebietsmanagern als Außenstelle der Verwaltung gibt es jeweils runde Tische oder ähnliche Koordinierungsrunden, an denen eine Vielzahl lokaler Gruppen durch ihre Repräsentanten vertreten ist. Mal werden die Gruppen überwiegend von den Bewohnern getragen, dann wieder von Vertretern der Institutionen vor Ort, z.B. Gewerbetreibenden, Kirchen, sozialen Einrichtungen, Polizei usw. Neben der direkten Erarbeitung von Projekten und Maßnahmen und dem Mitwirken an der Entwicklung des Stadtteils hatten diese Initiativen in machen Stadtteilen auch die Funktion, das Fehlen einer politischen Lobby im Stadtteil zu kompensieren (Detmold). Die Bedeutung dieser - meist zusammen mit den Bewohnern organisierten - Treffen ist unterschiedlich. Sie können einen allgemeinen Resonanzboden abgeben. Künftige Maßnahmen werden vorgestellt, zur Abstimmung gestellt und damit getestet. In Stuttgart-Freiberg/Mönchfeld ist die Einrichtung eines sog. Runden Tisches in Form von Arbeitskreisen in ein hierarchisches System eingebunden, in dem die Verwaltung als beschließendes Gremium an der Spitze steht. Die Projektbearbeitung beginnt mit einer offenen Bewohnerbeteiligung an der Basis. Die Aufgaben werden dann in thematisch getrennten Arbeitskreisen diskutiert, teilnehmende Bewohner werden durch Verwaltungsmitarbeiter betreut. Die Bewohner leisten in Stuttgart die gesamte Vorarbeit. Die zu Beginn der Diskussion hohe Zahl der Beteiligten dünnt nach oben hin aus und wird mit jedem Schritt handlungsfähiger, Informationen werden konzentriert, kanalisiert weitergegeben. Durch die straffe Organisation erhält die Verwaltung keine undurchsichtige Masse an Maßnahmen- und Projektvorschlägen, sondern zu Ende formulierte Entscheidungsbedarfe und Empfehlungen. In Siegen ist die Bewohnerbeteiligung am Runden Tisch nur indirekt, beispielsweise über Vereinsmitgliedschaften oder das Engagement im Mieterbeirat. Er gilt aber als entscheidendes Gremium, da sich der Kern der Aktiven im Stadtteil trifft und Projekte entwickelt. Die Moderation übernimmt der Stadtteilmanager, der in Siegen durch "Personalunion" besonders großen Einfluss auf die Beschlussgremien hat. Das eigentliche Bürgergremium, die Stadtteilkonferenz, wurde - nachdem die städtebaulichen Maßnahmen in Siegen abgeschlossen sind - aufgelöst. Durch die Vielzahl der Teilnehmer galt sie als handlungsunfähig. In Detmold schlossen sich schon 1994 Einrichtungen und aktive Träger des Stadtteils zu einem "Basiskreis Hakedahl" zusammen, um das schlechte Außenimage des Stadtteils zu verbessern. Er ist das zentrale Gremium mit 20 ständigen Teilnehmern (Vertretern von Schule und Kindergarten, Polizei, der einzelnen Projekte, Kirchen und Bürgerverein, Stadtverwaltung und Stadtteilmanager), der als Repräsentationsgremium Anträge in den kommunalen Ausschüssen vertritt und durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanagement eine relativ starke Stellung im Gesamtprozess hat. Die Situation in Emden-Barenburg hat schon beinahe parlamentarischen Charakter. Hier agieren 17 von den Bewohnern des Stadtteils gewählte Vertreter (14 Mitglieder sind auch im Bürgerverein aktiv) in vier thematisch getrennten Arbeitsgruppen als Stadtteilbeirat. Durch die Verbindung zum Bürgerverein ist der Stadtteilbeirat die Vertretung des Stadtteils. Als Teilnehmer bei der städtischen Projektgruppe und durch ständige Beteiligung an der Stadtteilzeitung hat das Gremium auch großen Einfluss auf die Entscheidungen auf Seiten der Verwaltung. Ausreichende Schulbildung wird immer mehr zur Grundlage eines erfolgreichen Berufslebens. Gerade deshalb wird der Schaden von Unterausbildung immer größer. Die Schulen und ihre Leistungen müssen daher in der Nachbarschaft bei der Entwicklung eine zentrale Rolle übernehmen. An fast allen Runden Tischen oder Gebietskonferenzen, die bisher ins Leben gerufen wurden, beteiligen sich die Schulen an den regelmäßig stattfindenden Sitzungen oder Treffen. Dort wird die Durchführung von unterschiedlichen Projekten und Maßnahmen besprochen (Wanderungen, Putzaktionen unter Beteiligung der Schüler, Fußballturniere). Es werden Sprachkurse oder Hausaufgabenhilfen organisiert, nicht selten wird auch versucht, den Eltern Sprachunterricht nahe zu bringen. In keinem Gebiet haben wir ein Konzept gefunden, das die Schulleistungen nachhaltig und messbar erhöhen will. Ausgesprochenen Ausnahmecharakter haben Konzepte einer Elternschule, bei denen systematisch versucht wird, mit den Eltern regelmäßigen Kontakt aufzubauen, um die Schüler besser zu motivieren, aber auch um die Eltern generell zu einer Mitarbeit an der Entwicklung des Gebiets zu motivieren. Die unterschiedlichen Projekte haben noch keinen gemeinsamen Standard entstehen lassen, durch den die Bildungsreserven der Gebiete systematisch ausgeschöpft werden können. Die Beteiligung der Schulen ist fast immer projektorientiert. Weder der Quartiersmanager noch die anderen Akteure im Stadtteil wissen in der Regel über die Schulabgangsquoten, "Schwänzer"-Quoten oder sonstige Schwierigkeiten der Schüler Bescheid und fühlen sich dafür mitverantwortlich. Die zentralen Aufgaben der Schulen bleiben außerhalb des Handlungsfelds des Quartiersmanagements. Die Mental Map des Quartiersmanagements endet meist bei den sozialen und baulichen Problemen. Auch Abbau der Arbeitslosigkeit gehört immer häufiger zum Repertoire der Ziele und Aktionen. Die bessere Ausschöpfung von Bildungsreserven bleibt jedoch jenseits der Grenzen. Vor diesem Hintergrund stößt man sogar auf Unverständnis, wenn man von den Schulen Daten über ihre Performance erheben will: "Solche Zahlen gebe ich ohne Rücksprache mit dem Schulamt nicht heraus". Ganz offensichtlich müssen die Schulen mit ihren Kernkompetenzen und Aufgaben aktive Beteiligte einer allgemeinen Entwicklungspolitik werden.
Die kommunale Wirtschaftsförderung widmet sich mit einem großen Teil ihrer Kapazitäten der Förderung des so genannten endogenen Potenzials. Hierunter fiele auch die Förderung der lokalen Ökonomie in den belasteten Nachbarschaften. Allerdings wird es selten als zentrale Aufgabe angesehen, sich für die lokale Wirtschaft in belasteten Nachbarschaften besonders zu engagieren, weil dabei im Sinne einer Erhöhung der Wertschöpfung oder der Zahl der Arbeitsplätze nur magere Ergebnisse zu erzielen sind. Diese Bewertung vernachlässigt, dass eine Erhöhung der Wertschöpfung in den belasteten Nachbarschaften und eine Steigerung der lokalen Beschäftigung für die Gebiete einen weit höheren Nutzen hat, als er aus der Sicht einer gesamtstädtischen Entwicklung zu erkennen ist. Aus der Tatsache der Ansteckungswirkung von Arbeitslosigkeit in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit und aus einem hohen Bedarf an preiswerten lokalen Dienstleistungen zugunsten einkommensschwacher Bewohnerinnen und Bewohner folgt ein hoher Nutzen, wenn man den Fortschritten in den belasteten Gebieten besondere Verteilungsgewichte zu erkennt und sie damit wertvoller werden als quantitativ vergleichbare Erfolge in anderen Gebieten. Die kommunale Wirtschaftspolitik sollte deshalb ihre Erfolge und ihre Bewertung verräumlichen. Dies würde automatisch rechtfertigen, in den belasteten Nachbarschaften besondere Anstrengungen zu unternehmen. Unabhängig von der Intensität des Engagements stellt sich die Frage, mit welchen Methoden die Wirtschaftsförderung in den belasteten Gebieten vorgehen sollte. Hier fehlt eine ausgefeilte Praxis. Analog zu den allgemeinen Fördermethoden sollten die lokalen Unternehmen in ihrer Expansion gestärkt werden. Die Gründung lokaler Dienstleistungsunternehmen kann auf vielfältige Weise (Training von geeigneten Personen, Konzeptionen und Stützung, Hilfe bei der Überwindung von Engpässen insbesondere durch Mikrokredite) erfolgen. Es geht hier nicht um die Details einer solchen Strategie. Am Anfang muss eine neue Gewichtung der Prioritäten stehen, damit die belasteten Nachbarschaften zunächst intensivere Aufmerksamkeit erfahren, aus der dann auch größere Erfolge entstehen können.
Man kann in den überforderten Nachbarschaften Arbeitslosigkeit nicht als isoliertes Individualproblem betrachten. Arbeitslosigkeit ist vernetzt. Hohe Arbeitslosigkeit in Gebieten perpetuiert sich selbst und erzeugt neue Arbeitslosigkeit. Der Ansteckungscharakter zahlreicher Missstände in den Gebieten zwingt dazu, sozialräumliche Strategien zu starten, die aus dem Konzept der Einzelfallbetrachtung ausbrechen. Das erfordert von den Arbeitsämtern, dass sie für die Gebiete der Nachbarschaftsentwicklung eigene Strategien entwickeln und in die allgemeinen Entwicklungskonzepte einbringen. |
||
(1) Zum Beispiel das Modellprojekt "Jury" in Berlin, bei dem repräsentativ ausgewählte Bewohner über die Mittelverwendung von rund 500 000 Euro im Stadtteil bestimmen. ![]()
Quelle: Good Practice in Neubauquartieren. Eine Analyse im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt", von empirica - Qualitative Marktforschung, Stadt- und Strukturforschung GmbH, Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt Bd. 9, Berlin, 2003
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 31.05.2005