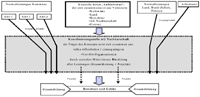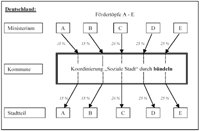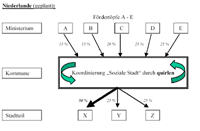soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Teil II: Von der Sozialen Stadt zur umfassenden Nachbarschaftsentwicklung - Anregungen zur Veränderung der Programmkonzeption.
Folgerungen aus den Beobachtungen
|
Die gegenwärtigen Strategien blenden meist aus, dass durch staatliches Handeln, z.B. durch die unzureichenden Schulangebote in den Gebieten, Ungleichheit oft verstärkt wird. Nachhaltige Entwicklungserfolge sind wahrscheinlich nur erzielbar, wenn sich die Gesamtheit aller öffentlichen Leistungen in ihren Ergebnissen verbessert, d.h. gebietsadäquat weiterentwickelt wird. Die gegenwärtigen Programme können die Determinanten der Segregation und der ständig neu entstehenden Ungleichheit nicht außer Kraft setzen. Jede Verbesserung der Lebensbedingungen hat Bedeutung für die Bewohnerinnen und Bewohner, doch es bleibt die Aufgabe ungelöst, die Mechanismen der Ungleichheit nachhaltig zu verändern oder in ihren Ergebnissen zu überwinden. Die Quartiers- oder Gebietsmanager kooperieren mit den Verwaltungen nur bezogen auf ausgewählte Projekte. Die Produktpalette der Verwaltung wird nicht insgesamt durchgeknetet. Die Gebietsmanager erheben z.B. nicht den Anspruch, die Schulen selbst in einer kooperativen Strategie verändern zu wollen. Zu wenig integriert in die Maßnahmen sind die staatlichen Leistungen (Schulen, Polizei, Arbeitsämter). Die Beteiligten lehnen es oft sogar ab, in den "Zuständigkeitsbereich" der jeweils anderen Institution einzudringen. Man begnügt sich damit, die Schulen oder Polizeidienststellen an einen Runden Tisch oder eine Stadtteilkonferenz zu holen und einzelne Projekte unter dem Dach von Soziale Stadt durchzuführen. So kommt es, dass dem Stadtteilmanager die Qualität der Schule völlig unbekannt ist ("das ist doch Sache der Schule") und der Schulleiter die Schule nicht als integralen Bestandteil des Gebiets und seiner langfristigen Entwicklung sieht ("das ist doch alles Sache des Stadtteilmanagers"). Für eine solche Integration wären zusätzliche Kapazitäten und auch eine Konzeption erforderlich, bei der alle beteiligten Organisationen die Gesamtheit ihrer Leistungen in die Kooperation einbringen, sich der Kritik der anderen stellen und mit diesen gemeinsam ihre eigenen Leistungen in Kooperation verbessern und als Teil eines Konzepts der Gebietsentwicklung sehen.
Die Verbesserung der Einzelleistungen sollte herausgeführt werden aus der Isolierung der jeweiligen Spezialorganisationen. Jede einzelne Organisation sollte ihre spezielle Leistung als Teil einer Strategie der Gebietsentwicklung sehen. Zwar ist für die Schule jeder Schüler gleich. Vergleichbares gilt auch für das Arbeitsamt. Doch ist die Bedeutung einer verbesserten Schulleistung oder der Abbau der Arbeitslosigkeit in einer überforderten Nachbarschaft größer als in einem gutbürgerlichen Quartier, in dem es kaum Arbeitslosigkeit und weniger Schulversagen als Folge von Belastungen in der Nachbarschaft gibt. Die Defizite in verschiedenen Lebens- und Politikbereichen in den belasteten Nachbarschaften sind besonders stark untereinander verknüpft. Schulversagen wird sehr stark mitbestimmt durch die mangelnden Sprachkenntnisse vieler Eltern, die wiederum eine Folge, aber auch Ursache von Arbeitslosigkeit sein können. Gelingt es unter solchen Bedingungen eine wirkliche "Elternschule" zu erreichen, dann kann es auch gelingen, die Wissensdefizite der Eltern anzugehen. Der Nutzen von Erfolgen wird jeweils weit größer sein als in anderen Gebieten. Darüber hinaus sind die einzelnen Leistungsanbieter auf eine Vernetzung ihrer Wirkungen angewiesen, weil isolierte Erfolge allzu leicht verdorren und keine nachhaltigen Wirkungen erzielen. Erforderlich sind deshalb eine Verknüpfung der Normal- und Sonderprogrammleistungen und eine intensive Beteiligung der im Gebiet engagierten und auf die Gebiete angewiesenen Bewohnerinnen und Bewohner. Während es in den "normalen" Nachbarschaften ausreicht, dass die jeweiligen öffentlichen Anbieter ihre Leistungen ständig verbessern, kommt in den überforderten Nachbarschaften eine "Agenda zwei" hinzu, die zu mehr Kooperation und Vernetzung zwingt. Es wird eine Organisationsform und es werden Anreize benötigt, um eine gemeinsame Verantwortung für die Entwicklung eines Gebietes Realität werden zulassen. Insbesondere sind Anreize und Organisationsstrukturen erforderlich, die nicht nur Programme bündeln, sondern Entwicklungskonzepte erarbeiten in denen Einzelmaßnahmen so vernetzt werden, dass die Gesamtheit der angestrebten Ziele erreicht werden kann. Ein Entwicklungskonzept ist mehr als eine Addition von Einzelmaßnahmen in Sonderprogrammen. Es muss in allen relevanten Bereichen der Lebensqualität und der Lebenschancen Verbesserungen erreichen. Ein begrünter Schulhof, der auch nachmittags von anderen Jugendlichen genutzt werden kann, ist nicht genug. Es geht um bessere Schulleistungen und sinkende Arbeitslosigkeit bei steigender Lebensqualität im Gebiet.
Die jetzt für die Sonderprogramme gebildeten Organisationen sind für die geltende Finanzierung und die Zuständigkeiten grundsätzlich geeignet. Sie müssen auf alle relevanten Akteure ausgedehnt werden. Die einzelnen Akteure müssen einen Anreiz erhalten, sich für die Entwicklung des Gebietes insgesamt zu engagieren und die Gesamtheit ihrer Leistungen so zu verändern, dass sie ein Maximum der Wirkung für die Entwicklung des Gebietes entfalten. Alle öffentlichen, das heißt kommunalen und staatlichen Anbieter sollten deshalb dauerhaft und umfassend kooperieren. Dies erfordert einen jeweils größeren Handlungsspielraum. Außerdem müssen die Anreize für eine solche Kooperation steigen. Als einfachste Form bietet sich an, eine von den Bewohnerinnen und Bewohnern kontrollierte Arbeitsgemeinschaft aller öffentlichen Stellen ins Leben zu rufen. Die Teilnehmer dieser Arbeitsgemeinschaft koordinieren nicht nur die Durchführung einzelner besonderer Projekte. Sie bringen die Verantwortung und die Kompetenz aller ihrer Leistungen ein. Sie formulieren unter einem aus der Gruppe gewählten Vorsitzenden auch das Entwicklungskonzept. Die AG ist Träger des Konzeptes. Die Teilnehmer beteiligen sich nicht nur wegen eines sie betreffenden Sonderprojekts, sondern beantragen die Mittel im Wettbewerb mit anderen. Daraus entsteht ein Gremium aus:
Die Nachbarschafts-AG formuliert das langfristige Entwicklungskonzept, fühlt sich dafür verantwortlich und erhält die Mittel dafür übertragen. Über Detailverwendung wird unter Kontrolle des Aufsichtsrats entschieden. Die Anreize für eine Kooperation sollten aus Bewilligungen für fünf- bis zehnjährige lokale Entwicklungsbudgets bestehen. Hier müssen auch die Bündelungsprobleme gelöst werden. Verschiedene Lösungen sind möglich. So können die Gebiete Vorrang bei der Beantragung von Mitteln erhalten. Noch besser wäre eine Bündelung auf Landesebene, die den Gebieten die Arbeit erheblich erleichtern würde. (siehe Abschnitt 4. Finanzierung). Voraussetzung für solche Finanzierungen sollte ein Erfolg versprechendes, von allen Akteuren gemeinsam getragenes Entwicklungskonzept sein. Die einzelnen Akteure - Schulen bis Jugendamt - hätten jeweils die Chance, für ihren Zuständigkeitsbereich zusätzliche Ressourcen zu erhalten, sofern es ihnen gelingt, eine kooperative, Erfolg versprechende Strategie zu formulieren und ihre Umsetzung zu demonstrieren. Erfolg versprechende Verknüpfung verschiedener Maßnahmen der beteiligten Akteure wird zur Voraussetzung der Mittelbewilligung. Die Streetworker der Kommunen müssen mit den Schulen und ihren Sozialarbeitern zusammenarbeiten. Die Arbeitsämter müssen die Bemühungen der Schulen um einen erfolgreichen Übergang von Hauptschülern in den Beruf unterstützen, während rechtzeitig die Stärkung der lokalen Ökonomie zu mehr Arbeitsplätzen im Gebiet führt. Das Interesse an der Kooperation kommt einmal aus einem materiellen Anreiz der einzelnen Akteure, die in ihrem Zuständigkeitsbereich Handlungsfreiheit und Ressourcen erhalten. Voraussetzung bleibt jedoch, dass sie für das Gebiet insgesamt Verantwortung übernehmen und dies durch enge Kooperation mit den anderen demonstrieren. Daneben müssen natürlich alle Beteiligten (Schule, Polizei, Jugendamt, Arbeitsamt, Sozialamt und Stadtplanung) auf ein gebietsbezogenes, kooperatives Verhalten verpflichtet werden. Gleichzeitig würden ihre Kunden ein stärkeres Kontroll- und Mitspracherecht erhalten. Eine richtige Basis der Kooperation bleiben jedoch finanzielle Anreize. Die einzelnen Gebiete, die aufgrund von Indikatoren bestimmt sind - vertreten durch die Kommune und die Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen Leistungsanbieter, kontrolliert durch die Bewohner -, wären antragsberechtigt. Die Mittelvergabe würde zu einem erheblichen Teil von der Qualität der Konzepte abhängen. Damit haben gerade die Beteiligten, deren Initiativen bisher in ihren jeweiligen hierarchischen Organisationen im Gestrüpp der Widerstände stecken blieben, eine erhebliche Chance Initiativen zu realisieren und in Kooperation mit anderen eine Gebietsentwicklung zu starten. Man kann erwarten, dass der finanzielle Anreiz zu Kooperation und die gemeinsame Verantwortung für das Gebiet das Verhalten der Beteiligten durch einen Prozess des learning by doing nachhaltig verändern. In die gleiche Richtung können ständige interne Evaluationen, qualifizierte Ziele, verbindliche vertragliche Verabredungen zwischen den Akteuren und auch die Abhängigkeit der Mittelbewilligung vom Erfolg der Maßnahmen wirken. Gegenüber den kommunalen Parlamenten gibt es eine gewisse Autonomie, obwohl die Kommunen das Gesamtkonzept natürlich jeweils genehmigen und verabschieden. Sollen die Akteure vor Ort eine größere Handlungsfreiheit erhalten, empfiehlt sich auch ein "Aufsichtsrat", der Kontrolle ausübt. Er sollte gemeinsam durch Kommune, Land und Bewohnerschaft bestimmt werden.
Da es kaum möglich sein wird, zusätzliche Mittel im erforderlichen Umfang zu mobilisieren, empfiehlt sich eine Lösung durch Umschichtung. Aus den verschiedenen Spezialprogrammen eines Landes sollten jeweils für die Nachbarschaftsentwicklung bestimmte Anteile abgezweigt werden. Hinzu kämen die ohnehin schon verfügbaren Sondermittel. Die Anteilsquoten sollten dem Bedarf entsprechen. Diese Sondermittel werden in einem Titel "Nachbarschaftsentwicklung auf der Landesebene" zusammengefasst. Die begünstigten Nachbarschaften entfallen damit als Antragsteller für die verschiedenen Programme, aus denen Mittel abgezweigt wurden. Sie beantragen - gestützt auf Gesamtkonzepte - jeweils Mittel aus dem Programm der Nachbarschaftsentwicklung, das heißt jeweils Mittel für ihre Gesamtstrategie. Die einzelnen Beteiligten - Schulen, Polizei, Arbeitsämter, kommunale Ämter - hätten so einen starken Anreiz, sich an der Arbeitsgemeinschaft Nachbarschaftsentwicklung zu beteiligen. Auch die Ministerien des Landes, die Mittel für die Nachbarschaftsentwicklung abzweigen, würden ein höheres Interesse entwickeln. Sie würden gemeinsam die Richtlinien und Bedingungen formulieren, unter denen Anträge zur Finanzierung der Nachbarschaftsentwicklung von den Arbeitsgemeinschaften über die Kommunen gestellt werden können.
Der Begriff Informationssystem wird hier sehr weit interpretiert. Es beginnt damit, dass Indikatoren benötigt werden, um die Gebiete zu definieren, die für ein Programm der Nachbarschaftsentwicklung antragsberechtigt sind. Im optimalen Fall werden verschiedene Indikatoren zu einem integrierten Defizitindikator zusammengefasst. Gegenwärtig besteht ein erschreckender Informationsmangel bei der Messung und Bestimmung von Defiziten. Verantwortlich für den Datenmangel sind die Schulverwaltungen, die statistischen Landesämter, die Bundesanstalt für Arbeit und viele andere - insbesondere die Kommunen, die Daten aufbereiten. Da die Daten im Prinzip verfügbar sind, geht es darum, sie in einer koordinierten Anstrengung aufzubereiten und zugänglich zu machen. Die Kosten sind gering. Es geht darum diese Aufbereitung zu wollen und ihre Bedeutung realistisch einzuschätzen. Als Ergebnis einer solchen statistischen Analyse ergäbe sich ein Ranking der Gebiete. Es wäre politisch festzulegen, ob das Programm Nachbarschaftsentwicklung für Gebiete gelten soll, in denen zehn Prozent oder 20 Prozent der Einwohner leben. Die möglichst präzise Definition der Defizite würde gleichzeitig die Grundlage für eine ständige Evaluation bieten. Erst wenn Defizite möglichst weitgehend definiert sind, lassen sich auch Erfolge exakter bestimmen. Die einzelnen Gebiete kennen ihre Defizite und formulieren ihre Programme bezogen darauf. Sie entwickeln gleichzeitig Indikatoren, die den Erfolg ihrer Maßnahmen demonstrieren können, und sie entwickeln interne Evaluationsverfahren, durch die ständig überprüft wird, ob die beantragten und dann umgesetzten Maßnahmen den erwarteten Erfolg haben. Die Dichte der Kontrollen und Bewertungen der Erfolge oder Misserfolge muss insgesamt gesteigert werden. Auch die kontrollierenden Aufsichtsräte oder Bewohnergruppen sowie die beteiligten öffentlichen Akteure würden ständig mit Maßstäben konfrontiert, an denen sie ihr Handeln messen. Ziel aller dieser Bemühungen sollte es sein, die Verbindlichkeit der Maßnahmen, aber auch der Ziele zu steigern. Wahrscheinlich würde sich auch ein größerer Realismus ergeben. Die kontrollierte und überprüfte Erfahrung würde zeigen, welche Maßnahmen welche Erfolge hervorbringen. Erfolge wären genau zu lokalisieren und in ihren Ursachen bestimmbar. Das wiederum wird einen rascheren Wissenstransfer auf andere Gebiete ermöglichen. Diese Hinweise sollen zeigen: Nachbarschaftsentwicklung ist nicht nur eine Frage der Bereitstellung von mehr Finanzmitteln. Es geht vor allem auch darum, die Maßnahmen weiter zu entwickeln und organisatorische sowie konzeptionelle Fortschritte für die künftigen Entwicklungsstrategien herbeizuführen. Nachbarschaftsentwicklung erhält angesichts der Dimension der Defizite einen neuen Stellenwert.
Im alltäglichen Sprachgebrauch hat sich der Name "Soziale Stadt" für die Programme zur Verbesserung der Lebensbedingungen eingebürgert. Doch "Soziale Stadt" ist nicht genug. Es geht um eine innere Entwicklung, in der in etwa einem Jahrzehnt die massiven Nachteile in den Lebenschancen deutlich, wenn nicht entscheidend abgebaut werden. Eine solche innere Entwicklung liegt im Interesse aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner, denn sie würde mehr Wachstum, weniger Ungleichheit und weniger Belastungen für den Sozialstaat bedeuten. Dies sollte Grund genug für eine Politik sein, die weiter geht als bisher. Wir formulieren die Hypothese, dass eine solche Politik nicht nur zu humaneren Städten führt. Sie wäre volkswirtschaftlich hoch rentabel, weil sie Mehrbeschäftigung, höheres Wachstum und geringere künftige Einwanderung zur Folge hätte. Im Zentrum stehen dabei die Bildungsinvestitionen, die dadurch charakterisiert sind, dass sie Wachstum und Gleichheit fördern. Günstigere Voraussetzungen kann es für eine Politik nicht geben. |
|||||
Quelle: Good Practice in Neubauquartieren. Eine Analyse im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt", von empirica - Qualitative Marktforschung, Stadt- und Strukturforschung GmbH, Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt Bd. 9, Berlin, 2003
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 31.05.2005