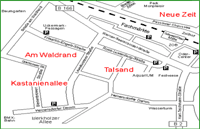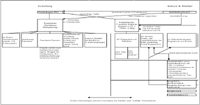soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Teil II: Von der Sozialen Stadt zur umfassenden Nachbarschaftsentwicklung - Anregungen zur Veränderung der Programmkonzeption.
Fallstudien "Soziale Stadt": Kurzfassungen
Schwedt/Oder - Obere Talsandterrasse (Brandenburg)
|
Seit Mitte der 90er-Jahre gibt es in Schwedt/Oder einen offenen und bewussten Umgang mit der hohen Konzentration von Wohnungsleerständen auf der Oberen Talsandterrasse und den damit verbundenen Verlusten an sowohl baulicher als auch funktioneller Substanz. Es wurde keine vorschnellen Sanierungsmaßnahmen, sondern ein gesamtstädtischer Stadtumbau eingeleitet, der sich künftig auf den Stadtteil Am Waldrand konzentriert. Die drei Stadtteile der Oberen Talsandterrasse befinden sich nordwestlich des Schwedter Zentrums. Daran schließen der jüngste Stadtteil Talsand (1969-1973), im Nordwesten Am Waldrand (70er-Jahre) und schließlich der Stadtteil Kastanienallee (Ende 80er-Jahre) im Süden an. Das Wohnungsangebot ist sehr monostrukturiert: 92 Prozent der etwa 21 280 Wohneinheiten sind DDR-Wohnungsbauten (rund 6 Prozent Nachwende-Neubauten, vor allem Einfamilienhausbau). In Folge von Abwanderung (arbeitsplatzbedingt und Umlandabwanderung) und Sterbeüberschüssen schrumpfte in Schwedt die Bevölkerung seit der Wende um über 20 Prozent (seit 1993 haben die Stadtteile der Oberen Talsandterrasse ca. 10 800 Einwohner verloren, also rund 40 Prozent). Bei gleichbleibenden Wanderungsverlusten wird für 2005 ein Bedarf an Mietwohnungen in Höhe von 15 160 WE (1) prognostiziert. Ausgehend vom heutigen Bestand wären dann rund 4 000 der vorhandenen Wohnungen ohne Nachfrager. Das entspricht einem Wohnungsüberhang von rund 19 Prozent. Der wirtschaftliche Niedergang des Industriestandortes Schwedt führte zu einem enormen Abbau von Arbeitsplätzen, im September 2001 lag die Arbeitslosenquote in der Stadt Schwedt bei 23,7 Prozent, rund 5,3 Prozent betrug der Anteil der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt. Der Anteil der Ausländer und Aussiedler, die im Planungsgebiet leben, ist mit rund zwei Prozent bzw. 2,1 Prozent vergleichsweise gering.
Über einen gesamtstädtischen Schrumpfungsprozess, dessen Schwerpunkt im Gebiet "Am Waldrand" liegt, soll durch Schrumpfung, Stabilisierung und Entwicklung die Zukunft der Oberen Talsandterrasse gesichert werden.
Folgende Akteure sind beteiligt: die Stadt Schwedt - federführend Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltungsamt, der Stadtplaner, Wohnbauten GmbH, Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG, Kommunalpolitiker, Schulen, Uckermärkischer Bildungsverein (UVB), Bewohnerschaft, Aussiedler, Gewerbetreibende, Kirchen. Seit Juni 2001 ist die Stelle der Stadtteilmanagerin mit einer ABM-Kraft besetzt (2). Träger der Stelle ist der Uckermärkische Bildungsverein (UBV). Mittelfristig soll die Stadtteilmanagerin gemeinsam mit den anderen Akteuren im Stadtteil zum Motor des Programms werden, sodass sich die Stadtverwaltung zurückziehen kann. Zu den wesentlichen Aufgaben der Stadtteilmanagerin gehören die folgenden Bereiche:
Der Stadtumbau in Schwedt/Oder kann mit dem zusätzlichen Mitteleinsatz der "Sozialen Stadt" auf bereits erprobten Strategien aufbauen. Beim künftigen Abriss im Gebiet Am Waldrand stehen nun die Nachnutzung der frei werdenden Flächen und die Umgestaltung der Infrastrukturressourcen im gesamten Stadtgebiet zur Debatte.
Der Gesamtumfang der Städtebauförderung liegt in 2002 bei rund 680 000 Euro. Künftig sollen eingesetzt werden: Städtebaufördermittel "Soziale Stadt", ZIS, ABM und SAM, VVN-Fördermittel (Verwaltungsvereinbarung Neubaugebiete), Stadtumbau-Ost.
(1) Inklusive einer Reserve von 860 WE. (2) Eine ABM-Stelle wurde deshalb eingerichtet, weil bislang keine Fördermittel zur Verfügung standen. Die Stelle läuft im Juni 2002 aus, man hofft bis dahin die Anschlussförderung mit Mitteln aus dem Programm "Soziale Stadt" finanzieren zu können. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Good Practice in Neubauquartieren. Eine Analyse im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt", von empirica - Qualitative Marktforschung, Stadt- und Strukturforschung GmbH, Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt Bd. 9, Berlin, 2003
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 31.05.2005