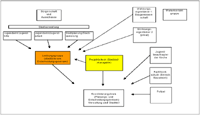|
Die kleine Hochhaussiedlung Hudekamp (1 238 Bewohner im Jahr 1997) liegt im Stadtteil Buntekuh am westlichen Stadtrand von Lübeck. Die Anlage wurde von 1972 bis 1974 als Ensemble von vier bis zu 16-geschossigen Hochhäusern mit zwei dreigeschossigen Querriegeln gebaut und galt als Modellprojekt des sozialen Wohnungsbaus (1). Mitte der 90er-Jahre war der Hudekamp der soziale Brennpunkt in Lübeck. Vandalismus, Brandstiftungen, Müllentsorgung aus den Fenstern der Hochhäuser und rechtsradikale Tendenzen beherrschten die Siedlung. Die Ursachen dieses Wandels waren dieselben wie in vielen westdeutschen Hochhaussiedlungen: eine einseitige Belegung mit den sozial Schwächsten, der Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten für die Bewohnerschaft und das Fehlen jeglicher Anregungen außerhalb der eigenen Wohnung.
 |
Abbildung 13: Lage des Programmgebietes Hudekamp
Quelle: Büro KOM PLAN, Lübeck - Grundlagenplanung Dokumentation Hudekamp 1999.
|
Knapp 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind arbeitslos und nur rund 40 Prozent einheimisch. Vor allem Türken, Kurden, Jugoslawen, Italiener und Aussiedler wohnen in der Anlage. Die Kosten für Schadensbeseitigung und zunehmenden Leerstand stellten die Rentabilität der Anlage in Frage, sogar der Abriss wurde diskutiert.
 Probleme Probleme
- Wohnen: zunehmende Leerstände (rund 21 Prozent), bauliche Mängel (Eingänge, Ausfall der Fahrstühle, dunkle Flure), hohe Instandhaltungskosten.
- Wohnumfeldqualität: Vandalismusschäden, undefiniertes Abstandsgrün, verschmutzte Spielflächen, wenig Spielmöglichkeiten, Müll und Sperrmüll im öffentlichen Raum.
- Bevölkerung: hoher Anteil an von Transferleistungen der öffentlichen Hand Abhängigen, viele ausländische und ausgesiedelte Bewohner, rechtradikale Tendenzen, Armut, Dauerarbeitslosigkeit, Gewalttätigkeit, Drogenkonsum, Kriminalität, Verwahrlosungstendenzen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
- Infrastruktur: Fehlen von Dienstleistungs- und Gewerbeeinheiten, keine Aufenthaltsmöglichkeiten.
- Image: abgetrenntes Wohnquartier (Stigmatisierung), Ächtung und Fremdisolierung.
 Strategien, Ziele, Maßnahmen Strategien, Ziele, Maßnahmen
Die Situation spitzte sich 1995/96 zu (Vandalismus, existenzgefährdende Leerstände). Das "Projekt Hudekamp" wurde unter Einbeziehung der betroffenen Wohnungseigentümer auf einer Zukunftswerkstatt diskutiert und ganz bewusst als Gesamtprogramm aus baulichen und sozialen Maßnahmen konzipiert.
- Maßnahmen zur Wohnqualität: Einrichtung von Kommunikations- und Freizeiträumen und Umgestaltung halböffentlicher Flächen wie Flure, Fahrstühle, Etagen- und Eingangsbereiche, z.B. Teestube mit Waschmaschinen und Sanitärraum, Ausbau der Kellerräume zu Jugendtreff, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, Bewohnercafé, Pförtnerlogen (2) und Einrichtung einer Polizeidienststelle.
- Maßnahmen zur Wohnumfeldqualität: Neugestaltung der Außenanlagen vor allem für Kinder, Jugendliche und Senioren.
- Nicht-investive Maßnahmen: Aufwertung des Hudekamp-Images durch Nachbarschaftsbüro, Nachbarschaftsveranstaltungen und Quartiersfeste, Deutsch-Sprachkurse, Aktionen für Kinder und Jugendliche, Qualifizierungsseminare, Erweiterung und Vernetzung der Angebote der sozialen Infrastruktur.
- Förderung von Arbeit und Beschäftigung: Zusammenarbeit mit der g/a/b (Gemeinnützige Ausbildungs- und Beschäftigungs-GmbH in der Hansestadt Lübeck).
 "Good-Practice"-Maßnahmen "Good-Practice"-Maßnahmen
- Bauliche Maßnahmen in Treppenhäusern, Fluren und Wohnumfeld: Aufwertung der Gebäude durch Sanierung und Modernisierung. Videoüberwachung für uneinsehbare Räume, im Erdgeschoss zusätzliche Toilettenanlagen. Besetzte Concierge-Logen in den Hochhäusern vermitteln ein größeres Sicherheitsgefühl für die Bewohnerschaft. Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Außenbereichen durch Mietergärten, Spielflächen, Ballspiel- und Basketballplatz, Verlegung und Verkleinerung der Müllanlagen (3), Inline-Skaterbahn.

12-Geschosser
|

Umfeldbegrünung
|

Terrassenanlagen
|

Eckbebauung
|

Modernisierter Eingangsbereich
|

Modernisierter Eingangsbereich
|

Basketballplatz
|

Café
|

Polizeidienststelle
|

Innenhofbereich
|

Innenhofbereich
|

Terrassenanlagen
|
|
- Nachbarschaftseinrichtungen in den Erdgeschossen: Die baulichen Umgestaltungen wurden bewusst mit einer Vielzahl von Nachbarschaftseinrichtungen und sozialen Betreuungsmaßnahmen in den Gebäuden selbst gekoppelt. Dazu gehören: Nachbarschaftsbüro, Spielstube, Teestube, Jugendtreff, Niederlassung der Beschäftigungsgesellschaft g/a/b sowie eine Polizeidienststelle.
- Investitionsstau überwinden: Durch die Aussicht auf öffentliche Fördermittel, die Zusage der Stadt, eine Belegungsbindung aufzuheben, sowie die Bereitstellung organisatorischer und fachlicher Ressourcen durch Stadtverwaltung und externe Projektleitung wurden die anfangs sehr zögerlichen Eigentümer vom Konzept überzeugt.
- Aktivierung der Bürger im Ehrenamt: Bei der "aktivierenden Bewohnerbefragung" zu Beginn des Projekts wurden die Wünsche erfasst, persönlich Kontakt aufgenommen und die Teilnahmebereitschaft an Ehrenamt und bezahlten Beschäftigungsmaßnahmen ausgelotet. Das Ergebnis war die Basis für die weitere Projektplanung.
-
Entwicklungsstand:
|
1996:
|
Zukunftswerkstatt, Aktivierende Bewohnerbefragung, Aufnahme in das Landesprogramm der schleswig-holsteinischen Städtebauförderung.
|
|
1997:
|
Studentischer Ideenwettbewerb, erste Grundinstandsetzungen.
|
|
1998:
|
Modernisierungsmaßnahmen, Nachbarschaftseinrichtungen.
|
|
1999:
|
Außenanlagen, Lenkungsgruppe, Koordinierungskreis.
|
|
2000:
|
Aufnahme in das Programm "Soziale Stadt", Beschäftigungsmaßnahmen, Abschluss der Baumaßnahmen, Polizeidienststelle.
|
|
2001:
|
Ende des Landesprogramms "Städtebauförderung".
|
|
2002:
|
Ende der Fördermittel "Soziale Stadt".
|
 Akteure der Stadtentwicklung Akteure der Stadtentwicklung
Folgende Akteure sind beteiligt: die Hansestadt Lübeck, federführend der Bereich Jugendamt/Jugendhilfe, der Bereich Jugendarbeit, die Stadtplanung (zuständig für die Städtebaufördermittel), Stadtteilmanagerin, Sanierungsträger, Vertreter der Wohnungseigentümer (Ehepaar Pogadl, "Neue Lübecker" eG), Kirche, Polizei, Fachhochschule, Beschäftigungsträger, Träger sozialer Dienste im Stadtteil, Bewohnerinnen und Bewohner.
 Stadtteilmanagement Stadtteilmanagement
Das so genannte Projektmanagement in Lübeck wurde vom Büro KOM PLAN aus Lübeck durchgeführt. Die Projektmanagerin wurde vom Fachbereich Stadtplanung beauftragt und von der Lenkungsgruppe und dem Koordinierungskreis beraten. Das Projektmanagement übernahm die Koordination des Projekts Hudekamp und führte alle notwendigen Voruntersuchungen durch (1998: aktivierende Bewohnerbefragung).
 Fazit, Perspektiven Fazit, Perspektiven
Die Überzeugungsarbeit des Projektmanagements führte zu einer hohen Mitwirkbereitschaft der Wohnungseigentümer und Bewohner. Vandalismus-, Kriminalitäts- und Leerstandsraten im Hudekamp sind seit Projektbeginn deutlich gesunken. Die Bewohnergespräche machen klar: die Verbesserungen werden deutlich wahrgenommen. Die ehrenamtliche Aktivierung der Bewohnerschaft wird durch professionelle Unterstützung dauerhaft gesichert. Nach Auslaufen der Förderung ist die Hansestadt Lübeck bereit, die Nachbarschaftseinrichtungen im Gebiet weiter zu finanzieren, um den Erfolg fortzusetzen. Allerdings müssen im Hudekamp noch stärker die Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen verbessert werden.
 Eingesetzte Mittel und Bündelungsansätze Eingesetzte Mittel und Bündelungsansätze
- Städtebauförderung Schleswig-Holstein: rund 1,5 Mio. Euro (drei Mio. DM).
- "Soziale Stadt": rund 256 000 Euro
- Stadt Lübeck: rund 500 000 Euro, davon wurden rund 300 000 Euro von der Possehl-Stiftung als Spende zur Verfügung gestellt, so dass die Stadt Lübeck de facto nur noch rund 200 000 Euro finanzieren musste.
- Mittel der Wohnungseigentümer: geförderte Investitionen rund 1,2 Mio. Euro (2,4 Mio. DM), über 2 Mio. Euro (4 Mio. DM) als Eigeninvestition.
- Beschäftigungsförderung: ABM (Concierge) rund 327 000 Euro (640 000 DM), rund 614 000 Euro (1,2 Mio. DM) für BSHG-Maßnahmen.
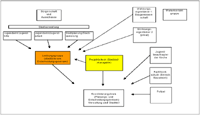 |
Organigramm Emden-Barenburg
Quelle: empirica, eigener Entwurf.
|
(1) ABM-Stelle, die zunächst auf ein Jahr befristet war und um ein weiteres Jahr bis 4/2003 verlängert wurde. Danach ist die Finanzierung der Stelle bislang noch offen. 
(2) Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen. 
(3) Gleichzeitig wurde die Abholfrequenz erhöht. 
|