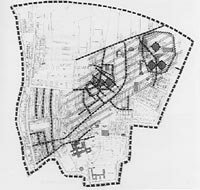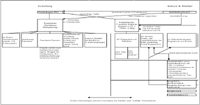|
Niedersachsen gehört zu den Bundesländern, die das Bund-Länder-Programm nicht an ein bereits existierendes, mit ähnlichen Zielen ausgerichtetes Vorläufer-Programm anschließen konnten. Somit gehört Emden zu den Städten, die tatsächlich "am Anfang" der Programm-Umsetzung stehen. Emdens größter Stadtteil Barenburg (8 090 Einwohner in 2001) grenzt an den nördlichen Rand der Emder Innenstadt. Dominierend ist die Wohnnutzung. Man unterscheidet: Alt-Barenburg, die Neue Heimat (Zeilenbauten) mit zwei Bauabschnitten, ein ehemaliges Kasernengelände, Einfamilien- und Reihenhausbebauung, die zwei "Glaspaläste" (elf-Geschosser) und den U-Block. Ein einheitliches Stadtbild fehlt. Einzelhandel und Versorgungsinfrastruktur gibt es nur in Alt-Barenburg.
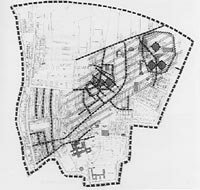 |
Abbildung 12: Lage des Programmgebietes Barenburg
Quelle: DI DEUTSCHE BAUBECON AG, Bremen (Vorbereitende Untersuchung)
|
 Probleme Probleme
Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Barenburg den Charakter einer "Durchgangsstation". Mitte der 80er-Jahre wurde zum ersten Mal über den Rückbau der Glaspaläste auf fünf Stockwerke nachgedacht. Ende der 80er-/Anfang der 90er-Jahre füllten sich die Wohnungen wieder durch den Zuzug vieler Übersiedler, Aussiedler und Asylsuchender. In Barenburg (Neue Heimat) ist die Anzahl an Nationalitäten von 51 (1994) auf 60 (1999) gestiegen. Problemnachbarschaften haben sich vor allem im Bereich der Klein-von-Diepold-Straße (Glaspaläste, U-Block) und der Neuen Heimat entwickelt, zwischenzeitlich stehen etwa die Hälfte der Wohnungen in einem der beiden Glaspaläste leer. Seit 1994 hat der Stadtteil über 16 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Der Anteil der HLU-Empfänger liegt in der Klein-von-Diepold-Straße bei rund 30 Prozent (darunter ca. 44 Prozent sind Kinder und Jugendliche), die Arbeitslosenquote beträgt rund 20 Prozent (vgl. Emdens Arbeitslosenquote: rund 12 Prozent).
- Wohnen: hoher Leerstand, städtebauliche Missstände, Sanierungs- und Modernisierungsbedarf (Wärmedämmung, Heizungsanlagen und Sanitärbereiche, Wohnungsgrundrisse), Vandalismus.
- Wohnumfeldqualität: Wohnumfelddefizite, Verwahrlosung der Spielflächen, ungenutzte, große Parkflächen im Wohngebiet, ungepflegtes Abstandsgrün.
- Bevölkerung: Hohe Bevölkerungsverluste, Resignation und Unsicherheit, Perspektivlosigkeit, überdurchschnittliche Anteile an Arbeitslosen, Transferabhängigen, Alleinerziehenden und Älteren, "Hot-spot" in der Klein-von-Diepold-Straße, Bewohner aus 60 Nationen, rund 16 Prozent Nichtdeutsche.
- Infrastruktur: Mangelnde Betreuungsangebote, Freizeiteinrichtungen, Räumlichkeiten, fehlende Infrastruktur (Dienstleistungen, Einzelhandel), Fehlen eines Zentrums.
- Image: negatives Außen- und Innenimage.
 Strategien, Ziele, Maßnahmen Strategien, Ziele, Maßnahmen
Von den Mehrgeschosswohnungsbauten (konzentrierte Punkte) sind verstärkt negative Entwicklungstendenzen zu beobachten, die durch Strategien einer sozialen und städtebaulichen Weiterentwicklung aufgehalten werden sollen.
- Maßnahmen zur Wohnqualität: Modernisierungsmaßnahmen, Abriss- und Rückbaudiskussionen für Mehrgeschosswohnungsbau.
- Maßnahmen zur Wohnumfeldqualität: Stadtteilbezogener Verschönerungsdienst, Straßensanierungen.
- Nicht-investive Maßnahmen: Einrichtung eines Bürgerbüros, Koordinator für Präventions- und Integrationsarbeit, Stadtteilzeitung, Fußball- und Tischtennisspielen, "Freunde werden durch Musik und Tanz", Buch: "Internationales Barenburg", Videoprojekte, Angebote für Migranten.
 "Good-Practice"-Maßnahmen "Good-Practice"-Maßnahmen
- Stadtteilzeitung: "Der Barenbürger" ist seit Beginn des Programms in der vierten Ausgabe erschienen und wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert, die unter anderem für die Dolmetscher (3 Sprachen) verwendet werden. Nach Auslaufen der Förderung sollte die Zeitung in einer paritätischen Trägerschaft zwischen Stadtteilbeirat, Bürgerverein und Verwaltung weitergeführt werden. Allerdings kam es zu Unvereinbarkeiten zwischen den Akteuren, sodass es mittlerweile zwei Stadtteilzeitungen im Gebiet gibt. "Der Barenbürger" wird in der beschriebenen Form vom Bürgerverein auch ohne Förderung fortgeführt. Die Kommune gibt seit Anfang 2002 gemeinsam mit dem Sanierungsträger eine "eigene" Zeitung - "Wir in Barenburg" - heraus.
- Internationale Kulturecke (Bibliothek) im Bürgerhaus: In der internationalen Bibliothek können seit Ende 2001 Bücher in mehreren Sprachen für unterschiedliche Altersklassen ausgeliehen werden. Gegenseitige Akzeptanz und Verständnis für andere Kulturen sowie eine Möglichkeit der Kommunikation unter den Bewohnern soll erreicht werden (unter anderem durch eine Verknüpfung mit den Nachmittagsangeboten der Grundschule, Lesungen usw.).
- Seminare (geplant): Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren Seminare für alle an der Stadtentwicklung Beteiligten in der Diskussion. Die Vermittlung von Kultur, Historie und rechtlich-politischer Situation anderer Ethnien soll die Kompetenz der Entscheidungsträger erhöhen.
- Multifunktionsfläche: Es handelt sich um eine erste bauliche Maßnahme im Gebiet, die mehrere Sportfelder, Spiel- und Freizeitflächen hat und generationenübergreifend genutzt werden kann. Das Wohnumfeld gewinnt an Qualität und Attraktivität. Es ist mit positiven Ausstrahlungseffekten zu rechnen, da dieses Projekt die erste "sichtbare" Veränderung im Gebiet darstellt (Eröffnung der Anlage war im November 2002).
- Hauptschule Barenburg als Ganztagsschule (geplant): Die Ganztagsschule Barenburg wäre eine optimale Ergänzung und Fortsetzung des Konzeptes der Ganztagsschule Grüner Weg (Grundschule). Zusätzliche Leistungsangebote würden die Kontakt- und Ereignisarmut der Schüler im Stadtteil verringern, im Gegenzug zu Selbstvertrauen, mehr Wissen und Kreativität führen.
- Grundschule Grüner Weg (Ganztagsschule seit 1997): Die positiven Erfahrungen mit dem Konzept führen dazu, dass Eltern aus anderen Stadtteilen versuchen, ihre Kinder dort anzumelden. Verbesserungen der Sprachkenntnisse, des Sozialverhaltens sowie der individuellen Fähigkeiten durch das Zusatzangebot haben positive Auswirkungen für Schüler, Eltern(-teile) und Lehrer.
-
Entwicklungsstand:
|
Seit 1978:
|
Bürgerverein Barenburg.
|
|
Seit 1989:
|
Bürgerbüro Barenburg (auch Stadtteilbüro genannt).
|
|
Juli 1999:
|
Vorbereitende Untersuchung.
|
|
November 1999:
|
Aufnahme ins Programm "Soziale Stadt", aus der "Sozialraumkonferenz" wird das "Stadtteiltreffen".
|
|
2000:
|
Gründungsstadtteilbeirat, später Stadtteilbeirat, Beginn sozialer Kleinprojekte (über LOS-Mittel der EU finanziert).
|
|
2001:
|
Planung der Multifunktionsfläche für Sport- und Freizeitaktivitäten, provisorische Jugendeinrichtung in der ehemaligen Tennisanlage.
Neue Stellen im Stadtteil (zeitlich begrenzt bis 4/2003): Stadtteilkoordinator, Streetworker, Sportpädagoge, Koordinator für Präventions- und Integrationsarbeit an den Schulen; außerdem Stadtteilbezogener Verschönerungsdienst (vier Mitarbeiter für sieben Monate im Winter 2001)
|
|
2002:
|
Eröffnung der Multifunktionsfläche (11/2002), Kauf der Tennisanlage durch die Stadt, um die dortige Jugendarbeit dauerhaft fortsetzen zu können. Intensive Diskussion um die Weiterbeschäftigung des Stadtteilkoordinators und Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten nach dem Auslaufen der ABM-Maßnahmen.
|

Glaspalast (Ost)
|

Glaspalast (West)
|

U-Block
|

Garagenanlage Nähe Glaspalast
|

Stadtteiltreff in Glaspalastanbau
|

Bürgerbüro Barenburg
|

Grundschule Grüner Weg
|

Alt-Barenburg
|

Neue Heimat
|
|
 Akteure der Stadtentwicklung Akteure der Stadtentwicklung
Folgende Akteure sind beteiligt: die Stadt Emden mit der Projektgruppe (federführend der Fachdienst Stadtplanung), Sanierungsträger, Stadtteilkoordinator, Stadtteilbeirat, Bürgerbüro, Bürgerverein, Freizeitinitiative e.V., Schulen, Kindergärten, Kirchen.
 Stadtteilmanagement Stadtteilmanagement
Im April 2001 wurde der Stadtteilkoordinator von der Stadt Emden eingestellt (1). Seine Aufgaben sind:
- Als Sprachrohr des Stadtteilbeirates leitet er Ideen und Beschlüsse an die Verwaltung weiter.
- Er nimmt die Aufgaben des Entwicklungsprogramms im Stadtteil wahr.
- Er ist Kommunikationskanal zwischen den Bürgern und der Verwaltung sowie den Bürgern und den Wohnungsgesellschaften (in der Hauptsache BauBeCon als Eigentümerin des Glaspalastes).
- Er nimmt Teilnahme an allen Arbeitsgruppen des Stadtteilbeirates teil.
- Er berät die Projektgruppe der Verwaltung.
- Zu festen Terminen und nach Absprache steht er den Bewohnern des Stadtteils im neuen Stadtteilbüro in der Heinrich-Heine-Straße zur Verfügung.
 Fazit, Perspektiven Fazit, Perspektiven
Das Fehlen von Vorläuferprogrammen, persönliche Differenzen unter den Akteuren sowie eine große Verdrossenheit bei den Bewohnern sorgten in Emden für massive Startschwierigkeiten, die zu verstetigen drohen. Noch konzentriert man sich zu stark auf ABM-gestützte Maßnahmen im Gebiet. Persönliche Differenzen verhindern die optimale Nutzung von Synergieeffekten. Erste bauliche und damit sichtbare Maßnahmen sind wichtig, Entscheidungen sollten zügiger gefällt und das vorhandene traditionsreiche Potenzial (Bewohnerengagement im Vereinswesen) vor Ort genutzt werden.
 Eingesetzte Mittel und Bündelungsansätze Eingesetzte Mittel und Bündelungsansätze
Insgesamt stehen für das Projekt Soziale Stadt rund 1,5 Mio. Euro (drei Mio. DM) zur Verfügung (2) sowie Mittel für ABM-Maßnahmen und Gelder der EU (LOS - Lokales Kapital für soziale Zwecke (Stand: 2002).
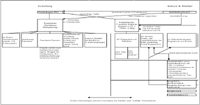 |
Organigramm Emden-Barenburg
Quelle: empirica, eigener Entwurf.
|
(1) ABM-Stelle, die zunächst auf ein Jahr befristet war und um ein weiteres Jahr bis 4/2003 verlängert wurde. Danach ist die Finanzierung der Stelle bislang noch offen. 
(2) Allerdings nur für städtebauliche Maßnahmen. 
|