soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
3.3 Zuschnitt der Programmgebiete
Bereits im Rahmen der traditionellen Städtebauförderung spielten und spielen die Größe und der Zuschnitt der Gebiete eine besondere Rolle für die Programmumsetzung, wobei Fragen der Finanzierbarkeit und der zügigen Durchführung im Vordergrund stehen. Letzterem entsprechend war der Zuschnitt der Sanierungsgebiete mit bundesweit durchschnittlich 10,6 Hektar (1984) relativ klein (1) . Dagegen sind die Programmgebiete der Sozialen Stadt mit durchschnittlich 126 Hektar zwölfmal so groß, ein Hinweis darauf, dass der stärker an integrierten Konzepten orientierte Stadterneuerungsansatz auch Veränderungen von Gebietsauswahl und -zuschnitt zur Folge hat. Eine Betrachtung der Stadtteile nur nach siedlungsstrukturellen, räumlich-funktionalen Aspekten reicht nicht mehr aus.
Dabei schwankt die Größe der für die Soziale Stadt ausgewählten Gebiete nach ihrer Fläche beträchtlich; sie reicht von 1 061 Hektar (Hagen - Vorhalle in Nordrhein- Westfalen) bis zu einem Hektar (Rostock - Schmarl und Schwabach - Schwalbenweg). Die mit Abstand gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 126 Hektar größten Gebiete hat das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Durchschnittswert von 287 Hektar ausgewiesen, gefolgt von Niedersachsen (255 Hektar) und Sachsen-Anhalt (187 Hektar). Die durchschnittlich kleinsten Programmgebiete finden sich in Rheinland-Pfalz (32 Hektar), Mecklenburg-Vorpommern (43 Hektar) und Berlin (63 Hektar). Die Länder Baden-Württemberg und Bayern haben mit dem Programmjahr 2001 deutlich größere Gebiete ausgewiesen, während sie noch bei der ersten Befragung auf den Plätzen 1 und 2 (2) der Rangliste mit den durchschnittlich kleinsten Programmgebieten rangierten.
Im Hinblick auf die Einwohnerzahl werden in der Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungsprogramms für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf in Nordrhein-Westfalen (3) mit Hinweis auf Diskussionen in Großbritannien über die "Idealgröße" von Gebieten für integrierte und bewohnergetragene Stadtteilerneuerungskonzepte eine "Mindestgröße" von 5 000 und eine "Höchstgröße" von 25 000 Einwohnern vorgeschlagen. In diesem Rahmen liegt auch die durchschnittliche Bevölkerungszahl der Programmgebiete; sie beträgt 8 415 Einwohner mit leichten Differenzen zwischen alten (8 225) und neuen (9 260) Bundesländern (4) ; darin spiegelt sich der höhere Anteil von Großsiedlungen in den neuen Bundesländern. Mit durchschnittlich 13 700 Einwohnern liegen die Programmgebiete in Sachsen- Anhalt an der Spitze, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Berlin. Die Gebiete mit der durchschnittlich geringsten Einwohnerzahl (rund 3 700 Einwohner) liegen in Niedersachsen, danach kommen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
|
Abbildung 26: Größe der Programmgebiete (Hektar: n=209; Einwohner: n=207; Zweite Befragung Difu 2002) |
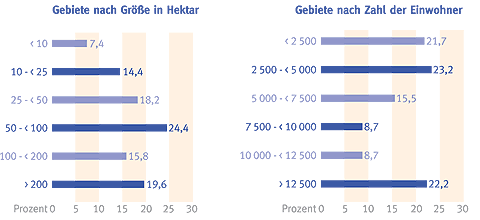 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
|
Tabelle 5: Größe der Programmgebiete im Ländervergleich (Zweite Befragung Difu 2002) |
||||||||
|
Größe (Hektar) |
Größe (Einwohner) |
|||||||
|
Minimum |
Maximum |
Mittelwert |
n |
Minimum |
Maximum |
Mittelwert |
n |
|
|
Baden-Württemberg |
5 |
518 |
90 |
14 |
531 |
16 379 |
4 706 |
13 |
|
Bayern |
1 |
930 |
116 |
26 |
51 |
95 367 |
8 574 |
27 |
|
Berlin |
15 |
103 |
63 |
14 |
4 404 |
19 636 |
12 020 |
14 |
|
Bremen |
7 |
354 |
129 |
11 |
890 |
25 478 |
8 863 |
11 |
|
Hamburg |
40 |
140 |
93 |
4 |
7 124 |
13 400 |
10 675 |
3 |
|
Hessen |
10 |
352 |
80 |
17 |
1 940 |
13 994 |
6 364 |
16 |
|
Niedersachsen |
4 |
255 |
56 |
22 |
797 |
10 312 |
3 721 |
21 |
|
Nordrhein-Westfalen |
8 |
1 061 |
287 |
32 |
1 216 |
40 693 |
13 289 |
33 |
|
Rheinland-Pfalz |
2 |
140 |
32 |
11 |
293 |
27 000 |
5 462 |
12 |
|
Saarland |
20 |
334 |
165 |
12 |
1 657 |
10 514 |
5 621 |
12 |
|
Schleswig-Holstein |
17 |
408 |
108 |
7 |
1 467 |
20 185 |
6 858 |
7 |
|
Gesamt alte Bundesländer |
1 |
1 061 |
128 |
170 |
51 |
95 367 |
8 225 |
169 |
|
Brandenburg |
24 |
235 |
102 |
8 |
1 950 |
17 730 |
9 309 |
8 |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
1 |
70 |
43 |
8 |
3 700 |
12 567 |
6 947 |
7 |
|
Sachsen |
22 |
352 |
112 |
9 |
994 |
28 891 |
6 955 |
9 |
|
Sachsen-Anhalt |
32 |
346 |
187 |
8 |
3 149 |
28 899 |
13 668 |
8 |
|
Thüringen |
30 |
445 |
146 |
6 |
2 349 |
22 825 |
9 575 |
6 |
|
Gesamt neue Bundesländer |
1 |
445 |
116 |
39 |
994 |
28 899 |
9 260 |
38 |
|
Gesamt |
1 |
1 061 |
126 |
209 |
51 |
95 367 |
8 415 |
207 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||||||||
Die erhebliche Bandbreite in der Bevölkerungszahl wird besonders augenfällig, wenn man sich beispielsweise die kleinsten Gebiete (Schwabach - Schwalbenweg mit nur 51 Einwohnern oder Am Luisenturm in Koblenz mit 293 Einwohnern) und die größten (München - Mittlerer Ring mit 95 000 Einwohnern, Dortmund - Nördliche Innenstadt mit rund 54 000 und Flingern/Oberbilk in Düsseldorf mit 41 000 Einwohnern) vor Augen führt. Bei den bevölkerungsreichsten Gebieten mit mehr als 25 000 Einwohnern fallen einerseits große gründerzeitliche Altstadtquartiere auf (z.B. Leipziger Osten, Köln - Kalk, Bremen - Gröpelingen), andererseits die Plattenbausiedlungen Ostdeutschlands (Halle - Neustadt, Berlin - Marzahn, Dresden - Prohlis).
Manche Städte und Gemeinden haben sehr große Areale mit einer Vielzahl von Teilräumen ausgewiesen, innerhalb derer teilweise auch "soziale Brennpunkte" oder "Probleminseln" deklariert werden. So wurde für das Modellgebiet Bremen - Gröpelingen im Dezember 2000 durch den Stadtteilbeirat beschlossen, die Programmumsetzung im Stadtteil "auf besonders benachteiligte Bereiche (,Fokusgebiet')" zu konzentrieren (5) . Im Leipziger Osten geht es ebenfalls darum, die Programmumsetzung auf "Kernbereiche" im Gebiet zu fokussieren (6) .
In anderen Kommunen scheint dagegen eher der Blickwinkel der im Wesentlichen investiv ausgerichteten Städtebauförderung die Sicht bestimmt zu haben (7) . Sehr kleine Gebiete, deren Zuschnitt sich fast ausschließlich am Investitionsvolumen der baulich-städtebaulichen Maßnahmen orientiert, stehen aber eher quer zu Erfordernissen der Sozialen Stadt. Dadurch wird beispielsweise erschwert, Potenziale des Umfelds zur Förderung der Lokalen Ökonomie oder benachbarte Infrastruktur in Entwicklungs- und Nutzungskonzepte einzubeziehen. Vor diesem Hintergrund wird z.B. in der nordrhein-westfälischen Evaluationsstudie für eine "erweiterbare flexible Gebietsabgrenzung" (8) oder auf dem Impulskongress zum Integrativen Handeln für die Berücksichtigung von "Ergänzungsgebieten" plädiert, die "institutionell abgesichert" werden sollten (9) . Diese Gebiete sind funktional und räumlich mit dem Programmgebiet verbunden und bieten für die Umsetzung der Strategien und Maßnahmen "Unterstützungspotenzial".
Interessant ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die kommunalen Ansprechpartner für die Stadtteile Auswahl und Zuschnitt ihres Programmgebiets als räumlich und sachlich "richtig" ansehen. Bei den Modellgebieten wurde die Schwierigkeit der Programmumsetzung für jene Gebiete hervorgehoben, in denen zwei relativ eigenständige Quartiere zu einem Gebiet zusammengefasst worden waren: Gelsenkirchen (Bismarck und Schalke-Nord), Hamburg - Lurup (Flüsseviertel und Lüdersring/Lüttkamp) und die Innenstadt Neunkirchen mit der Inhomogenität von Unterstadt und Oberstadt.
Danach befragt, ob die jeweilige Gebietsabgrenzung als "richtig" oder "falsch" beurteilt wird, wurde der Gebietszuschnitt für jene 201 Gebiete, für die Antworten vorliegen, in 157 Fällen (78 Prozent) als "richtig" bestätigt, vor allem, weil die zentralen Problemschwerpunkte räumlich einbezogen seien. Für 33 Programmgebiete (16 Prozent) lautet die Einschätzung "falsch", unter anderem, weil die Gebietsumgebung und dadurch für den Stadtteil wichtige Infrastruktur nicht berücksichtigt worden seien. Für elf Gebiete (fünf Prozent) wurde mit "unentschieden" ("teils/teils") geantwortet. Es fällt auf, dass in Schleswig-Holstein (für mehr als die Hälfte der Gebiete) und Niedersachsen (rund ein Viertel) die größte Skepsis hinsichtlich der Richtigkeit von Gebietsabgrenzungen besteht.
(1) Rainer Autzen, Heidede Becker, Rudolf Schäfer und Elfriede Schmidt, Erfahrungen mit der Sanierung nach dem Städtebauförderungsgesetz - Perspektiven der Stadterneuerung, Bonn-Bad Godesberg 1986, S. 51 f. (Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau Nr. 02.036). ![]()
(2) Baden-Württemberg mit durchschnittlich 35 Hektar großen Gebieten auf Rang 1 (heute beträgt die durchschnittliche Größe 90 Hektar), Bayern mit ursprünglich 39 Hektar auf Rang 2 (heute 116 Hektar). ![]()
(3) Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungsprogramms für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Dortmund 2000, S. 16 (ILS Schriften, Bd. 166). ![]()
(4) Gegenüber der ersten Befragung 2000/2001 haben sich die Größenordnungen angeglichen. Vorher gab es zwischen alten Bundesländern mit im Mittel rund 8 400 Bewohnern und neuen Bundesländern mit durchschnittlich 11 600 Bewohnern eine erheblich höhere Differenz. ![]()
(5) Franke/Meyer, S. 22. ![]()
(6) Böhme/Franke, Programmbegleitung, S. 22. ![]()
(7) Beispielsweise hinsichtlich des Modellgebiets Singen - Langenrain, bei dem die Stadt "Fördermittel für Investitionen nur auf einige Grundstücke begrenzen ... und die privaten Grundstücke in direkter Wohnnachbarschaft nicht mit einbeziehen" wollte. "Diese ,künstlich enge' Begrenzung wurde im Verlaufe des Entwicklungsprozesses mehrfach in Frage gestellt, da eine weitere Fassung des Gebietes im Hinblick auf die sozialen Belange zweckmäßiger wäre..." (Krings-Heckemeier/ Heckenroth/Geiss, S. 20). ![]()
(8) Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Analyse der Umsetzung, S. 18. ![]()
(9) Spiegel, Integrativ, kooperativ, aktivierend, S. 33. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005



