soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
3.2 Probleme und Potenziale als Auswahlkriterien
Im Schlüssel für die Verteilung der Bundesmittel zum Programm Soziale Stadt auf die Länder sind im Gegensatz zur traditionellen Städtebauförderung soziale Aspekte berücksichtigt, die einen ersten Hinweis auf Kriterien für den "besonderen Entwicklungsbedarf" geben. Neben der zu je einem Drittel angerechneten Zahl der Gebietsbevölkerung und der Zahl der Wohnungen wurde für die Programmjahre 1999 bis 2000 auch die landesbezogene Arbeitslosenquote zu einem Drittel berücksichtigt (1) . Auf Beschluss der Bauministerkonferenz vom 7. und 8. Dezember 2000 verständigten sich Bund und Länder "einvernehmlich" auf einen leicht veränderten Verteilungsschlüssel für 2001 und die Folgejahre. Bei diesem Schlüssel kommt zu einem Drittel (= 3/9) ein "Sozial- und Integrationsfaktor" zum Tragen, der sich "zu 2/9 nach der Arbeitslosenquote und zu 1/9 nach den Integrationsaufgaben" (2) richtet.
Welche Probleme, aber auch Potenziale gemessen an welchen Indikatoren bieten nun den Anlass, Gebiete als "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf" auszuweisen? Die Ergebnisse beider Befragungen belegen ein breites Spektrum an vielfach genannten Problemen, die sich in den Programmgebieten überlagern (Abbildung 19). Nicht überraschend werden Probleme im baulich-städtebaulichen Bereich wie Modernisierungsrückstand und Desinvestition bis hin zu Verfall sowie Wohnumfeldmängel am häufigsten genannt. Es folgen Defizite der sozialen und kulturellen Infrastruktur, der Nahversorgungsangebote und der öffentlichen Räume.
Darüber hinaus werden das Fehlen von Einrichtungen und Angeboten im sozialstrukturellen Bereich, unter anderem hinsichtlich Arbeit und Beschäftigung, sowie Konflikte im Zusammenleben beklagt. Bei den Potenzialen und Ressourcen, die den Programmgebieten zugeschrieben werden (Abbildung 20), wird ebenfalls vor allem der baulich-städtebauliche Bereich angeführt, beispielsweise Instandsetzungs- und Modernisierungsmöglichkeiten, Entwicklungs- und Gestaltungspotenziale der Grün- und Freiflächen; doch wurden für immerhin auch etwa die Hälfte der Gebiete die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung, Ausbauchancen für die Lokale Ökonomie und der sozialkulturellen Infrastruktur genannt.
|
Abbildung 19: Probleme in den Programmgebieten (n=222, Mehrfachnennungen; Erste und Zweite Befragung Difu 2000/2001 und 2002)* |
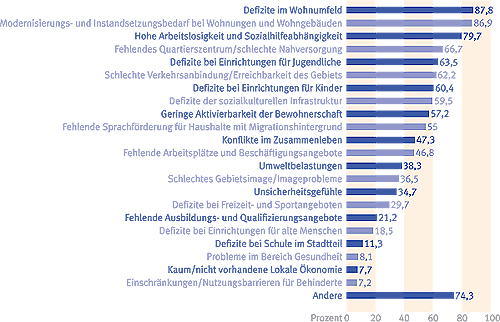 |
|
* Fragen nach Problemen in den Programmgebieten sowie nach Zielen für die Maßnahmen bildeten den Schwerpunkt der ersten Befragung, wurden für die neu einbezogenen Gebiete des Programmjahrs 2001 aber auch im Rahmen der zweiten Befragung gestellt. |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
|
Abbildung 20: Ressourcen und Potenziale in den Programmgebieten (n=222, Mehrfachnennungen; Erste und Zweite Befragung Difu 2000/2001 und 2002)* |
 |
|
* Fragen nach Ressourcen und Potenzialen in den Programmgebieten sowie nach Zielen für die Maßnahmen bildeten den Schwerpunkt der ersten Befragung, wurden für die neu einbezogenen Gebiete des Programmjahrs 2001 aber auch im Rahmen der zweiten Befragung gestellt. |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Die Bevölkerung in den Programmgebieten der Sozialen Stadt ist durch Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebedürftigkeit - und dies sind die zentralen Auswahlkriterien für die Stadtteile - stärker als die der jeweiligen Gesamtstadt geprägt. Es handelt sich teilweise um Stadtteile, die weitgehend vom Erwerbsleben abgekoppelt sind. Die Programmgebiete in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und im Saarland weisen die durchschnittlich höchsten Arbeitslosenquoten auf. Im Vergleich zwischen Quartier und Gesamtstadt (3) wird der "besondere Entwicklungsbedarf" hinsichtlich dieses Indikators offensichtlich: in mehr als der Hälfte der Quartiere (53 Prozent) beträgt die Arbeitslosenquote (4) und mehr Prozent, dagegen weisen nur 19 Prozent der einbezogenen Gesamtstädte eine Arbeitslosenquote von 15 und mehr Prozent auf (Abbildung 21).
|
Abbildung 21: Arbeitslosenquote in Stadt und Quartier (n=99; Zweite Befragung Difu 2002) |
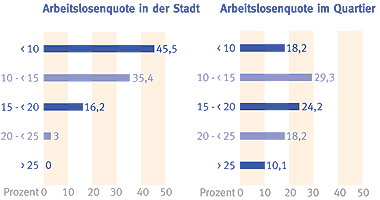 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
|
Abbildung 22: Sozialhilfequote in Stadt und Quartier (n=118; Zweite Befragung Difu 2002) |
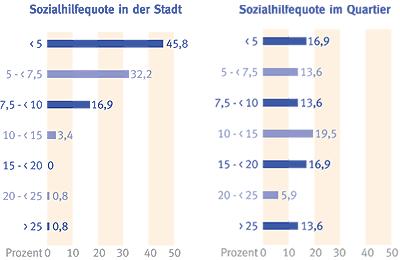 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Was Sozialhilfeabhängigkeit betrifft, ist auffällig, dass Programmgebiete in den alten Bundesländern deutlich massiver betroffen sind als die in den neuen. Die Programmgebiete in den Ländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Schleswig- Holstein rangieren auf den vorderen Rängen. Hinsichtlich der Sozialhilfequoten wird die besondere Belastung der Programmgebiete gegenüber dem gesamtstädtischen Durchschnitt ebenfalls deutlich bestätigt: Quoten von unter fünf Prozent weisen 46 Prozent der Städte auf, aber nur 17 Prozent der Quartiere. Umgekehrt verhält es sich bei den höheren Quoten von zehn Prozent und mehr; hier beträgt der Anteil der Städte nur fünf Prozent, von den Quartieren dagegen weisen mehr als die Hälfte (58 Prozent) solche Quoten auf.
|
Tabelle 3: Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten (Quartier) im Ländervergleich (Zweite Befragung Difu 2002) |
||||||||
|
Arbeitslosenquote |
Sozialhilfequote |
|||||||
|
Minimum |
Maximum |
Mittelwert |
n |
Minimum |
Maximum |
Mittelwert |
n |
|
|
Baden-Württemberg |
4,8 |
20,0 |
9,4 |
4 |
2,8 |
55,0 |
20,3 |
9 |
|
Bayern |
3,2 |
18,1 |
8,6 |
12 |
2,4 |
31,0 |
8,5 |
16 |
|
Bremen |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
|
18,0 |
18,0 |
18,0 |
1 |
|
Hamburg |
9,0 |
12,9 |
10,7 |
3 |
14,0 |
21,0 |
17,0 |
3 |
|
Hessen |
7,1 |
25,8 |
13,5 |
7 |
5,8 |
23,3 |
15,4 |
13 |
|
Niedersachsen |
8,8 |
35,0 |
19,9 |
13 |
6,4 |
57,9 |
23,4 |
20 |
|
Nordrhein-Westfalen |
6,8 |
32,0 |
16,8 |
16 |
4,3 |
28,1 |
12,5 |
25 |
|
Rheinland-Pfalz |
12,2 |
18,8 |
14,4 |
5 |
6,6 |
53,9 |
18,8 |
7 |
|
Saarland |
13,3 |
29,0 |
19,9 |
5 |
2,9 |
25,1 |
10,1 |
9 |
|
Schleswig-Holstein |
18,0 |
31,0 |
23,7 |
6 |
14,8 |
28,2 |
20,2 |
7 |
|
Berlin |
7,7 |
20,0 |
13,8 |
14 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
1 |
|
Gesamt alte Bundesländer |
3,2 |
35,0 |
15,3 |
85 |
2,4 |
57,9 |
15,7 |
111 |
|
Brandenburg |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
1 |
5,5 |
10,0 |
7,8 |
2 |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
9,1 |
20,5 |
15,7 |
7 |
3,0 |
50,0 |
19,3 |
3 |
|
Sachsen |
15,3 |
20,0 |
18,5 |
4 |
3,0 |
7,5 |
5,2 |
4 |
|
Sachsen-Anhalt |
17,4 |
27,9 |
22,5 |
4 |
3,2 |
10,0 |
7,2 |
4 |
|
Thüringen |
6,9 |
27,0 |
18,2 |
5 |
3,3 |
5,0 |
4,3 |
3 |
|
Gesamt neue Bundesländer |
6,9 |
27,9 |
18,2 |
21 |
3,0 |
50,0 |
8,5 |
16 |
|
Gesamt |
3,2 |
35,0 |
15,9 |
106 |
2,4 |
57,9 |
14,8 |
127 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||||||||
In der Regel bildet die Kumulierung der Befunde zu Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von Sozialhilfe den Schwerpunkt für die Begründung der Gebietsauswahl, in einzelnen Fällen noch ergänzt um Bevölkerungsrückgang sowie um qualitative Merkmale wie Negativimage, soziale Konflikte, Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, Vereinsamung und Unsicherheitsgefühle.
Für ein Drittel aller Programmgebiete (72 Gebiete) wurden Leerstandsquoten gemeldet, wobei dieses Problem ganz offensichtlich und nicht unerwartet in den neuen Bundesländern (in 83 Prozent aller Gebiete) häufiger auftritt als in den alten (21 Prozent) 15. In mehr als einem Fünftel der Programmgebiete in den neuen Bundesländern liegt der Leerstand in den Quartieren bei über 20 Prozent und reicht teilweise bis zu 40 Prozent. Allerdings ist dies deutlich auch ein Problem in den alten Bundesländern, denn zwei Drittel der Programmgebiete mit den höchsten Leerstandsquoten liegen dort (5) .
In den alten Bundesländern spielen bei der Gebietsauswahl offenbar auch überdurchschnittlich hohe Anteile von Haushalten mit Migrationshintergrund - teilweise bis über 50 Prozent - eine Rolle.
|
Abbildung 23: Anteil der Migrantinnen und Migranten in Stadt und Quartier (n=177; Zweite Befragung Difu 2002). |
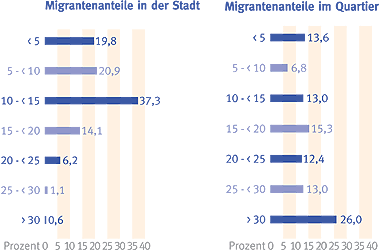 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Bei den Programmgebieten der Sozialen Stadt handelt es sich hinsichtlich ihrer Bevölkerungsstruktur um relativ junge Quartiere. Die durchschnittlichen Anteile von jungen Menschen (bis 18 Jahre) in den Quartieren weichen deutlich vom gesamtstädtischen Durchschnitt ab; während ein höherer durchschnittlicher Kinder- und Jugendlichenanteil von einem Fünftel und größer nur für zwölf Prozent der einbezogenen Gesamtstädte gemeldet wird, weisen 55 Prozent der Quartiere solche Anteile auf (Abbildung 24). Umgekehrt gibt es in den Stadtteilen überproportional weniger alte Menschen (Abbildung 25).
|
Tabelle 4: Anteil der Migrantinnen und Migranten (Quartier) im Ländervergleich (Zweite Befragung Difu 2002) |
||||
|
Anteil der Migrantinnen und Migranten |
||||
|
Minimum |
Maximum |
Mittelwert |
n |
|
|
Baden-Württemberg |
17,1 |
46,0 |
31,3 |
12 |
|
Bayern |
3,4 |
45,0 |
22,6 |
26 |
|
Bremen |
12,9 |
52,1 |
27,6 |
11 |
|
Hamburg |
19,5 |
31,0 |
26,5 |
3 |
|
Hessen |
7,3 |
52,0 |
28,3 |
15 |
|
Niedersachsen |
2,2 |
51,3 |
23,6 |
20 |
|
Nordrhein-Westfalen |
10,0 |
57,2 |
26,1 |
33 |
|
Rheinland-Pfalz |
3,4 |
40,4 |
18,7 |
11 |
|
Saarland |
5,2 |
29,7 |
16,1 |
10 |
|
Schleswig-Holstein |
6,0 |
28,3 |
19,8 |
7 |
|
Berlin |
7,6 |
55,2 |
29,2 |
13 |
|
Gesamt alte Bundesländer |
2,2 |
57,2 |
24,8 |
161 |
|
Brandenburg |
2,1 |
5,0 |
3,7 |
3 |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
1,6 |
11,7 |
3,8 |
7 |
|
Sachsen |
0,6 |
27,0 |
5,2 |
8 |
|
Sachsen-Anhalt |
1,8 |
8,2 |
3,5 |
6 |
|
Thüringen |
2,4 |
4,0 |
3,4 |
3 |
|
Gesamt neue Bundesländer |
0,6 |
27,0 |
4,1 |
27 |
|
Gesamt |
0,6 |
57,2 |
21,8 |
188 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||||
|
Abbildung 24: Anteile von Kindern und Jugendlichen (bis zu 18 Jahre) in Stadt und Quartier (n=163; Zweite Befragung Difu 2002) |
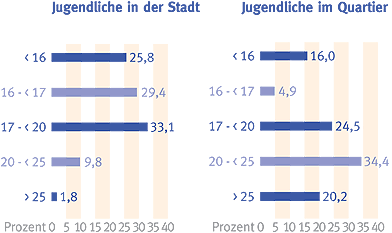 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
|
Abbildung 25: Anteile von alten Menschen (über 60 Jahre) in Stadt und Quartier (n=154; Zweite Befragung Difu 2002) |
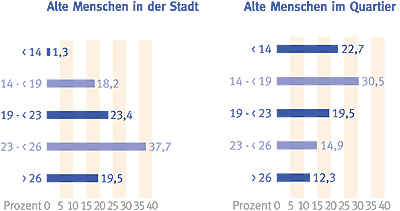 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
(1) Hierzu und zum Folgenden Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Peter Götz, Dr.-Ing. Dietmar Kansy, Dirk Fischer (Hamburg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU . Drucksache 14/6085, Das Programm "Die soziale Stadt" in der Bewährungsphase und seine Zukunftsperspektiven für die Städte und Gemeinden, Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/7459 vom 14.11.2001, S. 14 ff. ![]()
(2) "Für den Faktor ,Integrationsaufgabe' ist die landesbezogene Zahl der Ausländer maßgeblich", ebenda, S. 16. ![]()
(3) In die Vergleiche der Indikatorenausprägung zwischen Quartier und Gesamtstadt wurden nur die Programmgebiete einbezogen, bei denen sowohl für das Quartier als auch für die Gesamtstadt Angaben gemacht werden konnten. ![]()
(4) Allerdings konnten nur für 32 Prozent aller Gebiete und für 22 Prozent der Städte Leerstandsquoten genannt werden; vgl. Abbildung 102. in Kapitel 9. ![]()
(5) Dabei handelt es sich um die Gebiete: Augsburg - Oberhausen-Nord (50 Prozent) in Bayern, Koblenz - Am Luisenturm (43 Prozent) und Kaiserslautern - Am Kalkofen (31 Prozent) in Rheinland- Pfalz, Delmenhorst - Wollepark (40 Prozent), Stade - Altländer Viertel (37 Prozent), Fallingbostel - Wohngebiet Weinberg (31 Prozent) und Northeim - Südstadt (30 Prozent) in Niedersachsen, Wittenberge - Jahnschulviertel (40 Prozent) in Brandenburg, Zwickau - Eckersbach (40 Prozent) in Sachsen, Wolfen - Nord in Sachsen-Anhalt (33 Prozent) sowie Sondershausen - Hasenholz-Östertal (33 Prozent) in Thüringen. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005