soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
6.5 "Neue Mittelbündelung"
Ressourcenbündelung bedeutet koordiniertes Handeln verschiedener Fördermittelgeber und abgestimmter Einsatz von finanziellen und personellen Ressourcen aus unterschiedlichen Politikfeldern auf der Basis Integrierter Handlungskonzepte. Während die Städtebauförderung traditionell mit den Mitteln der Wohnungsbauförderung, des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes und des Gemeindefinanzierungsgesetzes verbunden wird, verfolgt das Programm Soziale Stadt einen weitergehenden Ansatz. Durch den Einsatz von "neuen" Förderungsmöglichkeiten werden insbesondere soziale, kulturelle, beschäftigungs- und wirtschaftspolitische Projekte und Maßnahmen gefördert, die bisher kaum im Zusammenhang mit Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung gesehen wurden, denen aber bei den Zielen und Strategien des Programms Soziale Stadt besonderes Gewicht zukommt. Darüber hinaus sollen die Kooperation zwischen den Ämtern durch das Programm verbessert und die Effektivität der Mittelkoordination gesteigert werden.
Zu den traditionell im Rahmen der Städtebauförderung eingesetzten Mitteln gehören:
- Mittel aus Bund-Länder-Programmen: Städtebauförderung, Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete (WENG), Städtebaulicher Denkmalschutz und Stadtumbau Ost;
- Bundesmittel: Wohnungsbauförderungsmittel, Mittel des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt), Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG);
- Landesmittel: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, Förderung der Stadtentwicklung/-erneuerung, Förderung der Wohnumfeldverbesserung, Denkmalschutzförderung und Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG);
- Mittel aus Gemeinschaftsaufgaben: Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes;
- andere Mittel: Mittel der Wohnungswirtschaft und Mittel von Privaten.
Zu den Mitteln, die bisher nicht regelmäßig mit der Städtebauförderung verbunden wurden und deren koordinierter Einsatz auch gemeinsam mit den traditionellen Mitteln eines der Kennzeichen für "Neue Mittelbündelung" ist, zählen folgende:
- EU-Mittel: Strukturfonds-Mittel aus EFRE/Ziel 1/Ziel 2, Strukturfonds-Mittel aus ESF/Ziel 1/Ziel 2 (XENOS und andere), Mittel aus Gemeinschaftsinitiativen (URBAN, INTERREG, EQUAL, LEADER+) und Mittel aus Aktionsprogrammen (SAVE, DAPHNE, JUGEND, LIFE, Programm "Drittes System und Beschäftigung" und andere);
- Bundesmittel: Ausbildungsförderung, Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ) des E & C-Programms (BMFSFJ), Integration von Aussiedlern (BMI) und Mittel der Arbeitsverwaltung;
- Landesmittel: Wirtschaftsförderung, Förderung von Schule/Hochschule und Ausbildung, Jugendförderung aus dem Landesjugendplan, Förderung von nichtinvestiven sozialen Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt (Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt [HEGISS] und andere);
- kommunale Mittel: Hilfe zum Lebensunterhalt (nach BSHG);
- Mittel aus Gemeinschaftsaufgaben: Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur;
- andere Mittel: Mittel von Wirtschaftsunternehmen, freien Trägern und Stiftungen.
Während die erste Befragung des Difu bei den Programmgebieten der Förderjahrgänge 1999 und 2000 noch gezeigt hat, dass sich die Bündelung in den weitaus meisten Fällen auf die traditionellen Felder der Städtebauförderung beschränkte, ergibt sich aus der zweiten Befragung, dass bereits in zwei Dritteln der Gebiete "neue" Fördermittel des Bundes zum Einsatz kommen. Bei den Landesmitteln sind es dagegen nur in einem Drittel der Gebiete Mittel aus anderen Politikfeldern. In zwölf Gebieten wurden auch Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingesetzt.
|
Tabelle 14: Einsatz neuer Förderprogramme nach Ländern* (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
|||||
|
Einsatz neuer Förderprogramme (in Prozent)** |
n |
||||
|
der EU |
des Bundes |
des Landes |
der Kommune |
||
|
Baden-Württemberg |
0,0 |
35,7 |
7,1 |
64,3 |
14 |
|
Bayern |
17,2 |
48,3 |
20,7 |
41,4 |
29 |
|
Berlin |
100,0 |
50,0 |
28,6 |
14,3 |
14 |
|
Bremen |
27,3 |
81,8 |
0,0 |
27,3 |
11 |
|
Hamburg |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
4 |
|
Hessen |
5,9 |
70,6 |
82,4 |
58,8 |
17 |
|
Niedersachsen |
39,1 |
69,6 |
13,0 |
56,5 |
23 |
|
Nordrhein-Westfalen |
31,4 |
71,4 |
68,6 |
60,0 |
35 |
|
Rheinland-Pfalz |
13,3 |
73,3 |
20,0 |
53,3 |
15 |
|
Saarland |
83,3 |
75,0 |
33,3 |
33,3 |
12 |
|
Schleswig-Holstein |
42,9 |
71,4 |
14,3 |
71,4 |
7 |
|
Alte Länder gesamt |
30,9 |
64,0 |
32,0 |
51,1 |
181 |
|
Brandenburg |
0,0 |
87,5 |
12,5 |
50,0 |
8 |
|
Mecklenburg-Vorpommern |
44,4 |
66,7 |
33,3 |
77,8 |
9 |
|
Sachsen |
44,4 |
88,9 |
77,8 |
22,2 |
9 |
|
Sachsen-Anhalt |
55,6 |
77,8 |
11,1 |
55,6 |
9 |
|
Thüringen |
0,0 |
66,7 |
16,7 |
33,3 |
6 |
|
Neue Länder gesamt |
36,4 |
79,5 |
36,4 |
45,5 |
41 |
|
Gesamt |
32,0 |
67,1 |
32,9 |
50,0 |
222 |
|
* Die Prozentangaben in der Tabelle beziehen sich jeweils auf die Fallangaben in der rechten Spalte (n). Beispiel Mecklenburg-Vorpommern: von den neun Soziale-Stadt-Gebieten des Landes haben 44,4 Prozent neue Förderprogramme der EU, 66,7 Prozent des Bun des, 33,3 Prozent des Landes und 77,8 Prozent neue kommunale Mittel eingesetzt. **Einzelne Prozentangaben (insbesondere 0,0) für neue EU-Förderprogramme mögen darauf zurückzuführen sein, dass die Quartiere nicht in den Zielgebieten für EU-Förderung liegen oder dass die jeweiligen EU-Mittel in Programme der Länder einfließen und damit nicht benannt werden. In den Stadtstaaten wird möglicherweise nicht zwischen Landesmitteln und kommunalen Mitteln differenziert, woraus sich die 0,0 Prozent-Angabe für den Einsatz neuer Landes-Förderprogramme ergeben könnte. |
|||||
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
|||||
Bei einem Vergleich der Bundesländer hinsichtlich des Einsatzes von "neuen" Fördermöglichkeiten des Bundes fällt auf, dass dieser im Durchschnitt in 67 Prozent aller Gebiete gelingt, dass aber Baden-Württemberg mit 36 Prozent und Bayern mit 48 Prozent deutlich zurückbleiben. Auch Berlin liegt mit 50 Prozent der Fälle von Verwendung "neuer" Bundesmittel deutlich unter dem Durchschnitt. Die neuen Bundesländer liegen hier fast durchweg an der Spitze mit Werten teilweise von fast 90 Prozent (Sachsen). Bei den Ländern, deren Mittelbündelung qualitativ über die Anwendung der traditionellen Länderförderprogramme hinausgeht, liegen Hessen mit 82 Prozent, Sachsen mit 78 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 69 Prozent deutlich über dem Gesamtdurchschnitt von 33 Prozent der Gebiete mit solcher Art von Fördermitteleinsatz. Bei den "neuen" kommunalen Mitteln ist die Streubreite um den Durchschnitt von 50 Prozent etwas geringer. Hier liegen Mecklenburg- Vorpommern mit 78 Prozent, Schleswig-Holstein mit 71 Prozent und Baden- Württemberg mit 64 Prozent vorn. Sachsen dagegen liegt mit 22 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.
Insgesamt liegen die neuen Länder, was den Einsatz "neuer" Förderquellen angeht, bei den EU-Mitteln mit 36 Prozent gegenüber 31 Prozent, bei den Bundesmitteln mit 80 Prozent gegenüber 64 Prozent, bei den Landesmitteln mit 36 Prozent gegenüber 32 Prozent vor den alten Ländern. Nur bei den kommunalen Mitteln liegen die alten Länder mit 51 Prozent gegenüber 46 Prozent knapp vorn.
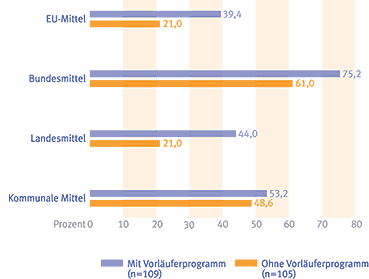 |
Abbildung 74: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Der Einsatz "neuer" Fördermittel gelingt offenbar besser, wenn bereits Erfahrungen mit einem Vorläuferprogramm ähnlichen Ansatzes vorliegen. Insgesamt 109 Programmgebiete wurden aus einem solchen Vorläuferprogramm in das Programm Soziale Stadt übergeleitet (1) . In 75 Prozent dieser Gebiete werden "neue" Bundesmittel eingesetzt, wohingegen es in Gebieten ohne Vorläuferprogramm nur 61 Prozent sind. Bei den Landesmitteln ist dieser Unterschied noch deutlicher: Hier sind es 44 Prozent, die "neue" Mittel einsetzen, wenn ein Vorläuferprogramm vorhanden war, gegenüber nur 21 Prozent, wenn dies nicht der Fall war. Dies lässt bei längerer Laufzeit des Programms Soziale Stadt erwarten, dass der Einsatz "neuer" Förderquellen zunehmen und dementsprechend auch die integrierte Vorgehensweise zur Bewältigung der Probleme und Entwicklung der Potenziale in den Gebieten weitere Fortschritte machen wird.
Von großer Bedeutung für die Nutzung "neuer" Mittel ist auch das Vorhandensein eines Integrierten Handlungskonzepts. Liegt ein solches vor, so gelingt der Einsatz von "neuen" Bundesmitteln in 75 Prozent der Fälle, liegt es nicht vor, sind dies lediglich 62 Prozent der Gebiete. Dasselbe gilt für "neue" Landesmittel, hier liegen die Werte bei 42 Prozent mit Integriertem Handlungskonzept und bei nur 17 Prozent ohne ein solches Konzept. Die geringste Auswirkung hat ein Integriertes Handlungskonzept bei den "neuen" Kommunalmitteln: Hier werden in 55 Prozent der Gebiete mit Integriertem Handlungskonzept "neue" kommunale Fördermittel eingesetzt, aber auch in Gebieten ohne ein solches werden in immerhin 41 Prozent "neue" Mittel genutzt.
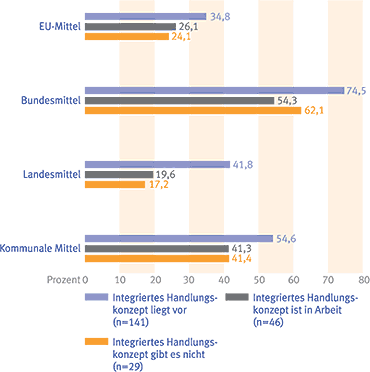 |
Abbildung 75: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Ressourcenbündelung ist aber nicht auf die Bündelung finanzieller Mittel beschränkt, sondern schließt auch eine verbesserte Kooperation der Akteure verschiedener Politikfelder ein. Die zweite Befragung des Difu hat ergeben, dass eine solche Verbesserung der Kooperation der Ressorts in Gebieten mit Vorläuferprogramm weniger häufig bejaht wird als in solchen ohne Vorläuferprogramm. Für 59 Prozent der Gebiete mit Vorläuferprogramm (n=108) wird angegeben, dass sich die Kooperation verbessert habe, wohingegen der entsprechende Anteil in Gebieten ohne Vorläuferprogramm (n=99) 70 Prozent beträgt. In diesen Gebieten ist demnach offenbar der Bedarf, aber auch das Potenzial für eine Intensivierung der Kooperation höher.
In diesem Zusammenhang ist auch das Integrierte Handlungskonzept besonders bedeutsam. Liegt es vor, so wird aus 71 Prozent der Gebiete (n=140) berichtet, dass sich die Kooperation deutlich verbessert habe. Ohne ein solches Konzept kann dies nur für 30 Prozent der Gebiete konstatiert werden (n=27). Die Größe der Gemeinde hat hierbei dagegen eher geringe Bedeutung. Aus durchschnittlich zwei Dritteln der Gebiete über alle Größenklassen (n=191) hinweg wird eine verbesserte Kooperation durch das Programm Soziale Stadt beschrieben. Lediglich bei Gemeinden unter 20 000 Einwohnern (n=13) wird dies nur für 23 Prozent der Gebiete angegeben. Zwischen den Ländern sind die Unterschiede nicht sehr groß. So berichten in den neuen Ländern (n=43) 54 Prozent von einer verbesserten Kooperation, in den alten Ländern (n=172) sind es 66 Prozent.
Ein weiteres Ziel des Programms Soziale Stadt liegt im effektiven Einsatz der begrenzten Mittel. Die Verwendung von Bundesmitteln, die über die traditionell in der Städtebauförderung eingesetzten Mittel hinausreichen, wird in 71 Prozent (n=115) der Gebiete als sehr effektiv eingeschätzt. In dieser Hinsicht ist der entsprechende Anteil bei den Landes- und Kommunalmitteln geringer. Auch insoweit wird demnach der Effekt des Programms Soziale Stadt trotz der noch sehr kurzen Laufzeit recht positiv eingeschätzt.
|
Abbildung 76: Einsatz neuer Förderprogramme: Verbesserung der Koordination zwischen den Ämtern und der Effektivität der Mittelkoordination (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
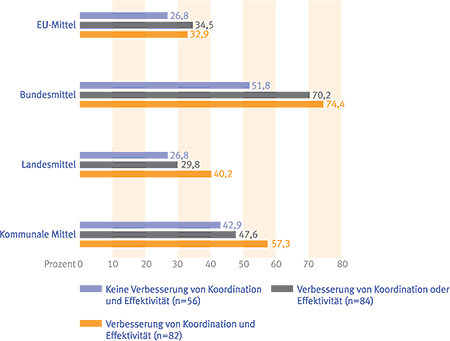 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Von einer "neuen Mittelbündelung" im eigentlichen Sinne lässt sich nur sprechen, wenn neben dem Einsatz "neuer" Förderquellen auch eine Verbesserung der Kooperation der Ressorts und eine Steigerung der Effektivität bei der Mittelbündelung erreicht werden. In besonderem Maße scheint dies im Zusammenhang mit Bundesmitteln zu gelingen. So werden in 74 Prozent der Gebiete, in denen Verbesserungen für beide Bereiche dokumentiert sind, "neue" Bundesmittel eingesetzt, gegenüber nur 52 Prozent in den Gebieten, in denen keine positive Veränderung bei Koordination und Effektivität genannt wurde. Auch die Verbesserung in nur einem Bereich wurde mit 70 Prozent am häufigsten angegeben, wenn Bundesmittel zum Einsatz kamen.
Ein wichtiges Indiz dafür, dass eine verbesserte Kooperation auch zu vermehrtem Einsatz "neuer" Fördermittel und zur Steigerung der Effektivität der Mittelverwendung führt, könnte darin liegen, dass im Schnitt für drei Viertel aller Gebiete, bei denen die Finanzverwaltung in die Aufstellung des Integrierten Handlungskonzepts eingebunden war, über den Einsatz "neuer" Fördermittel berichtet wird. Die Annahme, das Programm übernehme eine Initiativfunktion für eine stärker kooperativ agierende Verwaltung, scheint damit zumindest plausibel. Diese Tendenz wird nach den Erfahrungen der PvO-Teams bestätigt. Modellgebiete in Bundesländern mit Vorläuferprogrammen zeigen ein vergleichsweise komplexeres Verständnis von Mittelbündelung, das einhergeht mit kooperativeren Verwaltungsstrukturen und zumeist einer zentralen Steuerung der Mittelbündelung (2).
(1) In 105 Gebieten gab es kein Vorläuferprogramm, und in acht der befragten Gebiete wurden hierzu keine Angaben gemacht. ![]()
(2) Vgl. das Resümeepapier der PvO-Teams im Anhang 2. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005