soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
6.3 Ressourcenbündelung auf kommunaler Ebene
Trotz Bündelungsbemühungen auf Bundes- und Landesebene findet Mittelbündelung hauptsächlich und mit einem sehr hohen Koordinationsaufwand auf der kommunalen Ebene, der Quartiersebene sowie in den Projekten statt. Bei der Bündelung von Mitteln geht es nicht allein um das gebietsbezogene Zusammenführen verschiedener Fördertöpfe, sondern auch um die Verbesserung der Kooperation verschiedener Behörden oder Verwaltungsbereiche. Für mehr als 60 Prozent der Programmgebiete wird in diesem Zusammenhang berichtet, dass sich die Kooperation zwischen den Ämtern seit Beginn der Programmumsetzung verbessert oder sogar sehr verbessert hat.
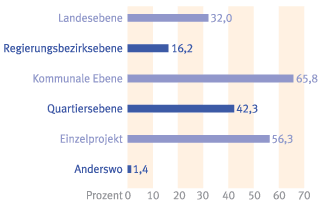 |
Abbildung 70: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
In vielen Programmgebieten wurden ämter- oder dezernatsübergreifende Lenkungsgremien zur Steuerung der Programmumsetzung eingesetzt (1). Dennoch berichten einige PvO-Teams über einen hohen Abstimmungsaufwand auf kommunaler Ebene zwischen den verschiedenen Verwaltungssektoren, ohne dass leistungsfähige Organisations- und Managementstrukturen in der Verwaltung geschaffen würden. So bleibt es bei einer rein additiven Verknüpfung verschiedener Förderprogramme. Hinzu kommt, dass in vielen Gebieten das Programm Soziale Stadt nicht nur als Investitions- und Leitprogramm für den Einsatz kommunaler Ressortmittel verstanden wird, sondern als zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für bereits geplante Maßnahmen, die ansonsten aufgrund der prekären kommunalen Haushaltslagen nicht umgesetzt werden können. Trotz aller Schwierigkeiten bei der Bündelung von Ressourcen wird für gut die Hälfte der Programmgebiete die Effektivität der Mittelkoordination als gut, in einigen Fällen sogar als sehr gut eingeschätzt.
Aus einzelnen Programmgebieten ist bekannt, dass die Kommunen aufgrund ihrer angespannten Finanzsituation Schwierigkeiten haben, ihren Kofinanzierungsanteil zu leisten. Während für gut zwei Drittel aller Programmgebiete in der Befragung berichtet wird, dass sie ihren Anteil im Wege der üblichen Drittel-Finanzierung selbst aufbringen, kommen immerhin für rund ein Fünftel der Gebiete Sonderregelungen zum Tragen: beispielsweise eine Drittel-Finanzierung mit Hilfe anderer Programme oder ein niedrigerer Eigenanteil durch Zusatzförderung des Landes (vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) oder der EU. Im Resümeepapier der PvO-Teams heißt es dazu: "Da das Aufbringen der kommunalen Komplementärfinanzierung für einige Gemeinden wegen ihrer prekären Finanzsituation schwierig ist, sollte erwogen werden, in diesen Fällen den Eigenanteil zu verringern oder zu erlauben, sich der finanziellen Hilfe Dritter, etwa von Wohnungsunternehmen, zu bedienen." (2)
Insgesamt gibt es offenbar nach wie vor Unsicherheiten über Fördermittel und Antragswege. Häufig fehlen zentrale Stellen in den Ländern und in den Kommunen, die bei der Beantragung von Fördermitteln beraten. Kritisiert wird für mehr als die Hälfte der Gebiete ein Mangel an Informationen über Fördermöglichkeiten, für knapp zwei Drittel wird eine unzureichende Abstimmung der verschiedenen Förderprogramme bemängelt. Dieses Defizit wird auch von den PvO-Teams thematisiert.
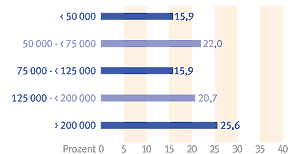 |
Abbildung 71: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Die Fähigkeit, EU-Mittel als zusätzliche Mittel einzuwerben, ist bei den Städten mit über einer Million Einwohnern doppelt so hoch wie bei den kleineren Städten. Während es von Ersteren 65,2 Prozent (n=23) sind, die solche Mittel zum Einsatz bringen, sind es von Letzteren (3),5 Prozent (n=197). Anders sieht es dagegen bei den Bundesmitteln aus. Hier gibt es keine eindeutigen Unterschiede zwischen den einzelnen Größenklassen.
Das Verhältnis der investiven Maßnahmen zu jenen, die der Vorbereitung, Begleitung und Sicherung von Investitionen dienen, wird immerhin für knapp die Hälfte aller Programmgebiete (46 Prozent) als ausgewogen angesehen. Für einen ähnlich hohen Anteil der Gebiete (42 Prozent) wird allerdings die Auffassung vertreten, dass der Anteil der nicht-investiven Mittel zu gering ist. Soweit in der Befragung Summen genannt wurden - dies war nur für ein gutes Drittel der Gebiete möglich -, lagen die für nicht-investive Maßnahmen ausgegebenen Beträge aus dem Programm Soziale Stadt im Jahr 2002 in einem Viertel der Gebiete bei über 200 000 Euro, in einem guten Drittel bei zwischen 75 000 und 200 000 Euro und in einem weiteren guten Drittel bei bis zu 75 000 Euro. Da bei über der Hälfte der Gebiete der gesamte Mitteleinsatz aus dem Programm über 500 000 Euro, bei einem Drittel zwischen 125 000 und 500 000 Euro und lediglich bei knapp 14 Prozent unter 125 000 Euro33 betrug, ergibt sich, dass vielfach nicht unerhebliche Summen für nicht-investive Maßnahmen bereitgestellt wurden.
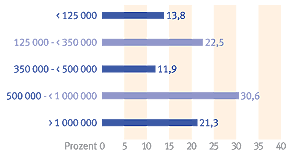 |
Abbildung 72: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Auf kommunaler Ebene wirken sich Abstimmungsbemühungen der Bundesebene offenbar positiv und produktiv aus. So wird für drei Viertel aller Programmgebiete angegeben, dass die kommunalen Akteure über die Programmplattform E & C informiert sind: meist durch den Newsletter E & C, die Homepage der Regiestelle oder die Teilnahme an Fachforen oder Regionalkonferenzen. Für etwa die Hälfte der Gebiete wird berichtet, dass sich durch E & C die Zusammenarbeit zwischen planender Verwaltung und der Jugendhilfe verbessert hat, und für fast zwei Drittel wird die Zusammenarbeit insgesamt als positiv beurteilt.
(1) Vgl. hierzu auch Kapitel 7. ![]()
(2) Vgl. das Resümeepapier der PvO-Teams im Anhang 2. ![]()
(3) Diese Zahlen beruhen auf Angaben von annähernd drei Vierteln der Gebiete. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005