soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
5.1 Ziele, Handlungsfelder, Maßnahmen und Projekte der Programmumsetzung
Die mit der Programmumsetzung verfolgten Ziele lassen sich ebenso wie die zur Zielerreichung eingesetzten Handlungsfelder drei übergeordneten Funktionsbereichen zuordnen:
- Verbesserung der physischen Wohn- und Lebensbedingungen in den Stadtteilen (überwiegend baulich-investive, auf Gebäude, Wohnumfeld und öffentliche Räume bezogene Maßnahmen und Projekte);
- Verbesserung der individuellen Lebenschancen (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten an Bewohnerschaft und lokale Akteure, Hilfen zur Selbsthilfe);
- Integration und Vernetzung (Maßnahmen und Projekte zur Vermittlung in Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt, zur Förderung von Stadtteilleben und Stadtteilwirtschaft).
Im Zuge der Programmumsetzung zeichnet sich ab, dass die Gewichte stärker auf die Handlungsfelder verlagert werden, mit denen vor allem Integrationschancen gesteigert werden können. In diesem Zusammenhang gewinnen Handlungsfelder und Akteure zunehmend an Bedeutung, die bisher in der Städtebauförderung und Stadtentwicklung kaum eingebunden waren. In nahezu allen Handlungsfeldern der Sozialen Stadt müssen zur Bewältigung der komplexen Problemlagen in den Stadtteilen und zum Einlösen des integrativen Programmansatzes neue Strategien entwickelt und erprobt werden.
|
Abbildung 37: Ziele der integrierten Stadtteilentwicklung (n=222, Mehrfachnennungen; Erste und zweite Befragung Difu 2000/2001 und 2002) |
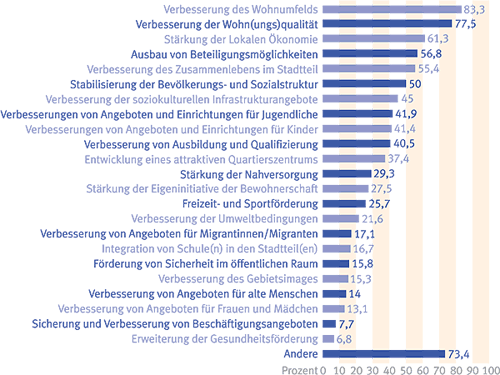 |
|
|
Entsprechend den in der Umfrage genannten Zielen (1) rangieren auch bei den Handlungsfeldern für die konkreten Maßnahmen und Projekte Aufgaben der traditionellen Städtebauförderung („Wohnumfeld und öffentlicher Raum“) an erster Stelle; sie werden in der Nachfrage nach den fünf wichtigsten Handlungsfeldern auf dieser Position bestätigt. Dies stimmt auch mit den Angaben zu den in den Integrierten Handlungskonzepten berücksichtigten Handlungsfeldern überein (2) .
Diskrepanzen zwischen Zielen und konkreten Maßnahmen (Abbildung 37 und Tabelle 12) zeigen sich beispielsweise im Handlungsbereich „Lokale Ökonomie“. Das Ziel „Stärkung der Lokalen Ökonomie“ rangiert mit Nennungen für 61 Prozent der Gebiete bei den Zielen auf Platz 3. Bezogen auf konkrete Maßnahmen und Projekte sind die entsprechenden Handlungsfelder aber eher unterrepräsentiert: „Wertschöpfung im Gebiet“ rangiert auf Platz 18/19 (Nennung für 29 Prozent der Programmgebiete), „Beschäftigung“ auf Rang 10 (54 Prozent) sowie „Qualifizierung und Ausbildung“ auf Rang 9 (56 Prozent).
Umgekehrt verhält es sich bei den Aktionsfeldern „Imageförderung“, „Kinder- und Jugendhilfe“ sowie „Sport und Freizeit“: Sie spielen sowohl bei den konkreten Maßnahmen als auch bei den Integrierten Handlungskonzepten eine bedeutendere Rolle, als die Angaben zu den Zielen der integrierten Stadtteilentwicklung erwarten ließen. Dies ist beispielsweise beim Aktionsfeld „Image und Öffentlichkeitsarbeit“ der Fall; Imageverbesserung als Ziel wurde nur für 15 Prozent der Programmgebiete genannt, in der Praxis dagegen wird „Image und Öffentlichkeitsarbeit“ für 77 Prozent der Gebiete als Handlungsfeld der konkreten Maßnahmen und Projekte angegeben (2. Rang). Unterschiede zwischen Praxis und Einschätzung fallen auch im Handlungsfeld „Sport und Freizeit“ auf: Für 70 Prozent der Programmgebiete, und damit an vierter Stelle der Häufigkeiten, spielt dieses Handlungsfeld eine Rolle; im Rahmen der Zurechnung zu den fünf wichtigsten Handlungsfeldern liegt es aber mit Nennungen für ein knappes Fünftel der Programmgebiete nur an elfter Stelle.
|
Tabelle 12: Inhaltliche Handlungsfelder der Maßnahmen und Projekte (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
||||||
|
Handlungsfelder der Maßnahmen |
Besonders wichtige Handlungsfelder |
|||||
|
abs. |
% |
Rang |
abs. |
% |
Rang |
|
|
Wohnumfeld und öffentlicher Raum (Sicherheit) |
180 |
81,1 |
1 |
83 |
37,4 |
1 |
|
Image und Öffentlichkeitsarbeit |
171 |
77,0 |
2 |
72 |
32,4 |
3 |
|
Kinder- und Jugendhilfe |
156 |
70,3 |
3 |
66 |
29,7 |
5 |
|
Sport und Freizeit |
155 |
69,8 |
4 |
43 |
19,4 |
11 |
|
Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur |
151 |
68,0 |
5 |
80 |
36,0 |
2 |
|
Stadtteilkultur |
142 |
64,0 |
6 |
49 |
22,1 |
10 |
|
Schulen und Bildung im Stadtteil |
140 |
63,1 |
7 |
63 |
28,4 |
6 |
|
Zusammenleben unterschiedl. sozialer und ethnischer Gruppen |
128 |
57,7 |
8 |
70 |
31,5 |
4 |
|
Qualifizierung und Ausbildung |
124 |
55,9 |
9 |
58 |
26,1 |
7 |
|
Beschäftigung |
121 |
54,5 |
10 |
50 |
22,5 |
9 |
|
Lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft |
119 |
53,6 |
11 |
51 |
23,0 |
8 |
|
Verkehr |
118 |
53,2 |
12 |
22 |
9,9 |
12 |
|
Umwelt |
94 |
42,3 |
13 |
12 |
5,4 |
14 |
|
Familienhilfe |
91 |
41,0 |
14 |
9 |
4,1 |
15 |
|
Seniorenhilfe |
74 |
33,3 |
15 |
8 |
3,6 |
16 |
|
Wertschöpfung im Gebiet |
64 |
28,8 |
16/17 |
15 |
6,8 |
13 |
|
Gesundheit |
64 |
28,8 |
16/17 |
5 |
2,3 |
17 |
|
Anderes |
2 |
0,9 |
18 |
2 |
0,9 |
18 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||||||
Für die folgenden Teilkapitel (5.2 bis 5.8) wurden aus den inhaltlichen Handlungsfeldern sieben Schwerpunkte ausgewählt. Während sich die besondere Bedeutung der Handlungsfelder oder -bereiche „Zusammenleben im Stadtteil“, „Wohnungs-modernisierung und Wohnumfeldverbesserung“, „Stadtteilkultur“ sowie „Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit“ auch in den Häufigkeitsangaben der Umfrageergebnisse spiegelt, lässt sich die wichtige Funktion von „Lokaler Ökonomie“, „Schulen und Bildung“ sowie „Gesundheitsförderung“ für die Stadtteile der Sozialen Stadt aus Ergebnissen der Programmbegleitung vor Ort und Diskussionen im bundesweiten Erfahrungsaustausch ableiten: Die Bedeutung Letzterer wächst im Laufe der Umsetzung kontinuierlich, was in der Umsetzungspraxis (nach Häufigkeiten) aber noch nicht zur Geltung kommt. Deshalb wurden die folgenden Handlungsschwerpunkte ausgewählt:
- Die Integration der Stadtteilbevölkerung in den Arbeitsmarkt zählt zum Problem Nr. 1. Vor diesem Hintergrund haben Aktivitäten zur Stärkung der Lokalen Ökonomie strategische Bedeutung für die langfristig tragfähige Entwicklung in den Stadtteilen. Sie sind auf arbeitsmarkt-, beschäftigungs-, struktur- und sozialpolitische Ziele gerichtet und umfassen damit die drei Handlungsfelder „Beschäftigung“, „Qualifizierung und Ausbildung“ sowie „Wertschöpfung im Gebiet“.
- Als grundlegendes Ziel im Rahmen des Programms Soziale Stadt gilt, Fähigkeiten von Bewohnerschaft und lokalen Akteuren zum – auch kulturübergreifenden – Miteinander, zur produktiven Konfliktbewältigung und zur Zusammenarbeit zu stärken. Deshalb kommt dem Handlungsfeld Zusammenleben im Stadtteil für die Quartiersentwicklung ebenfalls eine Schlüsselfunktion zu.
- Als traditionelle Handlungsfelder der klassischen Städtebauförderung spielen vor allem „Wohnumfeld und öffentlicher Raum“, aber auch „Lokaler Wohnungsmarkt und Wohnungswirtschaft“, „Umwelt“ und „Verkehr“ im Rahmen der Sozialen Stadt eine tragende Rolle; sie sind hier zum Schwerpunkt Wohnungsmodernisierung und Wohnumfeldverbesserung zusammengefasst. Bestandsverbesserung, Abbau siedlungsstruktureller und städtebaulicher Defizite sowie wohnungswirtschaftliche Maßnahmen (Mietverzicht, spezifische Belegungspolitik, Zusatzangebote) gehörten auch schon zu Zeiten der sozial orientierten „Behutsamen Stadterneuerung“ zum geläufigen Repertoire.
- Von vielen Seiten wird dem Handlungsfeld Schulen und Bildung im Stadtteil besondere Priorität eingeräumt (3) Mit ihm werden einerseits die Voraussetzungen für die Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft geschaffen, andererseits kann Schule (als Institution und als Ort) zu einem wichtigen Kristallisationspunkt für das Stadtteilleben werden. Vor allem, wenn sich die Schulen zum Stadtteil hin öffnen, übernehmen sie vielfach wichtige soziale Funktionen weit über ihre engeren Aufgaben der schulischen Bildung hinaus. Sie bieten Elternförderung an, stellen Verbindungen zur lokalen Wirtschaft her, widmen sich der Sprachförderung und bieten als Offene Schule einen Ort als Bürgertreff und Stadtteilmittelpunkt.
- Bei der Programmumsetzung der Sozialen Stadt spielte das Handlungsfeld Stadtteilkultur anfangs eine eher untergeordnete Rolle. Dies wurde beispielsweise im Jahr 2000 auf der Starterkonferenz zum Programm Soziale Stadt und dem Impulskongress zum Quartiermanagement bemängelt (4). Inzwischen haben kulturelle Aktivitäten und Maßnahmen nicht nur im Rahmen der Integrierten Handlungskonzepte, sondern auch bei den Maßnahmen und Projekten an Gewicht gewonnen. Stadtteilbezogene Kulturarbeit trägt dazu bei, Kommunikation zu fördern, Menschen zu aktivieren, zu beteiligen und deren kreatives Potenzial herauszufordern, Stadtteil- und Ortsgeschichte sichtbar zu machen sowie neue Erlebnis- und Wahrnehmungsebenen zu erschließen.
- Beim Handlungsfeld Gesundheitsförderung besteht noch deutlicher Nachholbedarf. Es wird bisher im Rahmen der Sozialen Stadt noch zu wenig wahrgenommen und thematisiert, wenngleich mittlerweile verstärkt der Zusammenhang von Armut, Benachteiligung und Krankheit ins Blickfeld vieler Akteure rückt. Tatsächlich erweist sich Gesundheitsförderung im Sinne eines weiten Gesundheitsverständnisses, das körperliches, seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden umfasst, als Schlüsselthema in den Programmgebieten der Sozialen Stadt.
- Insbesondere das Handlungsfeld Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit stellt sich als Querschnittsaufgabe der Sozialen Stadt dar, in die alle anderen Handlungsfelder einbezogen sein können. Darüber hinaus dient Öffentlichkeitsarbeit auch der Aktivierung vor Ort und der Förderung von Kommunikation. Eine Korrektur des bereits bestehenden Negativimages in vielen Programmgebieten, das einer Identifikation von Bewohnerinnen und Bewohnern mit dem Stadtteil als gesellschaftlichem Ort im Wege steht, sowie die Förderung der Herausbildung von Positivimages erfordern nicht nur handfeste Verbesserungen in den Quartieren, sondern auch die Entwicklung umfassender Konzepte offensiver Öffentlichkeitsarbeit, die nach außen und nach innen gerichtet ist.
Die konkreten Maßnahmen und Projekte der Sozialen Stadt können in der Regel mehreren Handlungsschwerpunkten zugeordnet werden, sodass sich vielfache Überlagerungen ergeben. Dies gilt vor allem für das Handlungsfeld „Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur“, das deshalb nicht in einem eigenen Abschnitt behandelt wird.
Bei der Programmumsetzung erlangen so genannte Schlüssel- oder auch Leuchtturmprojekte besondere Bedeutung für die Stadtteilentwicklung: Durch sie werden kräftige Impulse für das Quartiersleben und -image gegeben, und sie entfalten Signalwirkung für Atmosphäre und Stimmung im Stadtteil. Von einigen Teams der Programmbegleitung vor Ort werden ein „hoher Vernetzungs- und Wirkungsgrad“ sowie die „strategische Bedeutung“ der Schlüsselprojekte hervorgehoben (5). Bei der zweiten Befragung wurde für 88 Prozent aller Programmgebiete die Frage nach Projekten bejaht, denen für den Stadtteil eine Schlüsselbedeutung zugewiesen wird (6). Das Handlungsfeld „Wohnumfeldverbesserung und öffentlicher Raum“ nimmt auch im Rahmen der Schlüsselprojekte den ersten Rang ein (170 Nennungen), gefolgt von „Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur“ (153 Nennungen) sowie mit großem Abstand „Lokaler Wohnungsmarkt“ (42 Nennungen). Für 63 Prozent der Programmgebiete wird außerdem angegeben, dass manche Projekte „besonders hilfreich (innovativ, integrativ, nachhaltig o.ä.)“ sind und so auch die Kriterien von „Good Practice“ erfüllen (7). Dabei werden am weitaus häufigsten Projekte und Maßnahmen des Handlungsfelds „Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur“ genannt (127 Nennungen).
In den folgenden Teilkapiteln stehen zum einen die besonderen Herausforderungen im Rahmen der jeweiligen Handlungsschwerpunkte zur Debatte, mit denen die Akteure in den Programmgebieten der Sozialen Stadt konfrontiert sind. Zum anderen geht es um die charakteristischen gebietsbezogenen Strategien sowie um die für den jeweiligen Handlungsschwerpunkt typischen Maßnahmen und Projekte, deren Beschreibung und Einordnung sich vor allem auf die Soziale-Stadt-Projektdatenbank gründet (8).
(1) Im Rahmen der ersten Befragung zu den Gebieten der Programmjahre 1999 und 2000 wurden die Ziele für die Programmumsetzung offen abgefragt. Für die Ermittlung der Ziele in den Gebieten des Programmjahrs 2001 im Rahmen der zweiten Befragung wurden die aus den entsprechenden Antworten gebildeten Kategorien vorgegeben. ![]()
(2) Vgl. Tabelle 7 in Kapitel 4. ![]()
(3) Beispielsweise Spiegel, Integrativ, kooperativ, aktivierend, S. 35; Volkmar Strauch im Rahmen der Podiums- und Plenumsdiskussion „Integrierte Handlungskonzepte – Erfahrungen aus der Praxis“, abgedruckt in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Integratives Handeln, S. 59: „Dies führt mich zu der Forderung, dass in jedem Stadtteil die Schule der schönste Ort sein muss. Die Qualifizierung der Menschen und die Schule sozusagen als soziales und kommunikatives Zentrum sind das Allerwichtigste. Die Mittel müssen stark auf die Schule konzentriert werden, nicht auf das Schulgebäude, sondern auf das, was in ihm passiert.“ ![]()
(4) Vgl. Beitrag von Andreas Romero zur Plenumsdiskussion, abgedruckt in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Dokumentation der Starterkonferenz, Berlin 2000, S. 145 (Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Bd. 4) sowie Stefan Rommelfanger, Bericht der AG 7 Bildungs- und Kulturarbeit, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Quartiermanagement, S. 85–89. ![]()
(5) Hierzu Ingeborg Beer und Reinfried Musch, Berlin-Kreuzberg – Kottbusser Tor sowie Heiko Geiling, Thomas Schwarzer, Claudia Heinzelmann und Esther Bartnick, Hannover – Vahrenheide- Ost, beide in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Die Soziale Stadt, S. 63 und S. 159. ![]()
(6) Für 195 Programmgebiete sind insgesamt 579 Schlüsselprojekte genannt worden: für zehn Gebiete je eines, für weitere 17 Gebiete zwei Projekte und für den Rest (168 Gebiete) jeweils drei und mehr. ![]()
(7) Die Frage nach Projekten, die den Anspruch „Good Practice“ erfüllen, wurde für 140 Gebiete (63 Prozent) bejaht; davon wurden für 40 Gebiete je ein Projekt, für 37 je zwei und für 63 Gebiete je drei oder mehr Projekte genannt. Dies ergibt insgesamt 346 Projekte. Für 60 Programmgebiete wurde angegeben, dass Good-Practice-Projekte „noch nicht“ realisiert seien. ![]()
(8) Bei den folgenden Ausführungen geht es vor allem darum, Einblicke in charakteristische inhaltliche Strategien der Sozialen Stadt zu vermitteln, nicht aber um eine tiefgreifende Analyse der verschiedenen Handlungsschwerpunkte. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005