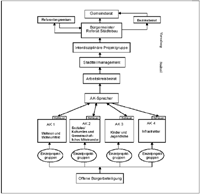soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Teil II: Von der Sozialen Stadt zur umfassenden Nachbarschaftsentwicklung - Anregungen zur Veränderung der Programmkonzeption.
Fallstudien "Soziale Stadt": Kurzfassungen
Stuttgart - Freiberg/Mönchfeld (Baden-Württemberg)
|
Das Programmgebiet in Stuttgart umfasst zwei Stadtteile mit insgesamt über 9 000 Einwohnern (rund 6 000 in Freiberg und rund 3 000 in Mönchfeld), die mit drei weiteren Stadtteilen den Stadtbezirk Mühlhausen bilden. Die Stadtteile Freiberg und Mönchfeld liegen am nordöstlichen Stadtrand von Stuttgart isoliert auf einem Höhenrücken rund 7 km von der Innenstadt entfernt in landschaftlich reizvoller Lage. Zu den Vorteilen gehören: eine gute öffentliche Infrastruktur (1) sowie eine relativ geringe Verkehrsbelastung. In beiden Stadtteilen existiert ein großes bürgerschaftliches Engagement in Form von runden Tischen, Foren und Beiräten. Es dominieren Baustrukturen aus den 50er- bis 70er-Jahren (dreigeschossige Zeilenbebauung, Punkthochhäuser [16 Geschosse], Hochhauskomplexe und -zeilen (2), in den Randbereichen Ein- und Zweifamilienhausbebauung). Relativ breite Straßen und große, zum Teil gestaltungslose Flächen mit Abstandsgrün bilden den Siedlungscharakter.
Die Versorgungsinfrastruktur ist in beiden Stadtteilen unbefriedigend, in Freiberg ist sie besser als in Mönchfeld. Die Bevölkerungsverluste führen zu sinkender Kaufkraft und damit zu einer weiteren "Schwächung". Lebten 1974 noch rund 11 650 Bewohner in Freiberg/Mönchfeld, so reduzierte sich die Einwohnerzahl bis dato um über 20 Prozent (zum Vergleich Stuttgart minus zehn Prozent). Der Anteil der nichtdeutschen Bewohner im Untersuchungsgebiet stieg von 2,5 Prozent (1974) auf 18,8 Prozent (1998) an. Fast jeder vierte Bewohner des Stadtteils ist über 65 Jahre (24,2 Prozent). Freiberg und Mönchfeld sind nicht als "klassische Brennpunkte" in Stuttgart bekannt, wurden aber im Sinne der Prävention in 1999 in das Programm "Soziale Stadt" aufgenommen.
Folgende Akteure sind beteiligt: die Stadt Stuttgart - federführend das Amt für Stadterneuerung - beim Referat Städtebau sowie das Bezirksamt Mühlhausen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Liegenschaften und Wohnen, Stadtplanungsamt und die Stabsabteilung Wirtschafts- und Arbeitsförderung (3). Außerdem das Stadtteilmanagement, Arbeitskreisbetreuer, die Bezirksvorsteherin, Vertreter von Initiativen, Vereinen usw. und Bewohnerinnen und Bewohner. Zwischen September 2000 und Oktober 2002 hatte das Team der Firma empowerment consulting die Aufgabe des Stadtteilmanagements übernommen. Das Team organisierte vier Arbeitskreise mit verschiedenen Projektgruppen, koordinierte die Bürgerbeteiligung, unterstützte alle Aktivitäten im Gebiet, bereitete Presseerklärungen, Pressekonferenzen sowie Rundfunk- und Fernsehpräsentationen vor und motivierte neue Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung am Geschehen im Stadtteil. Das Stadtteilmanagement steht zudem dem Arbeitskreisbeirat vor, übernimmt dort die Geschäftsführung und unterstützt die Sprecher der Arbeitskreise bei ihrer geschäftsführenden Aufgabe. Das Stadtteilmanagement steht damit allen beteiligten Akteuren des Stadtteils beratend und unterstützend zur Seite, ist sowohl Ansprechpartner als auch Scharnier zwischen Stadtteil und Verwaltung. Zu den allgemeinen Aufgaben zählen:
Nach rund einem Jahr Vorlaufzeit konnten in Freiberg/Mönchfeld bereits die ersten sichtbaren Maßnahmen und Projekte realisiert werden. Durch die Aufwertung des Kaufparks hat die Stadt (4) zu Beginn des Programms einen deutlichen Akzent im Gebiet gesetzt. Die Bewohnerbefähigung durch das Stadtteilmanagement - mit dem Ziel, vor allem auch die mangelhafte Artikulation der Randgruppen zu kompensieren - ist durch die wechselseitige Wertschätzung zwischen Bewohnern, Stadtteilmanagement und Stadtverwaltung gelungen. Künftig sollte es aber auch gelingen, die Wohnungsunternehmen stärker als Akteure in den Prozess einzubeziehen (z.B. Anlegen von hausbezogenen Grünflächen wie Mietergärten, Veranstaltungen im Haus, Verbesserung des Wohnungsangebotes durch Grundrissänderung usw.).
Insgesamt wurden in den Jahren 1999 bis 2001 rund 8 789 000 Euro (17 190 000 DM) für das Gebiet Freiberg/Mönchfeld an öffentlichen Mitteln bewilligt. Der überwiegende Teil wurde für die Aufwertung des Kaufparks eingesetzt (rund 6 012 790,- Euro oder 11 760 000 DM). 1 355 000 Euro (2 650 000 DM) wurden für die Modernisierung des Jugendhauses eingeplant. In diesem Fall findet eine Mittelbündelung statt: das Jugendamt finanziert zusätzlich rund 205 000 Euro (400 000 DM). Weitere 511 000 Euro wurden für Sanierungskosten (Abbruch Fürsorgeunterkünfte, Mieterumsetzung, kleines Ladenzentrum und Vorplanungen) eingesetzt. Die Bürgerbeteiligung und das Stadtteilmanagement wurden mit rund 486 000 Euro (950 000 DM) finanziert. Im Sommer 2001 waren von den bewilligten Fördermitteln und dem revolvierenden Einsatz der Einnahmen für weitere Projekte noch 2 567 197 Euro (5 021 000 DM) verfügbar.
(1) Z.B. Schulen unterschiedlichen Typs, ausreichend Kindergärten, Sportflächen, drei Jugendeinrichtungen, sozial-psychiatrische und medizinische Einrichtungen, Angebote für Senioren. (2) Hoher Anteil an Sozialwohnungen (rd. 60 Prozent). (3) Je nach Themenschwerpunkten werden "flexible" Mitglieder hinzugezogen, z.B. Amt für Umweltschutz, Kulturamt, Gesundheitsamt, Gartenbau- und Friedhofsamt, Amt für öffentliche Ordnung, Tiefbauamt, Sportamt, Haupt- und Personalamt, Ehrenamtsbeauftragter, Schulverwaltungsamt usw. (4) Amt für Stadterneuerung. |
|||||||||||||
Quelle: Good Practice in Neubauquartieren. Eine Analyse im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt", von empirica - Qualitative Marktforschung, Stadt- und Strukturforschung GmbH, Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt Bd. 9, Berlin, 2003
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 31.05.2005