soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Die soziale Stadt - Vielfalt und Zukunft
Podiumsdiskussion

|
|
 Bodo Menze
Bodo Menze
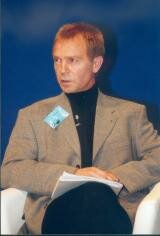 Fußball bedeutet viel in Gelsenkirchen. Fußball ist für viele ein zentraler Lebensmittelpunkt. Aber natürlich ist Fußball in Gelsenkirchen nicht alles. Nur, mich bewegt natürlich der Fußball in meiner Funktion. Dadurch, dass ich tagtäglich rund um die Uhr mit dem Thema Nachwuchsförderung verbunden bin, geht es auch um Vernetzung, ein Stichwort, was heute Morgen oft gefallen ist. Wir haben im Laufe der letzten Jahre ein Kooperationsmodell mit Partnerclubs und Partnerschulen in Gelsenkirchen geschaffen. Ich bin der Auffassung, dass es ganz wichtig ist, diese Dinge zu vernetzen, sie miteinander in Einklang zu bringen. Man muss das Potenzial der Schule nutzen und die Verbindung dazu herstellen, auch die Verbindung zwischen dem Club und dem Stadtgebiet. Ich finde im Zusammenhang mit dem Kongress, dass Fußball wie fast nichts anderes für die Jungens bei uns soziales Lernen bedeutet, soziales Lernen in Mannschaften, soziale Integration.
Fußball bedeutet viel in Gelsenkirchen. Fußball ist für viele ein zentraler Lebensmittelpunkt. Aber natürlich ist Fußball in Gelsenkirchen nicht alles. Nur, mich bewegt natürlich der Fußball in meiner Funktion. Dadurch, dass ich tagtäglich rund um die Uhr mit dem Thema Nachwuchsförderung verbunden bin, geht es auch um Vernetzung, ein Stichwort, was heute Morgen oft gefallen ist. Wir haben im Laufe der letzten Jahre ein Kooperationsmodell mit Partnerclubs und Partnerschulen in Gelsenkirchen geschaffen. Ich bin der Auffassung, dass es ganz wichtig ist, diese Dinge zu vernetzen, sie miteinander in Einklang zu bringen. Man muss das Potenzial der Schule nutzen und die Verbindung dazu herstellen, auch die Verbindung zwischen dem Club und dem Stadtgebiet. Ich finde im Zusammenhang mit dem Kongress, dass Fußball wie fast nichts anderes für die Jungens bei uns soziales Lernen bedeutet, soziales Lernen in Mannschaften, soziale Integration.
|
 Bodo Menze
Bodo Menze
Richtig. Wir haben in Gelsenkirchen das Forum 2000, in Bismarck/Schalke-Nord, auch ein wichtiges Thema der Sozialen Stadt. Wir müssen viele Probleme lösen. Wenn das auf vielen Ebenen geschieht, dann ist es umso besser. Diese Ebenen müssen irgendwo zusammenkommen. Daran arbeiten wir. Es ist ein Prozess, der sicherlich noch nicht zu Ende gekommen ist und der wahrscheinlich auch nie zu Ende kommen wird, aber wichtig ist in meinen Augen, dass man diese Vernetzung herstellt und dadurch Verbindungen schafft, dass man klar macht, dass nicht ein einzelnes Projekt irgendwo im luftleeren Raum hängt.
|
 Ercan Idik
Ercan Idik
 Sie könnten Recht haben, aber das sollte zunächst nicht im Vordergrund stehen. Ich bin der Auffassung, dass in jedem Stadtteil, so benachteiligt er auch sein mag, endogene Potenziale vorhanden sind. Die Kunst besteht darin - und die methodischen Ansätze der Lokalen Ökonomie haben diese Zielsetzung -, die Potenziale zu finden. Überall dort, wo die Möglichkeit besteht, durch Vernetzungen oder besser durch Kooperation - weil das auch einen dynamischen Aspekt hat - eine gewisse Kooperationskultur zu etablieren, können dann zusätzlich die vorhandenen endogenen Potenziale ihre Wirkungen entfalten. Was die praktische Anwendung der unterschiedlichen, auch theoretischen Modelle der Lokalen Ökonomie anbelangt, ist Deutschland im Gegensatz zu Großbritannien oder auch zu den USA ein bisschen im Verzug, sodass man, was die praktische Anwendung anbetrifft, ziemlich viele Möglichkeiten hat. Man muss nicht unbedingt so theoriebezogen verhaftet bleiben, man kann sehr wohl mit ganz normalen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und Kombinationen einiges erreichen. Wir haben in Duisburg ohnehin schon Anfang der 90er-Jahre den integrierten Handlungsansatz durchgeführt. Und letzten Endes meine ich, dass wir recht erfolgreich damit gewesen sind.
Sie könnten Recht haben, aber das sollte zunächst nicht im Vordergrund stehen. Ich bin der Auffassung, dass in jedem Stadtteil, so benachteiligt er auch sein mag, endogene Potenziale vorhanden sind. Die Kunst besteht darin - und die methodischen Ansätze der Lokalen Ökonomie haben diese Zielsetzung -, die Potenziale zu finden. Überall dort, wo die Möglichkeit besteht, durch Vernetzungen oder besser durch Kooperation - weil das auch einen dynamischen Aspekt hat - eine gewisse Kooperationskultur zu etablieren, können dann zusätzlich die vorhandenen endogenen Potenziale ihre Wirkungen entfalten. Was die praktische Anwendung der unterschiedlichen, auch theoretischen Modelle der Lokalen Ökonomie anbelangt, ist Deutschland im Gegensatz zu Großbritannien oder auch zu den USA ein bisschen im Verzug, sodass man, was die praktische Anwendung anbetrifft, ziemlich viele Möglichkeiten hat. Man muss nicht unbedingt so theoriebezogen verhaftet bleiben, man kann sehr wohl mit ganz normalen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und Kombinationen einiges erreichen. Wir haben in Duisburg ohnehin schon Anfang der 90er-Jahre den integrierten Handlungsansatz durchgeführt. Und letzten Endes meine ich, dass wir recht erfolgreich damit gewesen sind.
 Ercan Idik
Ercan Idik
Eine der schwerpunktmäßigen Tätigkeiten bislang ist immer gewesen, auch unabhängig von der Ethnie Selbständigkeit in dem Stadtteil zu fördern. Das heißt, wir bieten auch eine längerfristig angelegte begleitende Beratung von Existenzgründungswilligen an, unabhängig von ihrem Status. Die individuellen Voraussetzungen sind bei jedem unterschiedlich. Wir haben den Vorteil, dass ich türkischer Herkunft bin und daher auch die kulturellen Hintergründe bei Migranten kenne und dann auch zusätzlich von der Sprache her die Existenzgründer wesentlich besser unterstützen kann als meine deutschen Kollegen. Aber wir haben keine 1:1-Aufgabenteilung, bei der ich mich nur um türkische Gründer kümmere. Das ist nur ein Aspekt in der Lokalen Ökonomie. Die Besonderheiten der Migranten sind ebenfalls nur ein Aspekt.
Ich denke, wenn man Lokale Ökonomie als die Gesamtheit wirtschaftsbezogener Aktivitäten definiert, dann hat man in der Tat einen großen Bereich. Letzten Endes ist die Zielsetzung schon die Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Gegensatz vielleicht zu den stadtteil- oder regionaloperierenden Institutionen wie Industrie- und Handelskammer oder Gesellschafts- und Wirtschaftsförderung, die nach einem ungeschriebenen Gesetz sich um Unternehmen mit mindestens etwa zehn Beschäftigten kümmern, hat für uns auch der Trinkhallenbesitzer seine Bedeutung in der lokalen Wirtschaftsverflechtung. Um die kümmern wir uns mit der gleichen Intensität wie etwa um eine Großansiedlung. Da die gängigen Methoden bislang eher quantitativ orientiert sind und bei der klassischen Geschäftsförderung die Anzahl von Unternehmen und die Anzahl von Arbeitsplätzen in der Regel als Erfolgsmesser dient, kann ich für unsere Arbeit sagen, dass wir in dem Zeitraum von Anfang 1996 bis Ende 1999 100 Ansiedlungen hatten mit dem Arbeitsplatzeffekt von 800, ohne die Gewerbegebiete mit einzubeziehen. Und das ist wirklich nur ein Teilbereich der Lokalen Ökonomie.
 Ralf Elsässer
Ralf Elsässer
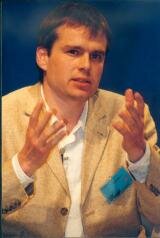 Ja, die Situation in Leipzig ist wie in vielen ostdeutschen Städten durch einen großen Wohnungsleerstand geprägt. Das hat Herr Tiefensee in seiner Rede heute auch schon in Zahlen gesagt, 60 000 leere Wohnungen bei 300 000 Wohnungen, macht 20 Prozent Leerstand. Das heißt, die Mietpreise haben sich sehr stark nach unten nivelliert. Und es gibt ein sehr großes Angebot, das heißt jeder, der einigermaßen Ansprüche an sein Wohnumfeld hat, kann sich diese weitgehend auch befriedigen. Dies führt zu einer unglaublichen Mobilität. Ich selber bin in den letzten acht Jahren viermal umgezogen. Das mag über dem Durchschnitt liegen, aber die Mehrheit der Haushalte, die Mehrheit der Leipziger sind in den letzten zehn Jahren mindestens einmal umgezogen. Man sucht sich den Ort, wo die Lebensqualität im Verhältnis zum Einkommen am besten ist. Die, die in den benachteiligten Stadtteilen wohnen, sind Menschen, die andere Ansprüche an ihr Umfeld haben und denen die Verwurzelung noch wichtiger ist als bestimmte Fragen der öffentlichen Sauberkeit oder Ähnliches. Es sind auch Leute, die von außen herziehen und die aufgrund der Lage im Stadtteil mal schauen, aha, das ist zentrumsnah, das sieht ganz gut aus hier, da ziehe ich hin, und die dann erstaunt reagieren, wenn ihre Arbeitskollegen sie fragen, wieso sie in diesem Gebiet wohnen. Solche Leute wohnen dann oft nicht lange in dem Stadtteil.
Ja, die Situation in Leipzig ist wie in vielen ostdeutschen Städten durch einen großen Wohnungsleerstand geprägt. Das hat Herr Tiefensee in seiner Rede heute auch schon in Zahlen gesagt, 60 000 leere Wohnungen bei 300 000 Wohnungen, macht 20 Prozent Leerstand. Das heißt, die Mietpreise haben sich sehr stark nach unten nivelliert. Und es gibt ein sehr großes Angebot, das heißt jeder, der einigermaßen Ansprüche an sein Wohnumfeld hat, kann sich diese weitgehend auch befriedigen. Dies führt zu einer unglaublichen Mobilität. Ich selber bin in den letzten acht Jahren viermal umgezogen. Das mag über dem Durchschnitt liegen, aber die Mehrheit der Haushalte, die Mehrheit der Leipziger sind in den letzten zehn Jahren mindestens einmal umgezogen. Man sucht sich den Ort, wo die Lebensqualität im Verhältnis zum Einkommen am besten ist. Die, die in den benachteiligten Stadtteilen wohnen, sind Menschen, die andere Ansprüche an ihr Umfeld haben und denen die Verwurzelung noch wichtiger ist als bestimmte Fragen der öffentlichen Sauberkeit oder Ähnliches. Es sind auch Leute, die von außen herziehen und die aufgrund der Lage im Stadtteil mal schauen, aha, das ist zentrumsnah, das sieht ganz gut aus hier, da ziehe ich hin, und die dann erstaunt reagieren, wenn ihre Arbeitskollegen sie fragen, wieso sie in diesem Gebiet wohnen. Solche Leute wohnen dann oft nicht lange in dem Stadtteil.
Das hat Auswirkungen auf die Arbeit mit den Leuten vor Ort. Wir versuchen natürlich, wie in anderen Gebieten auch, Netzwerke aufzubauen, Menschen zu aktivieren, sich für ihren Stadtteil einzusetzen. Das gelingt teilweise. Aber wir erleben dabei auch immer wieder, dass Menschen sagen, gut, wir engagieren uns hier noch ein halbes Jahr, aber wir ziehen eigentlich hier weg. Und nach einem halben Jahr sind die dann auch weg, und man muss dieses Netzwerk, dieses Potenzial an aktiven Leuten ständig erneuern. Das heißt, das ist ein ständiger Aufbauprozess. Bei den Unternehmen ist das natürlich nicht viel anders. Wir haben gerade einen Branchenführer für einen Teil dieses Gebietes der Sozialen Stadt erstellt mit 700 Firmen, die dort ihren Sitz haben. Schon zum Zeitpunkt, als das Buch aus der Druckerei kam, war es nicht mehr aktuell, weil bereits einige Firmen gar nicht mehr existierten. So viel als Blitzlicht zur Situation.
 Klaus Pfitzenreuther
Klaus Pfitzenreuther
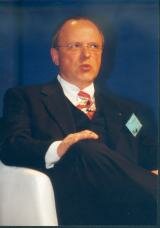 Soziale Stadt ist für uns ein sehr wichtiger Bereich. Wir stellen aufgrund der demographischen Entwicklung fest, dass an verschiedenen Stellen, auch in verschiedenen Quartieren, ob das jetzt im Ruhrgebiet ist oder in anderen großen Städten hier in Nordrhein-Westfalen oder in der Bundesrepublik, schon nicht mehr so viel Mieter da sind, wie wir das früher gewohnt waren. Früher gab es eine Wohnungsverteilung, heute muss man sich intensiver auch um die Mieter kümmern. Wir haben Erfahrungen gemacht mit Aktionen, wie - der Bundeskanzler erwähnte das vorhin - "Wohnen plus", mit denen wir versuchen, uns im Markt als ein Unternehmen zu etablieren, wo man sagen kann: "sicher wohnen ein Leben lang". Wir geben den Mietern das Gefühl, bei uns alt werden zu können mit einer komfortablen Betreuung im Hintergrund. Deswegen bedeutet uns der Bereich der sozialen Stadt ausgesprochen viel. Wir kommen nachher auch noch zu anderen Themen wie was bringt es uns, Kosten-Nutzen usw. Aber ich finde auch den emotionalen Bereich wichtig, eben die Sicherheit des Wohnens.
Soziale Stadt ist für uns ein sehr wichtiger Bereich. Wir stellen aufgrund der demographischen Entwicklung fest, dass an verschiedenen Stellen, auch in verschiedenen Quartieren, ob das jetzt im Ruhrgebiet ist oder in anderen großen Städten hier in Nordrhein-Westfalen oder in der Bundesrepublik, schon nicht mehr so viel Mieter da sind, wie wir das früher gewohnt waren. Früher gab es eine Wohnungsverteilung, heute muss man sich intensiver auch um die Mieter kümmern. Wir haben Erfahrungen gemacht mit Aktionen, wie - der Bundeskanzler erwähnte das vorhin - "Wohnen plus", mit denen wir versuchen, uns im Markt als ein Unternehmen zu etablieren, wo man sagen kann: "sicher wohnen ein Leben lang". Wir geben den Mietern das Gefühl, bei uns alt werden zu können mit einer komfortablen Betreuung im Hintergrund. Deswegen bedeutet uns der Bereich der sozialen Stadt ausgesprochen viel. Wir kommen nachher auch noch zu anderen Themen wie was bringt es uns, Kosten-Nutzen usw. Aber ich finde auch den emotionalen Bereich wichtig, eben die Sicherheit des Wohnens.
Wir sind in diesem Feld jetzt seit ungefähr 14 Jahren tätig. Das war mehr ein Zufall; am Anfang stand nicht ein Ideenkonzept, eine Ideologie, das hat sich durch Gespräche mit verschiedenen Mietern ergeben. Wir haben im Ruhrgebiet den Strukturwandel, Bergbau, Montanindustrie, Stahl. Und da haben wir dann von Frührentnern erfahren, ach, können wir nicht irgendwie was machen. Mein Geschäftsführerkollege hatte dann die Idee, weil Ältere sich in den Siedlungsbereichen auch sehr viel um Kinder kümmerten, lass uns mal eine Fahrradreparaturwerkstatt einrichten, ganz primitiv, in einer Fertiggarage. Da wurde Material vom Wohnungsunternehmen bereitgestellt, sodass die älteren Mieter sich dann auch um die Jugendlichen kümmern konnten. Dann wurde ein Frühjahrscheck für Fahrräder gemacht, Kontrolle und Sicherheit. Das war der Anfang 1987/88.
Aus weiteren Gesprächen mit den Mietern ergaben sich dann weitere Interessen. Man stellte fest, dass auch der Wunsch nach gemeinsamen kleineren Kommunikationsflächen besteht. Da hatten wir dann überlegt, was man machen kann. Wir leben in einem ländlichen Gebiet, Lünen ist Unterzentrum von Dortmund, Tor zum Münsterland. Da lag nahe, irgendetwas mit Gewächshäusern zu machen. Wir haben dann in großen Siedlungsbereichen Gewächshäuser errichtet und aus der Mieterschaft auch Leute gefunden, die nachgefragt haben, ob sie nicht auch so ein Gewächshaus bekommen können. Und dann hat sich dort ein kleines Tauschgeschäft entwickelt. Später hatten wir eine sehr große Modernisierungsmaßnahme; da haben wir dann festgestellt, dass ältere Mieter auch den Wunsch nach einer intensiveren Betreuung haben. Das ist mittlerweile so weit ausgedehnt worden, dass in Abhängigkeit von den Jahreszeiten Nahrungsmittellieferungen in kleinem Umfang in die zentralen kleinen Küchen der betreuten Wohnanlagen hineingingen.
1994 waren wir dann so weit, dass wir einen gemeinnützigen Verein ins Leben rufen konnten, den "Glückauf gemeinnützigen Nachbarschaftshilfeverein", der inzwischen über 800 Mitglieder hat und der anfangs das Laufen lernte durch Maßnahmen, die auch von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt wurden. Wir kennen diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wir haben natürlich auch auf diese Programme zurückgegriffen und haben damit auch Bedarfe geweckt. Dann sind die Programme später zurückgefahren worden. Wir konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir dort beschäftigt hatten, nicht übernehmen und haben dann allerdings schon recht früh angefangen, einen umfangreichen ehrenamtlichen Helferkreis aus der Mieterschaft aufzubauen, der inzwischen 60 Personen umfasst. Lünen-Brambauer hat ungefähr 25 000 Einwohner, wir haben 800 Mitglieder und die 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Da vollzieht sich schon nachbarschaftliches Leben. Das bringt dann auch zwischenmenschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Kontaktaufnahmen.
 Klaus Pfitzenreuther
Klaus Pfitzenreuther
Dazu kann ich wohl etwas sagen, weil wir gegenüber den Gesellschaftern und den Eigentümern Rechenschaft ablegen müssen. Die Aufwendungen, die wir im Rahmen unserer mittelfristigen Finanzplanung abgedeckt haben, belaufen sich auf ungefähr 150 DM je Wohnung. Wir haben 5 000 Verwaltungseinheiten, da können Sie ausrechnen, wie viel wir als Unternehmen aus eigener Tasche dazu tun. Das ist ein erheblicher Betrag. Wir haben das losgelöst von den Zuwendungen der öffentlichen Hand gemacht. Als es die Programme gab, haben wir selbstverständlich auch mit Mitteln des Arbeitsministeriums experimentiert, mit Mitteln des Städtebauministeriums und haben sowohl Erfolge als auch Misserfolge gehabt. Aber da ist jetzt eine gute Basis verblieben. Das finanzieren wir eben mit eigenen finanziellen Mitteln, ohne dass wir bei der Stadt die Hand aufhalten, wobei das sicherlich ab und zu auch wünschenswert wäre.
|
 Dr. Manfred Ragati
Dr. Manfred Ragati
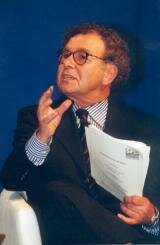 Das war eine große Zahl von Teilnehmern. Der Wettbewerb ist so angelegt, dass die Wohnungswirtschaft, der Städtetag und eine Stiftung als Auslober dabei sind. Wir hatten über 100 Teilnehmer. Das ist nicht an das Programm Soziale Stadt gebunden, sondern auch Teilnehmer außerhalb des Programms können mitwirken, weil ja auch andere Mittel in solche Aufgaben fließen. Kriterium muss dabei quasi ein Soll-Ist-Vergleich sein. Das wäre idealiter ein Stadtteil oder ein Viertel oder eine Gruppe. Was ist in der Zwischenzeit bewirkt worden? Das kann in verschiedenen Feldern stattfinden. Hat sich das Wohnumfeld verbessert, wurde es vor dem Abrutschen aufgefangen? Sind Einrichtungen der Jugendhilfe, Kinderhilfe entstanden? Gibt es auch für die Erwachsenen Angebote der Beratung, der Betreuung, der Selbstbehauptung? Beispielsweise ein Projekt, wo eine Frau künstlerisch gearbeitet hat, aber eine schwierige Zeit hinter sich brachte, psychisch krank war, um ihr mit einer Ausstellung wieder Mut zu machen, dass sie in der Gesellschaft, in dieser Gruppe vor Ort einen bestimmten Wert hat. Solche verschiedenen Projektarten finden Eingang in den Wettbewerb.
Das war eine große Zahl von Teilnehmern. Der Wettbewerb ist so angelegt, dass die Wohnungswirtschaft, der Städtetag und eine Stiftung als Auslober dabei sind. Wir hatten über 100 Teilnehmer. Das ist nicht an das Programm Soziale Stadt gebunden, sondern auch Teilnehmer außerhalb des Programms können mitwirken, weil ja auch andere Mittel in solche Aufgaben fließen. Kriterium muss dabei quasi ein Soll-Ist-Vergleich sein. Das wäre idealiter ein Stadtteil oder ein Viertel oder eine Gruppe. Was ist in der Zwischenzeit bewirkt worden? Das kann in verschiedenen Feldern stattfinden. Hat sich das Wohnumfeld verbessert, wurde es vor dem Abrutschen aufgefangen? Sind Einrichtungen der Jugendhilfe, Kinderhilfe entstanden? Gibt es auch für die Erwachsenen Angebote der Beratung, der Betreuung, der Selbstbehauptung? Beispielsweise ein Projekt, wo eine Frau künstlerisch gearbeitet hat, aber eine schwierige Zeit hinter sich brachte, psychisch krank war, um ihr mit einer Ausstellung wieder Mut zu machen, dass sie in der Gesellschaft, in dieser Gruppe vor Ort einen bestimmten Wert hat. Solche verschiedenen Projektarten finden Eingang in den Wettbewerb.
Das ist natürlich auch ein Element der Öffentlichkeitsarbeit, das spornt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, sowohl die Träger als auch die Mitwirkenden, ehrenamtlich und hauptamtlich, und die, die vor Ort von der Arbeit profitieren sollen. Denn eine Aufgabe der Sozialen Stadt ist ja zunächst Strukturpolitik. Ein Wohlfahrtsverband ist immer bemüht, dass Strukturpolitik auch als individuelle Hilfe vor Ort spürbar wird. Und am erfolgreichsten ist, wenn sich Nachhaltigkeit feststellen lässt. Denn wenn die Wohlfahrtsverbände und die Träger nicht mehr tagtäglich da sind und die Struktur so stark geworden ist, dass sie nur noch über eine Supervision beobachtet werden muss, dann trägt es; wo Defizite sind, trägt es nicht; da müssen wir wieder eingreifen. Der Wettbewerb ist bisher ein hervorragendes Instrument. Er wird alle zwei Jahre ausgelobt, um auch in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für diese wichtige Aufgabe zu wecken. Eine Stadt ist eigentlich per Existenz ein soziales Gemeinwesen, nur den Leuten ist es manchmal nicht hinreichend bewusst.
 Prof. Dr. Klaus Selle
Prof. Dr. Klaus Selle
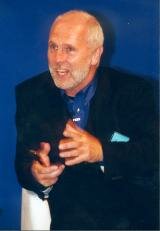 Da kann ich Ihnen nur Recht geben. Wir haben gerade in einem anderen Zusammenhang empfohlen, man müsste mal worst practices diskutieren. Das wird man nicht in einem solchen Rahmen wie hier machen können, dazu braucht es geschützte Räume, denn über Niederlagen zu berichten, verlangt andere Diskussionsformen. Der Hintergrund Ihrer Frage ist ja der, dass das natürlich nicht die Regel ist, sondern dass hier "von außen" eingerichtet wird. Und für mich bemerkenswert ist - ich hatte das Vergnügen, ab Ende der 80er-Jahre bei der Entstehung der ersten Länderprogramme in Richtung Soziale Stadt mitzuwirken und den Transfer vom Ausland mitzuorganisieren, also England und Holland -, dass bestimmte Forderungen, die wir auch heute Morgen schon gehört haben, wie Integration der Politikfelder, Arbeit vor Ort, Veränderung der Arbeitsweisen, seither immer wieder wiederholt werden. Das verweist ja im Sinne Ihrer Frage auf ein Noch-Nicht.
Da kann ich Ihnen nur Recht geben. Wir haben gerade in einem anderen Zusammenhang empfohlen, man müsste mal worst practices diskutieren. Das wird man nicht in einem solchen Rahmen wie hier machen können, dazu braucht es geschützte Räume, denn über Niederlagen zu berichten, verlangt andere Diskussionsformen. Der Hintergrund Ihrer Frage ist ja der, dass das natürlich nicht die Regel ist, sondern dass hier "von außen" eingerichtet wird. Und für mich bemerkenswert ist - ich hatte das Vergnügen, ab Ende der 80er-Jahre bei der Entstehung der ersten Länderprogramme in Richtung Soziale Stadt mitzuwirken und den Transfer vom Ausland mitzuorganisieren, also England und Holland -, dass bestimmte Forderungen, die wir auch heute Morgen schon gehört haben, wie Integration der Politikfelder, Arbeit vor Ort, Veränderung der Arbeitsweisen, seither immer wieder wiederholt werden. Das verweist ja im Sinne Ihrer Frage auf ein Noch-Nicht.
Die Beispiele, die hier berichtet werden, sind avancierte Praxis. Und in einem breiten Feld von Praxis müht man sich noch sehr, etwa das Zusammenwirken der verschiedenen Ämter vor Ort überhaupt zu organisieren oder eine Verwaltung dazu zu bekommen, dass sie in der Lage ist, mit diesen Netzen vor Ort, angefangen von der Lokalen Ökonomie über das, was im Kulturbereich und im Sportbereich passiert, überhaupt zusammenzuarbeiten. Man delegiert es dann gerne an die Quartiersmanager und lässt die machen, verändert aber nicht die Arbeitsweise in der Verwaltung.
Das Gleiche gilt natürlich auch für Wohnungsunternehmen. Das, was Herr Pfitzenreuther beschreibt, ist sicher eine Ausnahmepraxis. Viele Wohnungsunternehmen betreiben notgedrungen den Ausverkauf ihrer Bestände, statt sich im Sinne einer sozialen Praxis um diese und um deren Bewohnerinnen und Bewohner zu kümmern. Und das Ganze führt dann zu einer ersten notwendigen Folgerung. Wenn das alles seit 13, 14, 15 Jahren als notwendig anerkannt, aber doch nur sehr mühsam umsetzbar ist, dann braucht eine Politik für Soziale Stadt sehr viel längeren Atem, als jenen, der ihr gemeinhin zugestanden wird.
 Dr. Manfred Ragati
Dr. Manfred Ragati
Zu Herrn Selle: Der Ansatz ist richtig, die Verwaltungen sind nach meiner Einschätzung zu dieser Aufgabe vor Ort in der Ausführung nicht der richtige Partner. Sie müssen im Hintergrund bleiben. Und da gibt es so viele Akteure vor Ort, Wohlfahrtsverbände, Initiativgruppen, die das viel flexibler leisten können, als eine Behörde das macht. Ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich selbst mal Behördenchef war. Wir haben das delegiert, weil es vor Ort viel flexibler gehandhabt wurde, auch das Vertrauen ist in einer Organisation, die von Freiwilligen getragen wird, ein anderes als in einer Behörde. Das muss man dabei auch beachten.
 Klaus Pfitzenreuther
Klaus Pfitzenreuther
Welche Erfahrungen haben wir mit der Verwaltung gemacht? Als wir anfingen, uns insbesondere um den Kinder- und Jugendbereich zu kümmern, da gab es in einem Stadtquartier aufgrund eines hohen Ausländeranteils sehr viele türkische Kinder. Wir haben uns dazu entschieden, speziell für diese Gruppierung Angebote zu entwickeln, und wollten im Grunde genommen einen so genannten - das ist ein älterer Begriff - Kooperationsring Kind für diese Kinder und Jugendlichen auf die Beine stellen. Da ist man uns von Seiten der Stadt äußerst skeptisch gegenübergetreten und hat gesagt, was macht ihr als Wohnungsunternehmer, das ist unsere originäre Aufgabe. Wir haben uns aber dafür entschieden, den Bereich zu realisieren. Und das läuft inzwischen auch ganz gut.
Wir haben z.B. in diesem Stadtteil auch sehr kritische Kinder, die bis vor etwa zwei Jahren noch dezentral bei externen Familien untergebracht waren. Da haben wir mit einer kirchlichen Stiftung ein Haus eingerichtet und betrieben, wo die Kinder wohnortnah stabilisiert werden, morgens abgeholt werden und abends wieder in die Ursprungsfamilie zurückkommen. Das hat z.B. für die Stadt jetzt den Effekt gehabt, dass sie im Jugendhaushalt erheblich geringere Ausgaben hat. Da hat sich von der ursprünglich kritischen Einstellung jetzt eine positive Einstellung entwickelt.
Und dann natürlich zur Rolle der Wohnungsunternehmen: Ich bin hier Vertreter der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Ich beanspruche für unseren Zweig in der Bundesrepublik, dass wir im Grunde genommen auch ideal prädestiniert sind, insbesondere, wenn man die alten Traditionen der Wohnungsgemeinnützigkeit verinnerlicht hat, mit dem Klientel der Sozialen Stadt auch etwas auf die Beine zu stellen. Das sieht man inzwischen auch bei vielen Wohnungsgesellschaften und insbesondere Wohnungsgenossenschaften, wo solche Initiativen sich hinwenden, die Mieter sich kümmern, wo das in den letzten fünf Jahren immens zugenommen hat.
 Ralf Elsässer
Ralf Elsässer
Auf die Frage komme ich gleich. Ich wollte gerne noch mal anknüpfen an das, was Professor Selle sagte. Die Entwicklung von Stadt, insbesondere die Entwicklung von problematischen Stadträumen ist eigentlich keine Verwaltungs-, sondern eine Managementaufgabe. Nun ist es aber nicht damit getan, dass man ein paar Manager definiert und die neben die Verwaltung setzt, die dann diese Aufgabe lösen sollen, sondern die Verwaltung muss sich eigentlich zu einem Unternehmen umstrukturieren, das diese Entwicklung managen kann. Das, was ich erlebe, ist, dass die zusätzlichen Fördermittel, die über integrierte Programme kommen, einigermaßen integriert im Rahmen der Verwaltung abgearbeitet werden, dass sie aber als "Addits" behandelt werden. Die kommen dazu, die nimmt man mit. Für diese Programme werden auch die dafür vorgesehenen Strukturen aufgebaut. Aber das übrige Verwaltungshandeln bleibt davon noch weitgehend unberührt.
Dabei kommt es darauf an, die Prioritäten, die mit den vorhandenen Ressourcen schon gesetzt sind, zu hinterfragen, zu fragen: ist es denn richtig, dass der und der Stadtteil eine Schule bekommt und in dem Stadtteil eine Schule weggenommen wird, dass dort Straßen gebaut werden und dort nicht. Das läuft alles außerhalb dieser speziellen Förderprogramme. Aber das wird, denke ich, in diesem Gesamtzusammenhang zu selten hinterfragt. Wir können es uns nicht leisten, die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf nur durch zusätzliche Fördermittel gesund zu entwickeln, sondern wir müssen alle Ressourcen dort einbeziehen, das heißt also, dass der gesamte Verwaltungsapparat an einem Strang ziehen muss - und nicht nur in einem Stadtteil und nicht nur mit einem Förderinstrumentarium.
 Gertrud Hautum
Gertrud Hautum
Das ist ein wundervoller Übergang. Verwaltung ist, glaube ich, verrufener, als sie wirklich ist. Von außen kann ich das sehr gut verstehen, je größer eine Stadt ist, desto undurchsichtiger ist natürlich das Geflecht der Verwaltung und der Möglichkeiten, die die Verwaltung hat. Von innen heraus gesehen hat München hier eine ganz gute Tradition, dass die verschiedenen Verwaltungszweige relativ gut zusammenarbeiten, da konnte man anknüpfen. Aber auch das Programm hat natürlich einiges bewirkt, zumal es auch parallel zur Verwaltungsreform gelaufen ist. Man hat doch deutliche Strukturen entwickeln können, die das innerhalb der Verwaltung vereinfachen.
In München hat man sich dazu entschlossen, die Projektsteuerung kommunal zu lassen. Hier trifft sich eine kleine Kerntruppe aus den vier Kernreferaten regelmäßig, das ist bei uns das Planungsreferat, wobei dort auch die Wohnungsbauförderung und die städtischen Wohnungsgesellschaften angesiedelt sind. Das sind dann noch das Sozialreferat, das Arbeitsreferat und auch das Referat für Umwelt und Gesundheit, nicht zuletzt wegen der speziellen Probleme bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Jederzeit können natürlich externe Experten oder auch staatliche Dienststellen mit dabei sein. Wer eingeladen wird, hängt vom Thema ab. Hier hat sich ein Verfahren eingespielt, wo wir inhaltlich und finanziell ziemlich fix entscheiden können, was geht, was geht nicht, und welche Fördermöglichkeiten können durch die jeweiligen Referate noch mal angezapft und zusammengeführt werden.
Vor Ort draußen muss es dann natürlich ein entsprechend engagiertes Quartiersmanagement und engagierte Gruppen geben, die sich aus den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den verschiedenen Netzwerken vor Ort bilden. Bei einer großen Stadt, vielleicht ist das in einer kleinen etwas anders, gab es viele gute Initiativen, die voneinander noch nicht alles wissen oder nichts wissen. Wobei in München der glückliche Fall besteht, dass sich zumindest Sozialstrukturen bereits regional sortiert haben. Da gibt es eine Organisation, die nennt sich interessanterweise "Regsam", was aber nichts anderes heißt als "Regionale Sozialarbeit München". Da ist das Zusammenspiel vereinfacht. Ich glaube aber, dass die Leute vor Ort auch überfordert wurden mit diesen ganzen Rechtsregularien, wann wie welche Fördermöglichkeiten zum Einsatz gebracht werden können.
Ich muss auch zugeben, dass das auch innerhalb der Verwaltung noch nicht ganz ohne Schwierigkeiten abläuft. Man würde sich manchmal vereinfachte Formen und auch andere Schnittstellen wünschen. Ich setze aufgrund unserer Erfahrungen auf ein großes Feld der Kooperation. Unsere Gebiete sind natürlich auch sehr groß. Wir kommen
überhaupt nicht aus, ohne dass wir sehr stark auf den verschiedensten Ebenen kooperieren. Da gehört die Verwaltung genauso dazu wie die Wohnungsunternehmen. Die ehemaligen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen sind hier schon aufgrund ihres Mieterbestandes besonders aufgerufen mitzuarbeiten. Und da gehört das Engagement der Leute vor Ort dazu. Das hat das Programm Soziale Stadt schon in einer ganz anderen Weise aufgebrochen, als das vorher war. Schwierig würde es allerdings werden, wenn diese finanzielle Unterstützung abrupt abbrechen und das ganze Engagement damit sozusagen an die Wand laufen würde. Ich glaube, da würden sich die Leute draußen so vor den Kopf gestoßen fühlen, dass sofort alles in sich zusammenbrechen würde. Dazu ist das Programm noch zu jung. Wenn das länger läuft, hätte ich eigentlich schon - vielleicht bin ich da zu optimistisch - die Hoffnung, dass sich Selbsthilfestrukturen ergeben, die dauerhaft für sich selbst bestehen bleiben, weil die Leute merken, dass sie zu einer ganz anderen Realität in ihrem Wohnumfeld und in ihren persönlichen Bezügen kommen, wenn man in solchen Flechtwerken zusammen ist, miteinander redet, das Verständnis füreinander gewinnt und vielleicht sogar mit einem eigenen Budget tatsächlich einiges vor Ort umsetzen kann.
 Ercan Idik
Ercan Idik
Ich glaube, die Arbeitsaufteilung ist da teilweise auch integriert, die haben ganz viele Ressorts. Da sind unsere Ansprechpartner schon bekannt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das ein Duisburger Spezifikum ist, aber unsere Kooperationen mit den Kollegen aus der Verwaltung sind bislang hervorragend, da kann ich nicht klagen. Meiner Ansicht nach muss man in der Regel auch die Abhängigkeiten von der Politik sehen, sei es kommunal oder sei es lokal oder vor Ort. Deswegen ist es unser Ansatz, die Menschen, seien es Geschäftsleute, seien es Eigentümer, seien es ganz "normale Bewohner", in den Vordergrund zu stellen und anhand von konkreten Projekten eine solche Dynamik zu entfalten, dass weder Verwaltung noch Politik umhin können, ein solches gutes Projekt zu unterstützen. Das ist aus unserer Sicht die richtige Vorgehensweise.
Wir haben ein Stadtteilmanagement in jedem Stadtteil, den wir betreuen. Wir arbeiten in vier Stadtteilen. Wir haben inzwischen sehr viel Erfahrung auch über die bestehenden Strukturen in den Stadtteilen und können relativ leicht Kooperationen initiieren - in der Regel projektbezogen. Und da, denke ich, liegt auch so ein bisschen das Geheimnis des Ganzen.
 Bodo Menze
Bodo Menze
Ich glaube schon, dass wir etwas bewirken können, wenn ich z.B. an die Situation in Schalke-Nord denke, Stichwort Glückauf-Konzern, also die alte Heimstätte und Keimzelle des FC Schalke 04. Sie steht unter Denkmalschutz und dient uns heute noch als Spielstätte für die Nachwuchsförderung. Wir teilen sie mit dem Club Teutonia Schalke im Stadtteil Schalke. Die Perspektive wird sein, dass wir über kurz oder lang gänzlich ins Gebiet Werderfeld umziehen werden, dort, wo die Arena steht, dass wir alles dort zentrieren werden. Und die Glückauf-Kampfbahn bleibt hoffentlich als Keimzelle auch des Clubs erhalten. Ich hänge persönlich sehr daran, weil ich dort aufgewachsen bin, weil ich aus dem Küchenfenster praktisch tagtäglich die Glückauf-Kampfbahn gesehen habe. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Stätte dort bleibt und dass der Club Teutonia Schalke als ein Beispiel in Gelsenkirchen eine ganz wesentliche Funktion erfüllt, nämlich dass er Jungens von der Straße holt. Wenn wir diese Stadtteilclubs aufgeben und denen die Heimstätte nehmen, das wäre das Schlimmste, was uns und unserem Nachwuchs passieren könnte.
Die Arbeit, die dort verrichtet wird, ist eigentlich Sozialarbeit. Die Jugendtrainer in diesem Club verrichten tatsächlich tagtäglich Sozialarbeit. Sie sind ehrenamtlich tätig, sie werden, wenn überhaupt, mit ein paar Mark bezahlt, aber dieser Club kann nicht zahlen. Da übernehmen Väter die Trainerfunktion. Ob das für die Hohe Schule der Nachwuchsleistungsförderung auf hohem Niveau in Ordnung ist, ist eine andere Frage. Für mich zählt der soziale Aspekt, dass die Kinder betreut und nicht sich selbst überlassen werden, dass man den Kindern Gelegenheit gibt, in Mannschaften Fußball zu spielen. Ich denke, dass es ganz wichtig und gut für die gesamte Sozialisation eines Jungen ist, wenn er in so einer Mannschaft aufwächst. Wenn es die Vereine wie Teutonia Schalke, Westfalia Schalke oder Sportfreunde Haverkamp oder wie diese Clubs alle heißen nicht gäbe, dann hätten wir sehr viel mehr soziale Probleme; davon bin ich überzeugt.
|
 Bodo Menze
Bodo Menze
Nein, ich spreche ja von den kleinen Clubs, mit denen wir uns arrangieren, wo wir uns, so gut wir können, auch unter die Arme greifen. Ich spreche von den wirklich kleinen Stadtteilclubs, die auf unterster Kreisklassenebene Fußball spielen und sich organisieren. Diese Vereine sind in meinen Augen extrem wichtig für unsere Stadt vor dem Hintergrund, dass hier wichtige sozialpädagogische Arbeit geleistet wird. Wenn diese Vereine nicht existierten, wären die Probleme noch viel größer.
 Bodo Menze
Bodo Menze
Ich möchte noch eine kleine Erfahrung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, anbringen. Ganz wichtig erscheint mir nach dieser Beobachtung, dass wir Flächen anbieten, dass wir Bolzplätze anbieten, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass die Kinder auch sich selbst organisieren, dass sie spielen können. Wir haben einen wunderbaren Kunstrasenplatz bei uns im Stadion für unsere Trainingszwecke geschaffen. Da wir uns aber als volksnaher Club nicht abschotten, keine Zäune um unser Gelände herum bauen, ist immer alles offen und transparent. Das fängt beim Profitraining an, was jeder gucken kann, das geht weiter bis ganz unten zu den Minikickern. Jeder kann die Trainings beobachten und zusehen, wenn die Kinder dort trainieren. Dies hat jetzt zu dem Effekt geführt, dass neben unseren Trainingszeiten dieser Kunstrasenplatz, weil der einfach so super ist und sich die Kids da so super drauf fühlen, ständig besetzt ist durch Kinder aus Erle, aus Sotum, aus Bergerfeld, aus Buhr, die dorthin kommen und sich frei organisieren. Anfangs gab es Stimmen bei uns im Club, dies müsse verboten werden, weil der Platz belastet wird und nicht mehr in dem Maße für unsere Trainingszwecke zur Verfügung steht. Da muss ich ehrlich sagen, schlagen zwei Herzen in meiner Brust, und eins davon schlägt so stark, dass ich nie irgendwelchen Kindern das Fußballspielen verbieten würde. Mein Anliegen ist es, dass wir die Fußballtalentförderung betreiben und nicht die "Talentförderungs-Verhinderungsstation" sind.
 Dr. Manfred Ragati
Dr. Manfred Ragati
Sie haben gefragt, ob das Programm Soziale Stadt hinreichend ist. Ich glaube, es wäre zu eindimensional, wenn man sich jetzt nur auf das Programm Soziale Stadt fokussieren würde. Die Qualität eines Stadtviertels hängt auch von der Einkommenssituation ab, ob Leute da sind, die Geld verdienen, oder ob Leute da sind, die vorwiegend arbeitslos sind, alleinerziehend oder Niedriglöhne beziehen. Es gibt im Bankenbereich das Rating 3A. Und in unserem Bereich Soziales bedeutet 3A Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, Armut. Diese Aspekte darf man bei der Gestaltung Soziale Stadt nicht außen vor lassen, im Gegenteil, sie müssen einbezogen werden. Und das ist ein A, dem dann irgendwann ein O folgt, das eine Stadt, einen Stadtteil auch auf Dauer trägt. Der Bundeskanzler hat heute früh nur einen Aspekt angesprochen, die Betreuungseinrichtungen. Er hat zumindest erkannt, dass es keinen Sinn hat, Kindergeld peu à peu immer weiter anzuheben, unabhängig davon, ob ein Bedürfnis da ist oder nicht, weil es Leute gibt, die eigentlich gar nicht darauf angewiesen sind und das Geld anlegen. Wenn die Kinder dann 18 sind, kriegen sie gleich ein Kapitalkonto von 120 000 Mark mit in die Ausbildung, während Alleinerziehende schon am 20. des Monats die Pfennige oder jetzt die Cents zählen müssen. Insofern gehört auch eine aktive Armutsbekämpfungspolitik in diesen Bereich hinein. Es müssen der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verknüpft werden, in denen Feststellungen und Ansätze, wie man Armut bekämpfen kann, hinreichend enthalten sind. Da reicht es nicht aus, das Rheinland-Pfälzer-Modell auf Bundesebene zu übertragen. Man muss programmatisch weitergehen und auch über mehrere Jahre hinweg versuchen, den Niedriglohnsektor zu subventionieren, dass gerade in problematischen Bereichen auch wieder eigenes Einkommen verfügbar ist, was für das Selbstbewusstsein der Menschen von unbeschreiblicher Bedeutung ist. Sonst entstehen Stadtteile entstehen, in denen 40 oder 50 Prozent arbeitslos sind, weil sie Alleinerzieher und/oder Sozialhilfeempfänger sind. Das führt dazu - wie ich gelesen habe über eine ostwestfälische Stadt - dass ein Bürgermeister sagt: "Wir müssen eine Politik machen, in der weniger Sozialhilfeempfänger in unsere Stadt hereinkommen, besser, wenn mehr hinausgehen. Wir wollen keine Stadt der Sozialhilfeempfänger sein."
Genau das wird so ein worst-practice-Fall für Soziale Stadt. Ich will damit ein Plädoyer ablegen, dass soziale Stadt mehr bedeutet als nur dieses Programm. Da muss die Bundesregierung ihre Hausaufgaben möglichst schleunigst machen, auch in der Arbeitsmarktpolitik, weil gerade diese Fälle - sie kennen dies aus Ihren Gebieten auch in Lünen und Schalke - dazu führen, dass die Strukturen der Jugendbetreuung usw. im Laufe der Zeit kaputt gehen. Mein Plädoyer: Auch die Arbeitsmarkt- und Einkommenspolitik sind wichtige Elemente zur Gestaltung der sozialen Stadt in Deutschland.
 Prof. Dr. Klaus Selle
Prof. Dr. Klaus Selle
Gestatten Sie, dass ich Ihre Frage aufgreife, indem ich noch mal einen Rückbezug zu zwei Dingen voranstelle. Da war Ihre Ausgangsfrage nach den Subjekten der sozialen Stadt. Und wir haben gehört, es gibt vor Ort und mit dem Stadtteil befasst sehr viele. Sie haben schon direkt darauf hingewiesen: die wissen oft nichts voneinander. Die wissen nicht, dass es da beim Sportverein jemand gibt, der sich verantwortlich für die Jugend im Stadtteil fühlt. Und die wissen nicht, dass der Schulleiter nebenan im Rahmen eines Bund-Länder-Modellversuches gerade autonome Schule probt und den Stadtteil hereinholt. Die wissen nichts voneinander, und es gibt keinen, der systematisch Verbindungen herstellt.
Dann haben Sie völlig zu Recht gesagt: das Programm ist seinem Ursprung nach ein Bauprogramm, das kommt aus der Städtebauförderung. Insofern ist es ein strukturelles Problem, was vertikal durch alle Landesministerien bis auf die kommunale Ebene hinuntergeht. Mir tun immer die Kollegen in den Ministerien leid, weil sie Pirouetten drehen müssen, um zu begründen, wieso auf einmal Arbeitsmarktpolitik auch städtebaulich ist. Und die anderen Politiken daneben, Sie haben völlig Recht, die sind sehr wichtig, Arbeitsmarktpolitik, Schulpolitik, Kulturpolitik, die verlaufen autonom weiter. Es ist hier im deutschen Modell denen vor Ort überlassen, das irgendwie zusammenzukriegen - oft mit hohem Verschleiß. In der vorherigen Podiumsrunde wurde von Reibungsverlusten gesprochen. Da stecken erhebliche Reibungsverluste. Und wir haben dann immer in unsere Gutachten reingeschrieben, weil sie positiv sein mussten: hier steckt ein erhebliches Potenzial, das man im Reduzieren dieser Verluste noch wecken muss.
Damit komme ich auf Ihre zweite Frage zurück. Es ist schon fast eine Überforderung, wenn man sagt: ihr müsst das erst mal alles zusammenkriegen und dann bitte auch noch die Stadt als Ganzes sehen. An die einzelnen Akteure gerichtet, finde ich das eine Überforderung. Aber an den programmatischen Anspruch "Soziale Stadt" gerichtet, finde ich es essentiell, dass man sagt, das ist nicht nur Befriedigungspolitik für einige schon seit langem in der Verarztung begriffene Stadtteile, und der Rest macht weiter seine Veredelungspolitik. Wir sind gerade mit dem Thema "Öffentliche Räume" beschäftigt, und wir stellen fest, da gibt es eine erhebliche Spaltung in der Stadtpolitik: Veredelung innen, Vernachlässigung draußen. Man könnte fast sagen, Soziale Stadt ernst genommen heißt, man muss eine Sozialverträglichkeitsprüfung quer durch die Stadtpolitik machen. Und dann wird etwa der Verkauf eines Wohnungsunternehmens dick mit Minusstrichen versehen. Solange das nicht passiert, besteht in der Tat die Gefahr, dass man sagt, na ja, die werden irgendwie behandelt, wir haben da unsere Notfalleinheiten, und der Rest macht sein Geschäft.
 Gertrud Hautum
Gertrud Hautum
Ich möchte dies unterstreichen, Herr Professor Selle, Soziale Stadt als Programmansatz kann eigentlich nur bedeuten, in besonderen Gebieten besonders tätig zu werden, um ein Gleichgewicht im Stadtganzen so weit wie möglich herzustellen. Ich sehe es nicht als Nachteil, dass dieses Programm bei der Städtebauförderung angesiedelt ist, und möchte - als Stadtplanerin sei mir das verziehen - darauf zu sprechen kommen, dass die gebaute Umwelt, der gepflanzte Baum, der gepflegte Spielplatz, der angelegte Spielplatz, der Kindergarten, die Kinderkrippe ja alles Baumaßnahmen sind. Das ist nicht eine Selbstverherrlichung des Bauens, sondern jedes Bauen ist Ausdruck eines bestimmten Bedürfnisses, das gedeckt werden soll. Und nun hat es noch dazu den Vorteil, dass bei dieser Form der Nutzerbeteiligung sich sehr schöne Beteiligungsprojekte entwickeln lassen, bei denen sich auch die Menschen wieder näherkommen, bei denen die Menschen ihrem Wohnumfeld näherkommen und bei dem sie sehen, wie sie selbst ihr Umfeld verbessern können. Die gebaute Umwelt hat einfach etwas Sinnlich-Greifbares. Deswegen finde ich die Überlagerung in dem Programm sehr schön, dass man sowohl für investive wie für nicht-investive Maßnahmen Geld ausgeben kann.
Das, was wir uns nur oft wünschen würden, wäre, warum nicht insgesamt die Städtebauförderung auf diese neue Form umgeschaltet wird und da noch ein Hauptprogramm läuft, was eigentlich viel besser auch in Form der Sozialen Stadt weiterlaufen könnte. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, aber vielleicht ist das ein Ausblick in die Zukunft, dass dann die verschiedenen Programme auf Bundes- und Landesebene, die im arbeitsmarktpolitischen, sozialpolitischen Bereich oder im kulturellen Bereich in Gang gesetzt sind, dass sich das besser an die Programmmittel der Sozialen Stadt andocken lässt. Da sind tatsächlich manchmal noch irrsinnige Bauchaufschwünge nötig, großes Stirnrunzeln, wie bringt man etwa zu Wege, einen Zuschuss mit einem Darlehen und einer zeitweisen personellen Unterstützung zusammenzufügen. Das sind Schwierigkeiten, die nicht sein müssten, das könnte man ausräumen, und dann wäre es ein Muster für Stadtplanung überhaupt. Stadtplanung verstehe ich tatsächlich als ein Gemeinschaftswerk einer Sozietät, und die heißt eben Stadt.
 Gertrud Hautum
Gertrud Hautum
Die Situation in München ist in der Tat die, dass wir uns natürlich in erster Linie um angemessenen Wohnraum für Menschen kümmern müssen. Die Wohnung ist genauso wie die Arbeit die Grundvoraussetzung, um als freier Bürger oder freie Bürgerin in einer Stadt agieren zu können. Nun hat die Stadt natürlich Möglichkeiten zu steuern. Aber die Stadt kann natürlich nicht mit ihren beschränkten Mitteln die wohnungswirtschaftliche Struktur insgesamt beeinflussen. Jahrelang war für die Stadt München ohnedies jede Art von Sozialwohnung sehr teuer und ist es auch heute noch, weil wir von vornherein den Grund und Boden verbilligen müssen, um überhaupt ein Förderprogramm absetzen zu können. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Menschen, die genau in diese Förderprogramme reinpassen und untergebracht werden müssen.
In München besteht das besondere Problem darin, dass wir traditionell und jetzt noch aufgrund der Bindungsausläufe unglaublich wenige Sozialwohnungen haben. Jede neugebaute Sozialwohnung ist ungleich teurer als eine Bestandswohnung, und die brechen ständig weg, sodass wir in einem Hürdenlauf ständig hinter dem Bedarf her sind. Nur so entsteht auch das besondere Problem, das heute früh Oberbürgermeister Ude angesprochen hat, dass wir sogar in solchen Gebieten zum Teil wieder dringlich Vorgemerkte vom Amt für Wohnungswirtschaft einweisen müssen. Allerdings hat sich der Stadtrat jetzt im Zuge dieses gesamten großen Wohnungsprogramms, "Wohnen in München 3", auch dazu durchgerungen, trotz dieser Probleme in den sozialen Stadtgebieten - wie auch übrigens in anderen Sanierungsgebieten - zu einem ganz anderen Verteilungsschlüssel zu kommen. Wir kommen da nicht umhin, wohl wissend, dass wir dann beim Amt für Wohnungswesen natürlich noch mehr Wartende haben. Das ist also eine Gratwanderung; es gibt in der Situation keine Ideallösung.
 Klaus Pfitzenreuther
Klaus Pfitzenreuther
Das Problem haben wir nicht. Die Angebote, die im Bereich der Sozialaktivität, Nachbarschaft, Kommunikation laufen, sind für die Nutzer kostenfrei. Sie müssen keine Pauschalen zahlen, es geht nur um Verursachungsrecht. Wenn die an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen, z.B. Schlachtfest, Weihnachtsfest oder Kinderfeste, die wir mit türkischen Familien zusammen machen, da wird immer eine Kostenumlage erhoben. Es gibt also keine Pauschalen, es ist immer verursachungsgerecht. Wir haben über den Nachbarschaftshilfeverein einen Monatsbeitrag von 1,5 Euro, und da gab es schon Leute, denen das nicht passte, eine Pauschale zu zahlen. Wenn man die Dinge in Empfang nehmen möchte, ist man auch bereit zu zahlen, aber nicht pauschal. Und die Mieten sind - das muss man hier jetzt sagen - bei uns in der Region relativ niedrig. Unsere Durchschnittsmiete, selbst für modernisierte, gut ausgestattete Wohnungen, liegt unter acht Mark. Das ist schon sehr attraktiv für die Leute.
Ich bin ein Verfechter von sozialer Stadt in Nachbarschaften, Kommunikation, Runden Tischen, wo diese zwischenmenschlichen Beziehungen laufen. Ich finde, das muss man in den Mittelpunkt stellen. Dies gilt dann auch für andere Wohnquartiere, wo sehr gut verdienende Leute wohnen. Wir haben jetzt seit zwei Jahren im Duisburger Innenhafen eine phantastische große Wohnanlage, wo es Eigentumswohnungen plus Mietwohnungen in einem sehr hohen Segment gibt. Da ist im Rahmen der Niederlassung aufgespürt worden, dass auch diese Menschen Wert auf nachbarschaftliche Kontakte legen. Da sind wir als Wohnungsgesellschaft hingegangen und organisieren auch für diese Bereiche Internetcafés, wo Kinder und Jugendliche zusammenkommen. Wir organisieren auch gemeinsame Theaterbesuche. Da merkt man den Bedarf nach Kommunikation, man ist nicht ein Autist und lebt für sich alleine, sondern da ist auch Kommunikation erforderlich.
 Dr. Manfred Ragati
Dr. Manfred Ragati
Heute ist schon einmal gesagt worden, dass Soziale Stadt ein Projekt ist, das nicht unter kurzfristigen Aspekten zu sehen ist, sondern als eine Entwicklung, die man sicher über zehn Jahre beobachten muss. Und was Herr Selle sagte, das ist ein wichtiger Aspekt: die Sozialverträglichkeit in einer Stadt, damit man davon abkommt, nur auf die jeweiligen Quartiere zu sehen und die übrige Stadt in Wohlgefälligkeit mit sich in Frieden zu lassen.
Dazu ein Beispiel. Wir haben ein Projekt in einem Stadtteil vor der Stadt - es ist wie im Neuen Testament: die Siechen liegen draußen vor der Stadt. Als das begonnen war, hat sich eine einzige Ratsfrau dort sehen lassen. Das ist bis jetzt nach zwei Jahren ein Erfolg und hat sich herumgesprochen. Am Sonntag war ein "Tag der offenen Tür", und der Stadtteil vor der Stadt wimmelte nur so von Menschen aus der Stadt. Es hat sich herumgesprochen, dieser Stadtteil gehört eigentlich zu uns, da müssen wir mal hingehen. Jetzt wird die spannende Frage sein, ob eine neue Sozialverträglichkeit in einer Stadt entsteht und ob aus dieser Sozialverträglichkeit und einem zivilgesellschaftlichen Engagement heraus eine neue Nachbarschaft entstehen kann mit diesem "Draußen vor der Stadt".
Das wird eine spannende Frage für uns in den nächsten zwei Jahren: Sind die Leute, die am Sonntag da waren, auch belastbar genug, dass man sie anspricht: "Ihr könntet eigentlich auch mal einige Stunden oder einen halben Tag am Sonntag, Montag oder Dienstag hier mitwirken, um Kindern oder Erwachsenen beizustehen bei irgendwelchen Aufgaben, die sie nicht selbst erledigen können, die Betreuung wahrzunehmen über die üblichen Öffnungszeiten hinaus." Dies ist ja auch ein Thema, dass die Kindertagesstätten um halb fünf oder fünf schließen und für die Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter, die am Abend bis 20 Uhr arbeiten, ist dann "Betreuung Null" ab einer bestimmten Zeit. Hier braucht es auch das zivilgesellschaftliche Engagement, von dem auch mal der Bundeskanzler gemeinsam mit einem anderen europäischen Staatsmann gesprochen hat, aber das wieder in die Versenkung verschwunden ist. Lässt sich dieses zivile Engagement von Ehrenamtlichen oder Freiwilligen in solche Projekte mit einführen? Solche Projekte laufen durch professionelle Träger wie AWO, Diakonie, Caritas, aber das freiwillige Element wird noch zu wenig in solche Projekte eingebracht.
 Ralf Elsässer
Ralf Elsässer
Wir hatten einen Wettbewerb zur Entwicklung eines Logos für diesen Gesamtraum durchgeführt, haben ihn mit ganz geringen Preisgeldern ausgeschrieben. Das waren insgesamt 3 000 Mark für ein Logo und dann noch einmal 1 000 Mark für einen Slogan. Wir hatten an die hundert Einsendungen von vielen Privatpersonen bis hin zu Agenturen und haben dann in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ein Logo für den Stadtteil entwickelt und einen Slogan gefunden: "Im Osten geht die Sonne auf", der übrigens von 13 Personen unabhängig voneinander vorgeschlagen wurde. Also er drängt sich auf. Wir versuchen, weiter Leitbilder zu entwickeln, um ein Signal zu setzen. Die Frage war ja auch vorhin: was erwarten die Leute eigentlich von der sozialen Stadt, wird sie gebraucht? Ich glaube, die Leute interessiert nicht, wie das Instrument heißt, mit dem man da umgeht. Sie erwarten klare und in sich konsistente Signale.
Es ist wichtig, dass die Verwaltung ihren Teil dazu beiträgt, und dass sie die Vor-Ort-Akteure auffordert, selbst etwas dazu beizutragen. Es ist allerdings ein Problem, wenn wiederum andere Verwaltungsteile, die in solche Programme mit ihren Arbeitsinstrumenten nicht integriert sind, nicht am gleichen Strang ziehen. Wenn man also einerseits mit Fördermitteln einen Parkplatz baut und andererseits im Rahmen der Schulplanung beschließt, das letzte Gymnasium im Umfeld des Programmgebietes zu schließen, dann fragen sich die Leute vor Ort natürlich: in welche Richtung geht es denn jetzt hier? Das erfordert ein einheitliches Management und das Infragestellen von Prioritäten, das heißt ein Umkehren von einer nachfrageorientierten Planung hin zu einer Angebotsplanung. Wenn ich eine Schulnetzplanung danach ausrichte, wo die meisten Kinder gerade hinziehen, dann verstärke ich genau die Wanderungsbewegungen, die zu problematischen Gebieten führen. Also müsste ich gerade umgekehrt Prioritäten setzen. Jugendhilfeplanung in Leipzig versucht das und setzt genau entgegengesetzte Schwerpunkte. Interessanterweise sind es zwei Fachbereiche in dem gleichen Dezernat, die quasi entgegen gesetzte "Philosophien" in ihrer Planung haben. Aber das Wichtige ist für den Bürger, dass ein stringentes Signal gesetzt wird, und dann müssen alle an einem Strang ziehen.
 Ercan Idik
Ercan Idik
Ich denke, dass die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf auch im gesamtstädtischen Kontext eine gewisse Funktion erfüllen. Der Rest der Stadt kann sehr viel darauf abladen. Das ist sicher stadtsoziologisch nicht uninteressant, auch im Zusammenhang mit der Frage nach dem Image eines Stadtteiles. Wir haben im Jahre 1999 im Zusammenhang mit dem Abschluss der Internationalen Bauausstellung mit sehr hohem Aufwand und mit einem etwa 80-prozentigen Anteil der Entwicklungsgesellschaft Duisburg ein großes zweitägiges Stadtteil-Festival durchgeführt. Da waren die Planungen so, dass dann der Anteil der Entwicklungsgesellschaft zurückgefahren werden muss. Letzten Endes haben wir dies auch geschafft, weil die Frage des Images die Leute vor Ort unheimlich bewegt, dass der Anteil für dieses Jahr gerade noch etwa 20 Prozent beträgt, was die gesamten Vorbereitungen anbelangt. Und an Qualität ist das gar nicht so unterschiedlich zu dem, was wir 1999 gemacht haben.
Den Schlüssel machen die Vereine des Stadtteiles aus. Ich schätze mal, dass bereits in der Vorbereitungsphase so an die 20, 30 Vereine zusammenkommen, einen Teil machen die türkischen Geschäftsleute gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe "Stadtteilmarketing", die dann einen zentralen Platz organisieren, und einen Teil macht die Initiative Ideenwerkstadt Kaiser-Wilhelm-Straße, die ihre Straße in einem wesentlich besseren Image darstellen möchte, als es bislang ist, weil dieses Unbehagen bei den Menschen auch zu spüren ist. Deswegen besteht auch in der Regel der Wille, aktiv zu werden. Aber in der Tat sind die Voraussetzungen dafür da, dass gemanagt wird, dass Kommunikation und idealer Weise anschließend auch Kooperation stattfindet - dann klappt es auch.
 Ercan Idik
Ercan Idik
Doch, beides. Vor allem in dem Projekt Kaiser-Wilhelm-Straße geht es darum, die vorhandene Mittelschicht - auch Migranten - dort zu halten, auch unter Berücksichtigung dessen, dass sich eine neue Mittelschicht etabliert. Das ist nicht so einfach. Die Migranten wissen sehr wohl, dass sie das erarbeiten müssen, sind auch entsprechend motiviert und in der Lage. Das geht in der Regel durch die Entwicklung von Selbständigkeit, indem man dieses Potenzial des Stadtteiles dazu befähigt. Das erklärte Ziel der Kaiser-Wilhelm-Straße ist es, die bestehenden Mittelschichtangehörigen und das Bildungsbürgertum zu halten und ganz gezielt zu ergänzen, neue Bewohner hinzu zu bekommen - dies anhand einer Profilierung der Straße -, wohl wissend, dass diese Straße Ausstrahlungseffekt auf den gesamten Stadtteil haben wird.
Wir haben für diese Straße ein eigenes Leitbild unabhängig davon, dass es bereits 1997 ein Leitbild für den gesamten Stadtteil gab. Dort steht die Internationalität im Vordergrund - allerdings nicht die Internationalität, von der Frau Roth heute Morgen gesprochen hat, sondern die belastbare oder belastete Art von Internationalität im täglichen Umgang, und darauf kommt es letztlich an. Das Leitbild lautet "Internationale Wilhelmstraße". Das Profil soll so sein, dass die internationale Qualität den Ausschlag dafür gibt, dass sich der Standort, die Straße, als solcher profilieren kann. Es geht darum, dass dann auch Nachfrage von außerhalb dorthin kommt. Die Voraussetzungen dafür sind ideal. Aber das geht nur anhand konkreter Projekte, dass beispielsweise eine Kunst- und Kulturmeile errichtet wird oder dass Gastronomie angesiedelt wird.
 Prof. Dr. Klaus Selle
Prof. Dr. Klaus Selle
Zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass die Gebiete, von denen wir reden, nicht diese Gebiete sind. Ich meine, Herr Tiefensee hat das heute Morgen gesagt: "Man muss mit der Lupe hingucken." Wir haben es mit ganz verschiedenen Gebietskulissen zu tun. Es gibt z.B. Gebiete mit einer hoch immobilen Gruppe, ein ganzer Sockel sozusagen an langfristig dort wohnenden Menschen, und darüber eine Schicht, die sich sehr schnell austauscht. Da gilt dann die Strategie, die wir gerade für die Kaiser-Wilhelm-Straße gehört haben, wo man versucht, vorhandene stabile Gruppen zu halten. Die Gruppen außerhalb dieser Quartiere sollte man nicht versuchen, in die Stadtteile hineinzuwerben. Das ist auch gar nicht Erfolg versprechend angesichts der Gesamtbevölkerungszahlen der Städte, die vorhin Herr Pfeiffer noch einmal in Erinnerung gerufen hat.
Viel entscheidender ist, dass in der Gesamtstadt ein Bewusstsein dafür entsteht, dass Gleichheit von Chancen herzustellen ist, und das heißt: Wenn jemand Ungleiches gleich behandeln will, muss er es ungleich behandeln, das heißt, man muss mehr in den Stadtteilen tun, die besonders belastet sind. Früher hat man dies "kompensatorische Planung" genannt. Es geht um Gerechtigkeit, die dadurch herzustellen ist, dass in der gesamten Stadt ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man in bestimmten Stadtteilen, die man gemeinhin benachteiligt nennt, mehr tun muss, um überhaupt die gleichen Chancen zu schaffen.
|
 Prof. Dr. Klaus Selle
Prof. Dr. Klaus Selle
Gerade im Bereich Bildung, da denke ich vor allem an die Schulen.
 Gertrud Hautum
Gertrud Hautum
Wenn Sie so wollen, gibt man diese besonderen Mittel in die Stadtbezirke hinein, um dort Defizite abzubauen, für die der städtische Haushalt sonst momentan nicht in der Lage wäre. Auch München hat die Probleme, die heute jede Stadt hat. Es gibt zwar in München sehr viele reiche Leute, aber die Stadt selbst ist in dem Sinn nicht unendlich dehnbar, ganz im Gegenteil, ein zweites Haushaltskonsolidierungskonzept steht bevor. Insofern sind wir froh und dankbar, wenn wir Defizite aufholen können. Es ist also ganz bewusst so, dass in diesen Stadtquartieren aufgeholt werden muss gegenüber anderen.
Ich möchte bei der Frage, was macht die Bewohnerschaft eigentlich bei dem Programm, noch einmal einsteigen. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass, wenn wir gerade in diesen Stadtbereichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger hervorrufen wollen, es denen aus verschiedensten Gründen ganz besonders schwer fällt, sei es, sie sind vielleicht der Sprache nicht so mächtig. Das gilt oft für ausländische Frauen, die noch überwiegend zu Hause leben. In vielen Familien sind die Strukturen noch so, dass Frauen zu Hause bleiben müssen. Es ist manchmal so, dass die Leute so viel arbeiten und auch so perspektivlos vor sich hinleben, dass sie aus diesem Grund gar nicht die Energie haben, sich dann auch noch bürgerschaftlich zu engagieren. Insofern sind wir eigentlich sehr positiv überrascht, wenn sich dann von 20 000 Einwohnern in einem dieser Stadtbereiche zwar nur wenige, aber doch immerhin nennenswert wenige organisieren lassen und sich tatsächlich mit Engagement dafür einsetzen. Es gibt auch Multiplikatoren, damit sich weitere derartige Grüppchen bilden können. Man dürfte eigentlich dieses bürgerschaftliche Engagement in solchen Stadtbereichen nicht einfach nur hinnehmen, in anderen vielleicht schon, aber in solchen müsste das auch ein bisschen honoriert werden. Ich weiß nicht, ob es nur damit geht, dass man es feiert, oder ob es einem einige Mark Wert sein sollte. Ich glaube, Letzteres wäre vielleicht nicht schlecht. Das hielte ich für ganz wichtig.
Gleichwohl glaube ich schon, dass man die Bewohnerschaft auch in solchen Quartieren dazu bringen kann, Selbstbewusstsein in ihrem eigenen Stadtteil zu entwickeln, und dazu gehören ein Logo und derartige Dinge, die das Bewusstsein für den eigenen Stadtteil, für die eigene Stadtteilgeschichte noch einmal präzisieren. Dazu gehört meiner Meinung nach auch, dass sich die restliche Stadt dafür interessiert. In München sind wir da natürlich noch nicht über dem Berg, dies sage ich Ihnen ganz offen. Von den zwei Gebieten ist besonders eines sehr verrufen. Jeder in der Stadt redet vom Hasenbergl, als ob es dort das größte Sicherheitsproblem gäbe. Ich muss es im Konjunktiv sagen, das stimmt nämlich tatsächlich nicht. Jeder meint, in dem Hasenbergl sagen sich wirklich die Hasen gute Nacht, aber sonst ist nix. Im Grunde genommen leiden die Bewohner gerade darunter, dass die Leute, die das sagen, meistens gar nicht in Hasenbergl wohnen.
Man muss prüfen, wie man das Image tatsächlich nach außen öffnet. Wir wollen dies versuchen, indem wir vermehrt durch Aktivitäten und Stadtteilprojekte Leute wenigstens aus dem benachbarten Stadtviertel reinholen, um das etwas durcheinander zu wirbeln. Ich setze da auch auf ein Studentenwohnheim. Wir haben unmittelbar neben dem Hasenbergl eine große Entwicklungsstätte, und da kommen 500 Studenten hin, wenn ich davon ausgehe, dass von 500 Studenten nach der richtigen Politik, möglichst viele Ausländer bei uns studieren zu lassen, dieses Spektrum ungefähr jenes in dem sozialen Stadtgebiet spiegelt. Wir hoffen sehr, durch dieses Quirlige, durch die Aufbruchstimmung dieser jungen Trägerschaft dann auch wieder etwas in dem Stadtteil zu implementieren, sodass sich die Situation verbessert.
 Bodo Menze
Bodo Menze
Ich hoffe nicht. Nein, ich glaube das nicht, weil Fußball ein absolut populärer Sport bei uns ist. Und die Jungens im Windschatten der Arena, im Windschatten von Schalke im Ruhrgebiet, im Windschatten der großen Clubs, die werden automatisch angezogen.
|
 Bodo Menze
Bodo Menze
Natürlich, der Fußball ist sicherlich auch eine Chance und Hoffnung, aus einer sozialen Misere herauszukommen und einen gewissen Status in der Gesellschaft zu erreichen. Ich glaube, dass deshalb auch im Nachwuchsbereich viele ausländische Jungen diesen Versuch starten und dass unsere Jungen da doch ein kleines bisschen "satter" sind und nicht so danach gieren, "nach oben" rauszukommen. Aber bevor wir auf die Schulsituation zu sprechen kommen - wir sind an und für sich in Nordrhein-Westfalen dabei mit dem Gesamtschulsystem aus meiner Erfahrung ganz gut -, erlauben Sie mir einen kleinen Schlenker zurück auf die laufenden Stadtteilprojekte. Da gibt es bei uns, ich erwähne noch mal Forum 2000 in Gelsenkirchen/Bismarck Schalke-Nord, meiner Ansicht nach sehr gute Ansätze. Man sollte zunächst noch einmal den Ball aufgreifen und darauf pochen, dass diese Programme auf eine lange Zeit ausgerichtet und nicht irgendwann abgebrochen werden.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. In Gelsenkirchen gibt es eine hohe Arbeitslosenquote; das Forum 2000 bezieht sich auf die Stadtteile Bismarck und Schalke-Nord. Man müsste meiner Meinung nach dieses Projekt ausweiten, weil Bismarck und Schalke-Nord nicht die einzigen Brennpunkte sind, sondern Schalke, Ueckendorf, alle diese Stadtteile sind davon betroffen. Diese persönliche Meinung wollte ich hier loswerden, weil ich spüre, dass man die Programme vielleicht fallen lassen könnte, dabei müsste man sie eher erweitern. Noch ein Beispiel: In Schalke-Nord, dort, wo sich auf dem Weg nach Schalke die Glückauf-Kampfbahn befindet, gibt es sehr viele Leute, die einfach wegziehen. Es gibt Ladenlokale, die leer stehen. Heute Morgen fiel der Begriff "broken windows" als schlechtes Beispiel mit problematischen Wirkungen. Ich finde, dass schon ein Ladenlokal, das ein halbes Jahr leer steht und bei dem die Scheibe total verschmutzt ist, diesen Effekt auslöst.
 Ercan Idik
Ercan Idik
Das ist absolut richtig. Deswegen ist es wichtig, die Komplexität einer Stadt in den Griff zu bekommen. In dem Zusammenhang ist es schade, dass die Kollegen vom Städtebauministerium immer ein wenig "Nationenprobleme" haben. Es sollte eigentlich umgekehrt sein, dass die Bildungsminister, die Wirtschaftsminister und all die anderen Ressorts sich überlegen, warum sie das - die Musik spielt nämlich in der Stadt - nicht mehr in den Vordergrund stellen. Vor ein paar Wochen ist durch den Vorsitzenden des Atias - das ist ein Verband der türkischen Geschäftsleute in Europa, also schon etwas stärker als das Klientel, mit dem wir auf Stadtteilebene zu tun haben - erstmalig die Frage der Quotierung im Bereich der Bildung in die Diskussion geworfen worden. Das ist meines Wissens bundesweit in der überregionalen Presse erschienen, vor drei Wochen, schätze ich. Auch nach drei Wochen ist das leider von niemanden in irgendeiner Weise aufgegriffen worden. Das Gleiche ist auch in Duisburg passiert. Dort hat der Vorsitzende des Vereins der türkischen Geschäftsleute mehr oder weniger in gleicher Richtung appelliert, dass man eine Quotierung einführen muss auch in den Kindergärten, eine Quotierung, die dahin geht, dass der Anteil der Migranten eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Man kann darüber streiten, ob das 20, 15, 30 oder wieviel Prozent auch immer sein sollen. Leider Gottes findet das überhaupt keine Reaktion. Die Qualität dieses Vorschlages liegt darin, dass erstmalig Migranten sich in aller Friedlichkeit darüber äußern, wie sie ihre Probleme sehen und wie sie sie dann auch gelöst bekommen würden. Dieser Qualitätssprung ist nach meiner Ansicht in keinster Weise erkannt worden. Man hat es noch nicht einmal für würdig befunden, diesen Vorschlag in irgendeiner Weise weiter zu diskutieren. In Duisburg ist er mehr oder weniger unter dem Motto "nicht machbar" abgehakt worden.
Die Frage der Migration hat die Diskussion hier beeinflusst, auch wenn sie nicht explizit das Thema der Veranstaltung ist. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und insbesondere im Ruhrgebiet ist die städtische Frage in erster Linie eine Emigrationsfrage. Solange man sich nicht in sehr differenzierter Art und Weise des Themas annimmt, es ernst nimmt und dann auch entsprechende Verhaltenssituationen von Migranten gewährleistet, dann bleiben sehr viele dieser Fragen einfach im luftleeren Raum, und man kommt letzten Endes in der Problemlösung nicht sehr weit. Das ist allerdings jetzt nicht unbedingt eine Frage des Programms.
 Prof. Dr. Klaus Selle
Prof. Dr. Klaus Selle
Deswegen sprach man ja früher ganz verräterisch von den "Sozialen Brennpunkten". Es brennt, die Sozialfeuerwehr fährt hin, tatütata, löscht, Problem gelöst. Das war offensichtlich ein ganz falsches Bild, denn so lassen sich diese Quartiere nicht löschen, das ist ein Dauerproblem, was sich strukturell ausweitet. Wenn Sie sich die Zahlen von Herrn Pfeiffer noch mal vergegenwärtigen: 100 Lebende haben heute 64 Kinder, die werden 39 Enkel haben, dann haben wir die Problematik der "broken windows" demnächst flächendeckend, nicht nur im Osten, nicht nur in Leipzig. Und wir haben gleichzeitig, wenn wir versuchen, Gegenstrategien umzusetzen, Städte kinderfreundlicher und zuwanderungswilliger zu machen, die Probleme, die wir heute in den so genannten benachteiligten Quartieren haben, als Strukturprobleme in den ganzen Städten, von wenigen Münchner Ausnahmen einmal abgesehen. Deswegen sind jetzt diese Stadtteile im besten Sinne Testfelder für eine Stadtpolitik der Zukunft. Und wenn sie nur so verstanden würden, wie Sie das gerade zu Recht kritisieren, wir befrieden da irgendwas und kommen gar nicht an die Ursache ran, dann sähe es schlecht aus für die Zukunft der Stadtpolitik.
 Klaus Pfitzenreuther
Klaus Pfitzenreuther
Wir haben hier über die derzeitigen sozialen Problembereiche gesprochen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit Untersuchungen umfassender Art gemacht, und wir sind dabei, ein Gespür zu bekommen, wo wir demnächst unsere großen Wohnquartierprobleme bekommen werden. Wir haben sehr viele treue Mieter, die sehr lange in ihren Wohnungen wohnen. Die Überalterung ist also ein Thema. Da sind die Wohnquartiere zurzeit unauffällig problematisch. Man merkt jetzt aber durch den Wegzug, ob einer ins Pflegeheim kommt oder verstirbt, da tut sich ein neues Feld auf. Man hat z.B. im Dortmunder Norden die Nordstadt ins besondere Bewusstsein gerückt und hat immense Fortschritte gemacht, was die Stadtpolitik, die Stadtentwicklung anbetrifft. Aber in anderen Stadtquartieren werden sich in den kommenden Jahren auf einmal Probleme auftun. Insofern ist das ein revolvierendes Problem. Das eine hat man gelöst, aber wenn man nachforscht, dann weiß man, in sieben, acht Jahren ist das Wohnquartier gefährdet, vielleicht sogar in seiner Grundsubstanz, weil dann möglicherweise nicht mehr genügend jüngere Familien nachkommen.
Und deswegen auch komme ich jetzt auf Familienpolitik zu sprechen. Es ist wichtig, dass ich dann in solche Wohnquartiere auch jüngere Familien reinbekomme, um der Überalterung entgegenzuwirken. Wenn wir jetzt zu dem Fokus auf der einen Seite auch die Gegenstandsprobleme wälzen - in den nächsten Jahren werden dort andere Probleme entstehen. Da ist es ganz wichtig, dass dort schon die Wohnungswirtschaft selber - wir haben ja ein ganz originäres auch wirtschaftliches Interesse daran, die Wohnungen zu vermieten - sich bemüht, die Wohnungen entsprechend belegt zu bekommen. Deswegen denken wir auch schon fünf oder zehn Jahre weiter. Da gibt es auch behutsame Ansätze von Seiten der Kommunen, uns sehr bereitwillig und wohlwollend zu unterstützen. Wir haben verschiedene Gutachten über die Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Statteilen. Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft eine zentrale Person gibt, die dieses Problem auch zentral managt. Sie sprachen vorhin von Quartiersmanagern, da sind viele neue Aufgaben zu definieren.
|
 Dr. Manfred Ragati
Dr. Manfred Ragati
Die Arbeit mit Menschen geht bei uns über das Prinzip Hoffnung. Mit Menschen kann man arbeiten, man kann ihnen Hoffnung machen. Wenn ich mir das Programm Soziale Stadt anschaue, dann ist das eigentlich ein Reparaturprogramm. Mit dem Titel des Programms, "Soziale Stadt", wird eigentlich verdeckt, was die Ursachen dafür sind, dass wir jetzt ein Programm Soziale Stadt auflegen. Aber das würde jetzt eine neue Diskussion bedeuten, die Ursachen der Arbeitsmarktpolitik, Schulpolitik, fehlenden Integrationspolitik bei Zuwanderung, die gar nicht stattgefunden hat, diese Themen aufzugreifen. Vielleicht könnte das im Sinne von Ernst Blochs "Prinzip Hoffnung" dann künftig Programme wie Soziale Stadt überflüssig machen.
|
 Prof. Dr. Klaus Selle
Prof. Dr. Klaus Selle
Im Prinzip habe ich es schon gesagt. Das Szenarium ist eindeutig, wir kriegen Stadtprobleme ganz neuer Art. Eine schrumpfende Stadt ist ein sehr schlechtes Bild, aber das kennzeichnet so ein bisschen das Szenario. Und darauf muss man reagieren. Und die Strategien, die wir jetzt in diesen Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf erproben, sind Prototypen, wenn es gut läuft. Deswegen habe ich ein großes Interesse daran, dass sie gut werden, wo sie es noch nicht sind.
|
 Gertrud Hautum
Gertrud Hautum
Die Studenten richten das natürlich nicht. Aber ich kann Herrn Dr. Ragati völlig beipflichten, solange wir in München ein derartiges Wohnungsproblem haben, und es zeichnet sich nicht ab, dass sich das schnell beheben lässt, müssen Alternativen erdacht und ausgelotet werden; ohne das werden wir keine Soziale Stadt im eigentlichen Sinne einer wirklich ausgewogenen Stadt haben. Als Kommune können wir aber nicht nur nach dem Prinzip Hoffnung leben, dass von außen etwas passiert. Wenn ich die Stadtpolitik bei uns betrachte, so ist sie tatsächlich sehr stark darauf ausgerichtet, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, einen Ausgleich zu erreichen. Es bietet sich auch gar keine andere Alternative an als die, mit Mitteln der Sozialen Stadt auch komplexe Themenfelder anzugreifen. Es hat sich inzwischen bewährt und eingespielt. Möglicherweise muss es noch sehr viel mehr verfeinert werden, wir müssen ganz neue Beteiligungsformen finden. In einer Welt, in der viele Leute gar nicht mehr wissen, woher bestimmte Dinge kommen und warum das alles so ist, gilt es umso mehr, sich für den eigenen persönlichen Bereich wieder einen Durchblick zu verschaffen. Das kann man am besten in seiner eigenen Umgebung, beim Mitgestalten dieser Projekte. Deswegen geht es, glaube ich, in einer Stadt, die im sozialen Frieden bleiben will, tatsächlich einfach um die Frage: wie kann ich die Leute wieder an dem politischen Miteinander interessieren. Das ist jetzt nicht parteilich gemeint, sondern im stadtpolitischen Zusammenspiel.
|
 Ercan Idik
Ercan Idik
Ich bin von Natur aus optimistisch, so auch hier. Denn beispielsweise sagt ein türkischer Unternehmer, eines der Probleme unserer Stadtteile sind die vor den Cafés herumlungernden Jugendlichen. Er macht dann nicht nur diese Feststellung, sondern wird aktiv und kümmert sich konsequent um Ausbildungsplätze für diese Jugendlichen. Das ist eine recht optimistische, aber zum Glück eine reale Begebenheit. Von daher denke ich auch an eine kleine Variation des Titels: "Zukunft durch Vielfalt".
|
 Bodo Menze
Bodo Menze
Wenn Schalke den Pokal am Samstag holt und dann im nächsten Jahr international gut dabei ist, dann dürfte die nächste Zukunft sicher sein. Danke für die blauweiße Kulisse. Das haben Sie gut gemacht. Nein, ich würde dies jetzt nicht von einer Deutschen Meisterschaft abhängig machen. Aber es ist für meine Begriffe sehr wichtig für den Club, die Stadt, die Arena. Das, was sich drumherum ergibt und etabliert, halte ich persönlich für die Stadt Gelsenkirchen für sehr positiv. Da auch ich ein positiv denkender Mensch bin, sage ich, die Zukunft sieht ganz gut aus.
|
 Ralf Elsässer
Ralf Elsässer
Ich denke, die notwendigen Abrisse sind ein gutes Zeichen für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sich hier etwas zum Guten verändert. Veränderung ist ja nicht immer nur etwas Negatives. Wir haben über die Probleme im Umgang mit Veränderung heute Vormittag einiges gehört, aber wir brauchen auch positive Veränderungen. Wenn ich die Hoffnung nicht hätte, würde es mir keinen Spaß machen, an dieser Sache zu arbeiten. Aber mir macht es Spaß, weil ich diese Hoffnung habe. Trotzdem ist deutlich geworden, dass dies kein eng begrenztes lokales Problem ist, sondern wir es mit einem flächendeckenden Problem zu tun haben, was sich möglicherweise auch noch ausbreitet. Deswegen geht es nicht, praktisch zu realisieren, dass man zusätzliche Mittel irgendwo hernimmt und auf diese Orte verteilt. Wir müssen grundsätzlich umstrukturieren und heilige Kühe schlachten. Ohne dass irgend jemandem etwas weggenommen wird, können wir diese Soziale Stadt nicht gestalten. Zwei Beispiele, die das illustrieren können: In punkto Abriss muss natürlich auch eine Motivation geschaffen werden, dass Eigentümer, die keine Aussicht auf eine wirtschaftliche Verwertung ihrer Grundstücke haben, diese auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das bedeutet eine Anforderung an das Grundsteuersystem, dass wirtschaftlich nicht genutzte Grundstücke derart besteuert werden, dass sie praktisch entwertet sind, damit sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wir haben es mit einem Mengenproblem zu tun, das ist sicher ein spezifisch ostdeutscher Vorschlag vor dem Hintergrund der Probleme. Aber wir hörten ja, das wird in anderen Städten auch zunehmen. Der zweite Vorschlag, schon oft gemacht, aber nie ernsthaft umgesetzt, ist einfach eine konsequente Abschaffung der Eigenheimzulage. Wir können doch nicht in den Städten Fördermittel geben und im Umland extra auch noch Steuermittel.
|
Quelle: Kongress Die Soziale Stadt - Zusammenhalt Sicherheit, Zukunft, Dokumentation der Veranstaltung am 7. und 8. Mai 2002 in Berlin, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, November 2002 |
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005
 Unser Thema heute soll "Soziale Stadt - Vielfalt und Zukunft" sein. Das Thema ist, wie Sie dem Titel entnehmen können, ein recht ambitioniertes Unterfangen. Ich hoffe, dass wir uns anhand der einzelnen Programmgebiete diesem Thema nähern können.
Unser Thema heute soll "Soziale Stadt - Vielfalt und Zukunft" sein. Das Thema ist, wie Sie dem Titel entnehmen können, ein recht ambitioniertes Unterfangen. Ich hoffe, dass wir uns anhand der einzelnen Programmgebiete diesem Thema nähern können. Zunächst möchte ich festhalten, dass die Stadt München schon seit vielen Jahren in der normalen Städtebauförderung einen sehr integrativen Ansatz pflegt. Nicht zuletzt ist dies auch der Grund dafür, dass Herr Oberbürgermeister Ude in seiner Rede heute das Westend so hat herausstreichen können. Dort gibt es nämlich bereits seit 20 Jahren Stadtsanierung. Dadurch ist dort ein relativ friedliches Zusammenleben der unterschiedlichsten ethnischen Gruppierungen und eine sehr große Vielfalt der Nutzungen eingetreten.
Zunächst möchte ich festhalten, dass die Stadt München schon seit vielen Jahren in der normalen Städtebauförderung einen sehr integrativen Ansatz pflegt. Nicht zuletzt ist dies auch der Grund dafür, dass Herr Oberbürgermeister Ude in seiner Rede heute das Westend so hat herausstreichen können. Dort gibt es nämlich bereits seit 20 Jahren Stadtsanierung. Dadurch ist dort ein relativ friedliches Zusammenleben der unterschiedlichsten ethnischen Gruppierungen und eine sehr große Vielfalt der Nutzungen eingetreten.