|
Moderation:
Auf dem Podium:
|

 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
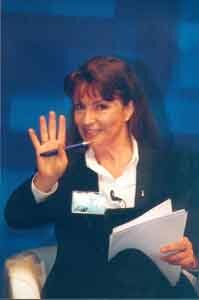 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur ersten Podiumsdiskussion des Kongresses begrüßen. Ich habe die sehr schöne Aufgabe, die Diskussionsrunde zu moderieren. Zunächst möchte ich meine äußerst unterschiedlichen, sehr interessanten Gäste begrüßen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur ersten Podiumsdiskussion des Kongresses begrüßen. Ich habe die sehr schöne Aufgabe, die Diskussionsrunde zu moderieren. Zunächst möchte ich meine äußerst unterschiedlichen, sehr interessanten Gäste begrüßen.
Ich beginne rechts von mir und heiße Herrn Dr. Werner Perger sehr herzlich willkommen. Herr Perger ist politischer Redakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", und wir als Ihre Leser, Herr Perger, verstehen Sie als einen Anwalt des Wandels, als jemand, der sich in hohem Maße mit kriti-schem geschärftem Blick dem Thema "Veränderung und Wandel" in unserer Gesellschaft quer durch alle Strukturen widmet.
Ich begrüße sodann Herrn Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin. Herr Nida-Rümelin hat mir vorhin den "Rattenschwanz" von staatstragender Bezeichnung seines Amtes quasi aus der Hand geschlagen: er ist schlicht unser Kulturstaatsminister.
Links neben mir begrüße ich Herrn Prof. Dr. Christian Pfeiffer, den Justizminister des Landes Niedersachsen. Er ist darüber hinaus für unser heutiges Thema "Sicherheit" höchst kompetent, denn er ist von Hause aus Kriminologe und hat lange das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover geleitet. Überdies haben Sie, Herr Pfeiffer, vor vier Jahren die erste deutsche Bürgerstiftung gegründet, eine Vereinigung … - aber das sagen Sie besser selbst.
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
In aller Kürze: Wir versuchen, die Zeitreichen, die Ideenreichen und die Geldreichen einer Kommune unter ein Dach zu bringen und ein Innovationszentrum für Kultur-, Jugend- und Sozialprojekte zu schaffen.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Ich freue mich ganz besonders, Prof. Dr. John Friedmann von der University of British Columbia, Vancouver, in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Prof. Friedmann ist Raumplaner, Entwicklungsforscher und ist - in unserem Zusammenhang vielleicht auch von Bedeutung -, in Wien geboren, hat im Laufe seines Lebens auf allen Kontinenten dieser Welt, wohlgemerkt in den jeweils entscheidenden Städten, gelebt. Herr Friedmann, herzlich willkommen.
Es spricht ja mit Sicherheit für die Reputation von Wissenschaftlern, wenn sie auf einem Kongress innerhalb von drei Stunden gleich dreimal zitiert werden. Und so möchte auch ich noch einmal Hartmut Häußermann, diesmal allerdings in Ko-Autorenschaft mit Walter Siebel, zitieren. Beide befanden 1987 sinngemäß: Stadt - was für ein knappes Wort für eine solche Vielfalt von Wirklichkeiten: das sündige Babel, das heilige Jerusalem, Venedig, die Lagunenstadt, Sparta und Athen, Paris, das Erotische, der Siedlungsbrei des Ruhrgebietes, Bos-Wash, dieses Städteband, das sich von Boston nach Washington zieht. Macht es Sinn, da von der Stadt zu sprechen?
Ich denke, diese Überlegung wird sich ein wenig auch durch die heutige Reflexion hier oben auf der Bühne ziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Reden heute Morgen ist deutlich geworden, dass der Umbruch in unserer Gesellschaft, der sich unstrittig gerade vollzieht, sich vor allem in unseren Städten vollzieht. Er vollzieht sich eben nicht in den kleinen, idyllischen Dörfern in der Eifel, in Mecklenburg-Vor-pommern, sondern in den Metropolen. Diese sind Motor des gesellschaftlichen Wandels.
Wir wollen hier versuchen, diese Software Stadt gemeinsam "anzufassen". Was ist Stadt im Jahre 2002? Und gleich die Frage an Sie, Herr Professor Friedmann: Warum sind die europäischen Städte so ganz anders als die amerikanischen und die asiatischen? Sie kennen Sie ja alle.
|
 Prof. Dr. John Friedmann Prof. Dr. John Friedmann
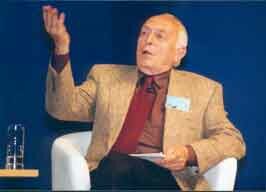 Ich weiß nicht, ob ich diesem Diktum beipflichten würde. Historisch gesehen ist es bestimmt so, wie Sie gesagt haben. Aber ich meine, dass eine ganz große Änderung im Gang ist. Heutzutage sprechen wir als Planer eher von einer Stadtregion als von einer ummauerten Stadt. Zu Zeiten meines Vaters oder meines Großvaters war ja Wien noch eine ummauerte Stadt. Und für Max Weber bedeutet die Mauer die Abgrenzung des Städtischen vom Ländlichen. Wir sagen immer, wir ziehen in die Stadt, um in Freiheit zu leben. Stadt macht frei, Stadtluft macht frei, das war das Leitmotiv. Ich weiß nicht, ob ich diesem Diktum beipflichten würde. Historisch gesehen ist es bestimmt so, wie Sie gesagt haben. Aber ich meine, dass eine ganz große Änderung im Gang ist. Heutzutage sprechen wir als Planer eher von einer Stadtregion als von einer ummauerten Stadt. Zu Zeiten meines Vaters oder meines Großvaters war ja Wien noch eine ummauerte Stadt. Und für Max Weber bedeutet die Mauer die Abgrenzung des Städtischen vom Ländlichen. Wir sagen immer, wir ziehen in die Stadt, um in Freiheit zu leben. Stadt macht frei, Stadtluft macht frei, das war das Leitmotiv.
Aber heute finde ich - und das kommt vielleicht aus meiner Erfahrung, 27 Jahre lang in Los Angeles gelebt zu haben, aber nicht nur dort -, dass das Städtische, das Urbane, dass der ganze Raum sich mit dem Urbanen aufgefüllt hat. Die Grenze ist nicht mehr so leicht zu finden. Selbst die großen Ballungsräume, die wir jetzt in Asien sehen, zum Beispiel im Pearl-River-Delta im südlichen China mit seinen 30 Millionen Menschen, sind neue Gebilde, mit denen wir zu Recht kommen müssen. Europa wird aber auch von dieser Änderungswelle "mitgerissen"; man kann ihr nicht wirklich entkommen.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Stichwort Änderung - Herr Dr. Perger, ich spreche Sie als unseren "Wandlungsexperten" an: Wenn wir Stadt - unter Einbeziehung der Erkenntnis, dass es Stadt als homogene Struktur nicht gibt - dennoch als den Nukleus von Veränderung akzeptieren, was sind dann Ihrer Meinung nach die größten Veränderungen, die härtesten Erscheinungen des Wandels, die jetzt auf uns zukommen?
|
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
 Frau Bastgen, die Stadt, da stimme ich Ihnen zu, ist natürlich in der Geschichte Motor von Veränderung und von Entwicklung gewesen. Aber was wir jetzt beobachten, ist natürlich in erster Linie, dass sie Schauplatz von Ver-änderungen ist. Die Städte können diese Ver-änderungen so wenig direkt beeinflussen, wie heute nationale Regierungen dies tun können. Wir kennen alle den Spruch: "All politics is local." Und wir kennen auch den Satz: "Man muss global denken, aber lokal handeln", weil die Politik eben vor Ort stattfindet. Aber es gilt heute auch die Einsicht: "All economics is global", und wir sprechen deshalb von der Globalisierung. Die Auswirkungen der Globalisierung spürt man heute am stärksten in den Städten. Frau Bastgen, die Stadt, da stimme ich Ihnen zu, ist natürlich in der Geschichte Motor von Veränderung und von Entwicklung gewesen. Aber was wir jetzt beobachten, ist natürlich in erster Linie, dass sie Schauplatz von Ver-änderungen ist. Die Städte können diese Ver-änderungen so wenig direkt beeinflussen, wie heute nationale Regierungen dies tun können. Wir kennen alle den Spruch: "All politics is local." Und wir kennen auch den Satz: "Man muss global denken, aber lokal handeln", weil die Politik eben vor Ort stattfindet. Aber es gilt heute auch die Einsicht: "All economics is global", und wir sprechen deshalb von der Globalisierung. Die Auswirkungen der Globalisierung spürt man heute am stärksten in den Städten.
In Ihrer ersten Bemerkung sprachen Sie, Frau Bastgen, auch von dem Gegensatz und von der Bedeutung der Städte. Ich habe in diesem Zusammenhang das Bild der Idylle draußen auf dem Land mit dem Wald assoziiert, wo man die Vögel hört. Manche haben das Glück, dies vielleicht einmal im Urlaub zu erleben, andere, wenn sie in den Vorstädten wohnen; die in den Städten erleben das jedoch nicht mehr. In den Städten bleibt die Zeit nicht stehen, das Gegenteil ist der Fall. Die Städte sind der Schauplatz der Beschleunigung und der Veränderung in der Welt. Wenn wir über die Probleme von Wandel und die mit Wandel einhergehenden Probleme reden, reden wir nicht unbedingt von den Veränderungen selbst, sondern von der Beschleunigung dieser Veränderung. Die Menschen erfahren vor allem die Beschleunigung als Belastung - und damit müssen wir uns in den Städten als Schauplatz der Veränderung am meisten beschäftigen. So spannend der Wandel ist und so wichtig Reformen sind, so groß sind die Probleme, die damit einhergehen und die einen Druck, auch einen seelischen Druck, ausüben.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Sie heben auf Beschleunigung ab. Städte waren ja ursprünglich - von ihrer Gründungsidee her - Orte, in denen man verharrte, Orte zum Verharren. Beschleunigung bedeutet auch Reibungsverlust. Herr Prof. Pfeiffer, wo sehen Sie Reibungsverluste in unseren modernen Städten?
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
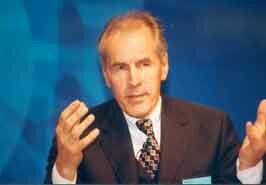 Für mich liegt die Herausforderung für die Städte insbesondere darin, mit einigen Zahlen und Daten umgehen zu müssen: Für mich liegt die Herausforderung für die Städte insbesondere darin, mit einigen Zahlen und Daten umgehen zu müssen:
Hundert Deutsche haben gegenwärtig noch 63 Kinder und können bei Konstanthaltung der gegenwärtigen Geburtenrate mit 39 Enkeln rechnen. Das heißt, entweder müssen wir die Städte zu Orten machen, in denen es nicht nur um "Wortblasen" zur neuen Familienpolitik geht, sondern sich die Verhältnisse real so verändern, dass Frauen angstfrei und mehr als gegenwärtig Kinder in die Welt setzen. Oder wir müssten wirklich Ernst machen mit dem Zuwanderungsland Deutschland und dann ganz andere Rahmenbedingungen schaffen. Ich will noch eins sagen, worin für mich Hoffnung steckt: Dieses Verhältnis 163 zu 39 bedeutet natürlich, dass die Generation der Enkel sozusagen trichterförmig erben wird von allen Seiten, von Onkeln und Tanten und Anverwandten, die keine Kinder mehr haben. Das verheißt den Stiftungen der Zukunft gute Perspektiven, auch den Bürgerstiftungen.
Es gibt die Ansicht, "multikulti" sei ganz problemlos: Diese Behauptung kann ich überhaupt nicht bestätigen. Als Kriminologe gehöre ich zu jenen, die die "Fieberkurve" der Gesellschaft messen. Und da fiebert es gewaltig. Wenn wir nur ein Datum nehmen, das uns entsetzen muss: Wir haben 30 000 Jugendliche, 15-, 16-Jährige, von Leipzig über München, Hannover, Hamburg, Stuttgart usw., gefragt, wie es bei ihnen zu Hause zugeht. Da sagt uns jeder dritte Türke, im letzten Jahr habe er gesehen, wie der Vater die Mutter prügelt, ganz selten auch einmal die Mutter den Vater. Bei den Deutschen war das bei acht Prozent der Fall. Dies zeigt: "multikulti" ist nicht so problemlos, denn wir importieren Machokulturen, mit denen wir erst einmal leben lernen müssen - und die mit uns. Ich habe vor vier Wochen in einer vollbesetzten Moschee in Göttingen über dieses Problem gesprochen und habe erfahren, dass der türkische Begriff für das, was sich da abspielt, "Pascha-Kültür" lautet. Das muss doch erörtert werden, hiermit dürfen wir nicht schweigend umgehen, weil wir in den Schulen die Probleme doch mit Händen greifen können. Die Verhältnisse sind sicherlich regional unterschiedlich. Wenn Herr Ude hier das Bild seiner Stadt zeichnet und sagt, "multikulti" funktioniere in München, dann übertreibt er noch nicht einmal: für München stimmt es, dort sind nur 7,9 Prozent der türkischen Eltern arbeitslos oder Sozialhilfeempfänger. In Hamburg sind es 24 Prozent. In München sind 17, 18 Prozent der jungen Türken im Gymnasium, in Hamburg sind es nur neun Prozent. In München sind acht Prozent der jungen Türken Mehrfachtäter der Jugendgewalt, in Hamburg dagegen 15 Prozent. Die Städte müssen aus diesen Daten lernen, dass Integration nicht einfach nur so herbeigeredet werden kann. Mich stört nicht nur die öffentliche Armut, auch die öffentliche Ideenlosigkeit, die herrscht, wen es darum geht, auf solche Daten zu reagieren. Bürgerstiftungen sind der Versuch, dem etwas entgegenzusetzen, weil wir ungeduldig sind, dass "die da oben" - jetzt bin ich einmal nicht Minister, sondern Bürger -, sich so wenig einfallen lassen, was wir tun müssen, damit in Hamburg z.B. für junge Türken andere Lebensbedingungen herrschen als zurzeit.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Jetzt haben Sie, Herr Prof. Pfeifer, einen Riesenbogen geschlagen, angefangen bei der demographischen Entwicklung über die Sicherheit in unseren Städten bis zur Ideenlosigkeit von "denen da oben". Bei Letzterem musste ich sofort an meine Jugendzeit denken, an Milovan Djilas, an "Ihr da oben, wir hier unten". Diese Form der politischen Diskussion wollen wir Ihnen hier und heute nicht zumuten, meine Damen und Herren. Dennoch: "die da oben", da spreche ich natürlich sofort Sie an, verehrter Herr Staatsminister, diese Bürde lastet jetzt auf Ihren Schultern, denn der Bundeskanzler ist schon gegangen. Wie gehen Sie damit um?
|
 Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
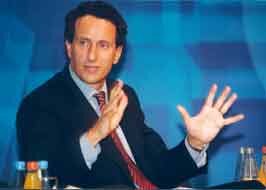 Wir sollten da anknüpfen, wo Herr Friedmann aufgehört hat. Herr Friedmann hatte gesagt, die behaupteten Unterschiede zwischen Europa, Asien und Amerika seien Vergangenheit. Ich spitze es etwas zu: Wir haben es mit einer globalen Stadtentwicklung zu tun. Die Unter-schiede werden sich nivellieren. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner befunden: Spaziergänger brauchen wir nicht in der Stadt. Wir brauchen auch keine Bürgersteige. Wer spazieren gehen will, der soll in den Stadtpark gehen. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner auch gefordert, wir sollten sorgfältig unterscheiden zwischen erstens Regionen, in denen gearbeitet wird, in denen "Dreck" entsteht, zweitens Regionen, in denen gewohnt wird und wo es ruhig sein muss, weil die Menschen schlafen müssen, und drittens Regionen, in denen Unterhaltung stattfindet. Ich denke, es ist gut, dass diese Visionen der Stadtplaner nicht vollständig umgesetzt wurden, sie haben genug Schaden angerichtet. Wir sollten da anknüpfen, wo Herr Friedmann aufgehört hat. Herr Friedmann hatte gesagt, die behaupteten Unterschiede zwischen Europa, Asien und Amerika seien Vergangenheit. Ich spitze es etwas zu: Wir haben es mit einer globalen Stadtentwicklung zu tun. Die Unter-schiede werden sich nivellieren. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner befunden: Spaziergänger brauchen wir nicht in der Stadt. Wir brauchen auch keine Bürgersteige. Wer spazieren gehen will, der soll in den Stadtpark gehen. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner auch gefordert, wir sollten sorgfältig unterscheiden zwischen erstens Regionen, in denen gearbeitet wird, in denen "Dreck" entsteht, zweitens Regionen, in denen gewohnt wird und wo es ruhig sein muss, weil die Menschen schlafen müssen, und drittens Regionen, in denen Unterhaltung stattfindet. Ich denke, es ist gut, dass diese Visionen der Stadtplaner nicht vollständig umgesetzt wurden, sie haben genug Schaden angerichtet.
Ich habe in der Tat die Hoffnung - auch wenn es gute empirische Gründe geben mag, daran zu zweifeln, dass diese Hoffnung realistisch ist -, es werde uns gelingen, ein besonderes Merkmal jedenfalls eines Gutteils der deutschen Städte bei allen Warnsignalen auch aus vielen europäischen Städten zu bewahren: nämlich dass diese Stadtgesellschaften insgesamt relativ zivil verfasst sind. Sicher, ich könnte auch von meiner Heimatstadt München diesbezüglich Abstriche machen von dem schönen Bild, das hier gezeichnet wurde. Aber ich denke, in den meisten Städten Europas, auch Millionenstädten, kann man nach Einbruch der Dunkelheit noch ziemlich ohne Bedenken auf die Straße gehen. Deutschland weist in diesem Zusammenhang international sehr gute Daten auf. Es ist doch eine interessante Frage, womit dies zusammenhängt, es ist ja nicht so, dass wir keine sozialen Probleme hätten. Meine These lautet: Es liegt an der im Kern europäischen Idee der Stadt, und diese Idee sollten wir bewahren gegen globale Trends. Diese Idee besteht darin, dass es eine gemeinsame Öffentlichkeit und eine gemeinsame Verantwortung gibt; dass es eine in der Stadt organisierte Solidarität geben sollte, die Ausgrenzungen entgegentritt oder diese jedenfalls möglichst gering zu halten versucht; dass die Menschen einen politischen Gestaltungsanspruch gegenüber der Stadt haben; und schließlich dass nicht Investoren alleine über die Zukunftsentwicklung der Stadt entscheiden. Nur in diesem Rahmen lässt sich eine zivile Stadtkultur bewahren.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Bei dem Wandel geht es immer auch darum, wie das europäische Modell des Sozialstaates bewahrt werden kann. Es herrscht ziemlich Einvernehmen darüber, dass dieses Modell nur durch Veränderungen bewahrt werden kann. In ähnlichem Sinne gilt das für die Stadtpolitik oder für die Städte als soziales Phänomen, als Siedlungsraum, als öffentlichen Raum. Es gibt einen Unterschied zwischen Städten in den hoch entwickelten Staaten, vor allem den Vereinigten Staaten, auch den boomenden Schwellenländern einerseits und Europa andererseits. Der Unterschied ist am deutlichsten zu machen bei einem Vergleich der Lebensbedingungen von Menschen mit niedrigem Einkommen dort und Menschen mit niedrigem Einkommen hier. Dabei meine ich noch nicht einmal die Abhängigkeit von Sozialleistungen - Letztere gibt es dort gar nicht, die gibt es nur in Europa. Wer hier ein niedriges Einkommen hat, ist natürlich, wie überall, nicht zu beneiden um die Art der Lebensführung, zu der er gezwungen ist. Aber er kann sich in den Städten mit einem öffentlichen Verkehrsmittelsystem bewegen, er hat ein öffentliches Schul- und - wenn es eine einigermaßen gut organisierte Stadt ist - auch ein öffentliches Kinderbetreuungssystem. All dies hat er, mit Ausnahme einiger weniger Städte, in Amerika nicht, das heißt, er muss sich sein Fortbewegen zu seinem Arbeitsplatz, zu seinen Billigjobs auch noch mit einem Auto selbst finanzieren. Bei uns muss man kein Auto haben. Das ist eigentlich eine sehr triviale Feststellung, ein sehr trivialer Vergleich, aber ich bin darauf gestoßen worden in einem überhaupt nicht trivialen, sondern sehr klugen Buch eines englischen Autors, das jetzt gerade auf den Markt kommt: Will Hutton, "The world we are in", eine Fortsetzung seines früheren Buches "The state we are in", in dem er Amerika und Europa vergleicht. Der Autor kommt bei allen Nachteilen und Klagen, die wir haben, z.B. die Unbeweglichkeit unserer Gesellschaft, den Reformstau und Reformbedarf betreffend, zu dem Schluss, dass wir im Prinzip das richtige Modell haben, wenn es darum geht, größtmögliche Zufriedenheit und größtmögliche Lebenschancen für die Bürgerinnen und Bürger herzustellen. Die Frage, wie wir mit den Städten umgehen, ist eine der Kernfragen der Politik im 21. Jahrhundert, weil sie im nächsten Schritt zu der Frage führt, wie es überhaupt mit unserer Demokratie weitergeht.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Dies ist ein ganz wichtiger Ansatz, Herr Dr. Perger. Gehen wir einmal zurück auf den schönen alten Begriff der Polis, Stadt als Zentrifuge, aber auch als Leuchtturm politischer Signale. Nutzt Stadt heute noch im Sinne der nationalen Demokratie? Nutzt Stadt heute noch diese politische Urkraft, die sie einmal hatte, oder versandet das im Brei der Zuständigkeiten der Stadträte?
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
In meinen Augen zerfällt dieses Potenzial schon deswegen, weil wir Regionen haben, in denen die Bürgerinnen und Bürger sich gar nicht an Kommunalwahlen beteiligen, sei es, dass sie keine Deutschen sind, sei es, dass sie keine Hoffnung haben, dass sich irgendetwas ändert. Und Regionen, die sich an Wahlen nicht beteiligen, werden von den Politikern auch gerne missachtet. Hier liegt eine Riesengefahr. Deshalb heißt "Polis aktiv erhalten" für mich, den Bürgerinnen und Bürgern erst einmal deutlich zu machen, dass die Menschen in den Stadträten für sie relevant sind; dass ein Dialog stattfinden muss; dass Politik in Auseinandersetzung mit den Menschen, die in den Stadträten sitzen, mit Bezirksräten, kommunalen Verantwortlichen, Bürgermeistern und anderen stattfinden muss. Der Dialog stirbt immer mehr ab, wenn wir es nicht schaffen, alle Einwanderer zu Deutschen zu machen, wenn wir sie nicht zu Bürgern machen, sondern lediglich als Gäste in unserem Land behandeln. Das Zuwanderungsgesetz, das gerade debattiert wird, ist dringend nötig für die Städte, damit Perspektiven und Strukturen wachsen können für aktive kommunale Demokratie. Daran mangelt es im Augenblick, wir haben Städte und Regionen, in denen weniger als 30 Prozent der Bevölkerung wählen. Das darf uns nicht kalt lassen.
Ich will ein Zweites ergänzen. Wir müssen die Stadträte attraktiv machen für kompetente Leute. Gegenwärtig haben die Stadträte zu wenig Kompetenzen, die wirklich spannend sind. Ich würde die Schulen vom Gängelband der Kultusbürokratien befreien und alle zu kommunalen Schulen machen, damit die Stadträte ein Gebiet haben, über das sie reden können, mit kommunaler Aufsicht über die Schulen. Jede Schule hätte einen Aufsichtsrat, und die Schulleitung hätte natürlich Personalhoheit über alle Menschen, die sie anstellt und die sie feuert. Es muss beides sein. Mit Blick auf die PISA-Studie müssen wir fragen: Warum sind denn die Finnen so gut? Weil dort die Leitung der Schule heuern und feuern kann. Beides muss in den Händen von Direktoren und ihren Mitverantwortlichen in der Schulleitung liegen, diese müssen kommunal beaufsichtigt werden, und die Stadträte müssen kommunal verantwortlich sein. Derzeit ist vieles zu weit oben angesiedelt, müsste dichter an die Menschen herangeführt werden, damit ein Gefühl für Verantwortung entsteht. Ich würde die Städte dicht an die Menschen "heranbringen".
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Von der Zielrichtung her sehe ich das ganz ähnlich wie Sie. Die Kommunen sind nahe an der Zivilgesellschaft dran, näher als die Länder und erst recht als der Bund. Und deswegen - manche werden sich wundern, dass ich das sage - bin ich der Auffassung, dass natürlich auch die Gestaltung der Stadtkultur in der Stadt stattfinden soll und nirgendwo sonst. Das heißt, wir müssen auf Länderebene und auf Bundesebene darauf achten, dass die Rahmenbedingungen stimmen und die Finanzströme richtig verteilt werden. Wenn die Kommunen nicht ihre Verantwortung wahrnehmen - die ja offiziell nur eine freiwillige Aufgabe ist -, nämlich die kulturelle Infrastruktur zu schaffen, dann wäre das, was gegenwärtig den Reichtum der Städte ausmacht, aufs höchste bedroht. Hier müssen wir in der Tat etwas ändern.
Ich will zum Stichwort Bildung allerdings eine kritische Anmerkung machen. Wir müssen aufpassen, dass nicht passiert, was man unter anderem in den USA, wo ich mal ein Jahr gelebt habe, beobachten kann: dass Schulen in guten Vierteln mit dem ganzen Engagement der Eltern, mit den school-families, die dort entstehen, in guter Verfassung sind, während Schulen in Problemvierteln sich auch weitgehend selbst überlassen bleiben, sodass der Wohnort am Ende über die Lebenschancen noch mehr entscheidet, als er es ohnehin tut. Man braucht beides, mehr Eigenverantwortung an den Schulen und in den Kommunen, aber auch gleiche Standards und gleiche Ausstattung in der ganzen Bundesrepublik.
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Deswegen meine ich, die Leistungsstandards müssen von der Kultusbürokratie normiert und überprüft werden. Es ist ihre wichtige Funktion, die Gleichheit zu wahren, darüber Aufsicht zu führen. Aber an die Stadträte muss ohne Zweifel mehr Verantwortung gehen.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Neben den Schulen ist sicherlich auch das Thema Multikultur sehr wichtig. Es ist richtig, dass die Beschäftigung damit in den Städten stattfinden muss, dass die Initiativen dazu aus den Städten kommen müssen und dass das Modell der Stiftung, das Sie, Herr Pfeiffer, so leidenschaftlich vorgetragen haben, dabei eine große Hilfe ist. Und trotzdem: es war ja kein Zufall, dass einer der Redner heute Morgen der Bundeskanzler war. Es kommt dabei auch sehr auf die so genannte große Politik an, es kommt darauf an, dass die Politik, die politische Klasse, auch die Meinungsführer in der Wirtschaft, den Verbänden, den Medien, auch die Wahrheit sagen - so, wie Herr Pfeiffer das mit seinen Erfahrungen, Umfrageergebnissen und seinen Diskussionen aus der Moschee gemacht hat. Es kommt darauf an, dass man sich nichts vormacht und vor allem die Brisanz des Themas nicht verschweigt, denn sonst passiert, was wir in mehreren europäischen Demokratien jetzt beobachtet haben: dass andere die Themen besetzen, die die Menschen wirklich beschäftigen und die sie nicht bei den etablierten Parteien vorfinden. Dann gewinnen plötzlich Gestalten wie Haider, Bossi, der ermordete Pim Fortuyn, Le Pen und Schill Einfluss. Man muss sich einmal vorstellen, wozu es führt, ein solches Thema lange zu tabuisieren, wie es in Hamburg, wie es in Holland der Fall war: In Rotterdam bedeutete es das Ende der sozusagen Jahrhunderte langen sozialdemokratischen Alleinherrschaft. Umgekehrt gelingt es da, wo die Debatte - wie beispielsweise in Wien - auch innerhalb der etablierten Parteien relativ offen geführt wird, die Rechtspopulisten einzudämmen. In manchen Fällen hilft es einfach, die Wahrheit zu sagen, das Problem zu benennen und dann auch zu sagen: Wir haben dafür keine idealen Lösungen, aber dies und das schlagen wir vor.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Prof. Friedmann, Sie arbeiten neben anderem viele Jahre schon an der Theorie, dass eine Stadt als Mikrokosmos von Gesellschaft die Bedürfnisse der Menschen an der Basis - "human needs" - erkennen muss, um unter anderem jene Verhältnisse zu verhindern, die Sie gerade sehr aktuell geschildert haben. Sind unsere modernen europäischen Städte dazu in der Lage? Erkennen wir in unseren Stadtstrukturen menschliche Grundbedürfnisse?
|
 Prof. Dr. John Friedmann Prof. Dr. John Friedmann
Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage direkt beantworten kann. Aber ich möchte ein Problem aufwerfen, das die politische Beteiligung angeht, nämlich die Größenskala des Städtischen. Ich habe z.B. gestern hier in Berlin im Kreuzberger Zentrum eine Grundschule besucht, die mich sehr beeindruckt hat. Am meisten beeindruckt hat mich, dass sich die Leute alle kannten, dass das ganze Zentrum eigentlich wie ein Dorf gestaltet war und die Bewohner sich gegenseitig unterstützten. Nicht nur an der Schule, sondern im ganzen Zentrum herrschte eine gute Atmosphäre. Dies hängt, meine ich, zum großen Teil damit zusammen, dass wir es hier mit der Skala Dorf zu tun haben, Dorf natürlich innerhalb des Städtischen, denn Kreuzberg ist ja auch städtisches Zentrum. Dahin kommen Leute aus allen Stadtteilen und von dort aus gehen sie quasi strahlenförmig wieder hinaus. Also es handelt sich hier um eine Art Kleinstadt innerhalb der Großstadt. Dort fühlt man auch direkt die Beteiligung der Mitbürger. Wenn man aber von Berlin als Großstadt spricht oder an eine noch größere Skala denkt, etwa die von Berlin-Brandenburg, ist das natürlich etwas ganz anderes. Die Menschen kennen sich dann nicht mehr, sie kennen nur ihr eigenes Viertel. Genau das ist es, was mir so imponiert hat an dem Begriff und dem Projekt Soziale Stadt: es ist kleinräumig, "kleingebietisch" gedacht - Sie haben derzeit 249 solcher Quartiermanagement-Zentren. Das bringt auch das Politische hinein, ebenso wie die Mitarbeit der lokalen Bürgerinnen und Bürger. Irgendwie müssen wir eine Modalität finden, um Groß und Klein zusammenzufassen.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Damit geben Sie das entscheidende Stichwort und schlagen einen Bogen zu einem der großen Begriffe dieses Kongresses, Zusammenhalt. Zusammenhalt in Städten, ist das ein Mythos? Gibt es Zusammenhalt eben nicht doch nur in "Dörfern" wie Kreuzberg?
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Bedarf da ist und dass die Menschen neue Formen der Kooperation und der Partizipation entwickeln. Dies lässt sich an vielen Beispielen zeigen, etwa den "Tafeln", die überall als eine Form der Bürgerbeteiligung entstanden sind und Essen, Lebensmittel aus Restaurants und Supermärkten an Bedürftige verteilen, oder nehmen Sie die Spendenparlamente. Hamburg hat etwas ganz Eindrucksvolles auf die Beine gestellt.
Ein weiteres Beispiel ist die erwähnte Bürgerstiftung. Wir haben zu viert in einem Wohnzimmer angefangen. Ich habe gesagt: Jeder bringt einen mit, dann sind wir acht. Das hat geklappt. Dann waren wir 16, bald 32, haben gegründet. Unser Vorbild dabei ist das britische Newcastle. Was in dieser Stadt auf die Beine gestellt wurde, ist faszinierend. Dort wurde mit 150 000 Pfund vor 14 Jahren angefangen, und heute sind auf den Konten der Bürgerstiftung etwa 30 Millionen Pfund, also etwa 90 Millionen D-Mark. Dort ist es in einem ungeheuren Maße gelungen, Bürger zu Aktivbürgern zu machen, die zu vielen Projekten Teilfinanzierungen leisten, der Rest kommt dann immer von der Stadt, dem Bezirk, von anderen Kräften. Alleine sollte man das nie machen, immer andere mit "ins Boot holen". Es ist ungeheuer ermutigend, zu sehen, wie Bürgerinnen und Bürger nach neuen Formen der Bürgerbeteiligung gieren, weil sie mit den alten - in den Parteien beispielsweise - nicht mehr zufrieden sind. Da hilft es nichts zu jammern: Die jungen Menschen gehen nicht mehr so sehr in die Parteien. Aber in Strukturen, in denen sich Sachkompetenz bündelt und dieses Gefühl vorhanden ist, mit dem eigenen Geld eine Chance zu eröffnen, Dinge zu realisieren, da wächst das Bürgerengagement. Angesichts von jetzt schon über 40 Bürgerstiftungen in Deutschland bin ich optimistisch, dass dies wirklich eine Partnerschaft der Zukunft werden könnte - nicht nur im finanziellen Sektor. Denn die Menschen wissen, wenn wir uns alle nur emsig um uns selbst im Kreise drehen, "denen da oben" die Politik überlassen und sagen, für die Probleme sind Sozialarbeit und Polizei zuständig, dann "läuft es" nicht mehr.
Es hängt entscheidend davon ab, dass die jungen Heranwachsenden der Zivilgesellschaft tolle Projekte initiieren, die den Bürgern sofort deutlich machen: die haben das Problem erkannt, die machen das Richtige. Dies ist in einigen Städten wunderbar gelungen, etwa Konfliktlotsen ausbilden oder einen Jugendpreis stiften gegen den Strom oder einen Zirkus für behinderte Kinder an Schulen organisieren. In Dortmund läuft das ganz großartig. Wir müssen das nur vernünftig organisieren und eine gute Partnerschaft mit der Stadt auf der Basis der Stadtteile hinbekommen. Dabei sind mir übrigens die amerikanischen Städte Vorbild. Die Community Foundation in New York verfügt heute über 1,5 Milliarden Dollar und hat vor 70 Jahren auch einmal mit 150 000 Dollar angefangen.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Als Begriff halte ich den Zusammenhalt für die zentrale Kategorie der Demokratie und vor allem dessen, was ich in Anlehnung an die Debatte gerne das europäische Modell nenne. Zusammenhalt ist allerdings ein sehr schillernder Begriff. Zunächst stimmt die Vorstellung, dass man Zusammenhalt vor allem in der dörflichen Gemeinschaft findet, in kleinen Gruppen, in einem kleinen Dorf wie Lech im alpinen Österreich, einem schönen Ort. Ich nenne Lech deshalb, weil es ein Buch über Lech gibt, sehr schön, auch optisch sehr anspruchsvoll, von einem österreichischen Schriftsteller, Michael Köhlmeier, zusammen mit dem Fotografen Konrad Müller, der einigen bekannt sein dürfte. Es handelt sich um ein unheimliches Buch. Es beschreibt die dörfliche Gemeinschaft in ihrer Intensität. Das Buch ist sehr unbeliebt in Lech, wird in den dortigen Geschäften nicht verkauft. Wenn man es genau liest, stoßen einem die ganzen Hassstrukturen, Neidstrukturen, die Enge, die so ein Dorf wie auch die Familien dort prägen, doch unangenehm auf. Das ist die Kehrseite des Dorfes, das natürlich einen Zusammenhalt hat: Wir Lecher gegen die St. Antoner und wie die Dörfer in der Gegend alle heißen. Das ist nicht jener Zusammenhalt, den ich an den Städten spannend finde: Da gibt es den Zusammenhalt in einem Viertel, natürlich. Man trifft sich in der Kneipe, auf der Straße, in der Bürgerversammlung. Aber das ist dann schon ein etwas abstrakterer Zusammenhalt, ohne die emotionalen Verwerfungen, die man in dörflichen Strukturen häufig vorfindet, weil da die Nachteile der Nähe spürbar werden.
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Darf ich etwas fragen? Sollten wir den Zusammenhalt fördern in dem Sinne, dass wir ethnische Segregation fördern etwa nach dem Motto: wir fühlen einen Zusammenhalt in Kreuzberg?
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Nein, ich dachte bei Kreuzberg nicht an die Türken, sondern eher an die Szene, die sich mischt mit den Türken und die zumindest glaubt, dass es in Kreuzberg einen multikulturellen Zusammenhalt gibt - Letzterem traue ich ja nicht so ganz. Aber nein, ich meine den abstrakteren Zusammenhalt, der einem die Gewissheit gibt: hier bin ich zu Hause, hier wird mir geholfen, wenn ich ein Problem habe, nicht nur vom Nachbarn, sondern auch von dem System.
Ich möchte noch ein wenig weiter ausholen und zu einem Thema kommen, das uns auch in der großen politischen Auseinandersetzung dieses Jahres, dem Bundestagswahlkampf, beschäftigt, der zwar kein Kommunalwahlkampf ist, aber dennoch in den Städten entschieden wird.
In einer Untersuchung des Sozialforschers Ulrich Becker wurden repräsentativ zusammengesetzte Fokusgruppen ziemlich umfangreich in intensiven Interviews über den Wandel in unserer Zeit und ihre Hoffnungen und Befürchtungen befragt. Interessanterweise kam heraus, dass der Verlust des Zusammenhalts aufgrund der Globalisierung und aufgrund der Beschleunigung der Veränderungen die Sorge ist, die sowohl die potenziellen Gewinner wie die Verlierer des Wandels gemeinsam haben - aus unterschiedlichen Motiven. Natürlich haben die Verlierer alles zu verlieren, so zum Beispiel die Zukunft ihrer Kinder, wenn sie sich die Bildung nicht mehr leisten können, weil alles privatisiert wird und künftig das Studium zu teuer wird. Die Gewinner haben aber auch etwas zu verlieren, nämlich Lebensqualität. In Europa ist es noch nicht so weit, dass man es selbstverständlich findet, in einer Gated Community zu leben, wie man sie in Amerika und vor allem in den reichen Vierteln Südamerikas findet, mit bewaffneten Wächtern an der Einfahrt zu einer umzäunten Villengegend. Das ist auch ein Verlust an Qualität. Es ist zwar absurd, dass sich die beiden Gruppen in dieser Sorge treffen. Und trotzdem sind sie sich einig darin, den Zusammenhalt, der solche Erscheinungen verhindert, behalten zu wollen, weil sie spüren: wenn der verloren geht, verlieren wir alle auch an Demokratie.
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Die Differenzierungen, die Sie jetzt begonnen haben, sind ganz wichtig. Wenn ich es einmal ganz abstrakt sagen darf, muss man zwischen drei Idealtypen unterscheiden.
Erstens gibt es die kulturell verfasste Gemeinschaft, die unter anderem dadurch gestiftet wird, dass die Menschen gemeinsame Werte, gemeinsame Lebensformen, vielleicht eine gemeinsame Geschichte, eventuell sogar familiäre Verbindungen wie in kleinen Dörfern, in denen ja jeder irgendwie mit jedem verwandt ist, aufweisen.
Zweitens gibt es die Bürgerschaft in dem Sinne, dass man sich mitverantwortlich fühlt für die politische Angelegenheiten, nennen wir es ruhig: für die politische Gemeinschaft, und dass man bereit ist, mit anderen zu kooperieren. Diese darf aber nicht verwechselt werden mit der alten Art von Gemeinschaft, in der Bürgerinnen und Bürger ihre Autonomie, ihre eigene Lebensform, ihre Differenz, auch die kulturelle Differenz zum Opfer bringen müssen. Bürgerschaft, wohlverstandene moderne Bürgerschaft, muss vereinbar sein mit einem breiten Spektrum von Wertorientierungen, Weltanschauungen, Lebensformen - das ist die große Herausforderung auch für die moderne Stadt.
Die dritte Form - wenn man so will - der Gesellung findet im Markt statt. Hier treffen Bürger, die auf dem Markt Güter nachfragen, auf Unternehmer, die Güter anbieten. Was wir gegenwärtig in den Städten erleben, ist nun - etwas dramatisiert gesprochen - eine Art Zangenbewegung, nämlich dass die erste und die dritte Form überhand nehmen. Wir haben also einerseits immer mehr Privatisierung der öffentlichen Räume, immer weniger Öffentlichkeit, die nicht kommerziell besetzt, nicht von individuellen ökonomischen Interessen geprägt ist. Andererseits haben wir den Rückzug aus der immer unübersichtlicheren modernen Stadt auf die Gemeinschaft, auf das fast Dörfliche, das Sich-zu-Hause-Fühlen in möglichst kulturell homogenen Gruppen. Es ist auch eine Herausforderung an die Kulturpolitik der Städte, eben nicht primär Letzteres zu fördern, sondern eher das Bürgerschaftliche, das, was Differenz aushält, was modern ist, was mit der modernen Stadt und ihren Herausforderungen kompatibel ist.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Ich erlaube mir einen kritischen Zwischenruf. Wir fordern sicher zu Recht, wenn wir auf die Zukunft schauen, die solidarische Staatsgemeinschaft ein. Jetzt könnte ich bösartig sagen, dies sei ein Romantizismus, eine Verklärung am Reißbrett, eine Vision.
Mit Blick auf den 11. September und auch auf die aktuellen Ereignisse in Erfurt frage ich Sie ganz kritisch: Zusammenhalt, wann schreien wir nach Zusammenhalt? Wann wird uns bewusst, dass wir Zusammenhalt brauchen, um zu überleben? Doch eigentlich immer nur in Zeiten radikaler Bedrohung. Ist das zu überspitzt?
|
 Prof. Dr. John Friedmann Prof. Dr. John Friedmann
Der Bundeskanzler hat heute Morgen einen Ausdruck gebraucht, der mich sehr angesprochen hat: zwischenmenschliche Solidarität. Was mich beeindruckte, ist eben dieses Zwischenmenschliche, denn man kann solidarisch in verschiedenem Sinne sein, wie z.B. mit einer Ideologie oder selbst dem Patriotismus. Im Zusammenhang mit der Sozialen Stadt spricht man besser von Zusammenhalten. Zusammenhalten ist nicht dasselbe wie Solidarität. Um auf das Zwischenmenschliche zurückzukommen: Das Zwischenmenschliche ist das Prinzip des Dialogs, es ist das Prinzip der gemeinsamen Arbeit, des Mitarbeitens an einer Sache. Das Zwischenmenschliche bringt eine gewisse reziprokale Solidarität mit sich. Und in diesem Zusammenhang komme ich auch auf das Thema der Größenskala zurück. Das Zwischenmenschliche bringt z.B. im Kreuzberger Zentrum die Leute an einer gemeinsamen Sache zusammen. Dabei lernen sie sich gegenseitig kennen, auch in ihren Differenzen, in ihren Verschiedenheiten. Und das tolerieren sie, weil sie sich an einem gemeinsamen Werk beteiligen. Ich möchte auf die Frage zurückkommen, wie man die Stadt so strukturieren kann, dass das Zwischenmenschliche gestärkt wird, dass wir uns gegenseitig ansprechen, nicht gegeneinander sprechen oder aneinander vorbei sprechen.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Der Zusammenhalt oder das Gefühl des Zusammengehörens, das sich aus dem Schock nährt, ist natürlich noch nicht jene politische Kategorie, die Herr Nida-Rümelin eben so plastisch beschrieben hat. Wir haben ja das Beispiel des 11. September. New York ist nun wirklich eine Gesellschaft der vielen kleinen Zusammenhalte und Gesellschaften, alle sind "proud to be a New Yorker", aber sie bilden keine Kommune im eigentlichen Sinn. Wer im Süden von Manhattan wohnt, geht nie nach Midtown. Nach dem 11. September gab es natürlich ein Gemeinschaftsgefühl. Ich war vor kurzem da. In den Gesprächen, die ich dort hatte, wurde immer wieder betont, dass das wieder aufhört; man guckt wieder aneinander vorbei, man rennt aneinander vorbei, man schubst sich weg und hat es wieder eilig. Die Familien halten jetzt vielleicht mehr zusammen, als sie es vorher getan haben, aber das wird nicht vorhalten. Ich fürchte, das wird auch in Erfurt nicht anders sein.
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Es gibt bei den beiden Schocks einen entscheidenden Unterschied. Am 11. September kam das "Böse" von außen. Man hat sich dann in Solidarität, in Hilfsbereitschaft zusammengeschlossen, um diesen Schock zu verdauen. Bei uns in Erfurt kommt das "Böse" von innen. Man wird gewahr, dass die Schule ihre Funktion, Krisen frühzeitig zu erkennen, gar nicht gerecht geworden ist, dass sie hilflos war, das Richtige in den Phasen vorher zu tun. Und man wird gewahr, dass wir da in unserem Land mehr tun müssen. Wenn daraus mehr werden soll als Trauerarbeit und die Artikulation von Betroffenheit, wie es in den letzten zehn Tagen der Fall war, dann wäre das wirklich toll. Wir müssen die Chance ergreifen und die Schulen so stärken, dass sie diese Aufgabe erfüllen können. Die Schulen sind darauf nicht vorbereitet. Sie sind Stätten der Wissensvermittlung, und neuerdings sollen sie auch noch soziales Lernen ermöglichen, aber sie wissen gar nicht so recht wie. Dabei gibt es durchaus Potenziale, die man an Schule "andocken" muss. Wir brauchen eine andere "Erziehungskompetenz" der Schule, die sie nicht aus sich heraus leisten kann, weil Mathematik- und Biologielehrer so etwas an der Uni oder sonst wo nicht gelernt haben. Daraus können wir viele Folgerungen ableiten, was geschehen sollte. Weiter: Wir müssen unsere Kindergärten zu Orten machen, an denen, wie in Australien, Elternschulen stattfinden, Elternschulen, spannend aufgezogen mit Filmen, die Spaß machen, mit Dialogen über ganz konkrete Alltagsprobleme mit Kindern, die über ein Elternjahr fortgesetzt werden. Und welchen Zeitpunkt nimmt man in Australien? Wenn die Kinder drei Jahre alt sind, weil da die Eltern am meisten Fragen stellen; dann hat man sie "im Boot" und kann mit ihnen reden.
Schulen brauchen Früherkennungsstärkung. Und wie macht man das in Schweden? Dort wird ein ganz anderes Modell praktiziert: die Jugendhilfe, der schwedische Kinderschutzbund RÄTTA BARNEN, stellt sich einmal im Jahr in jeder Schule vor und macht den Kindern bewusst: Wenn ihr Probleme zu Hause habt, Lieblosigkeit, zerfallende Familienstrukturen oder Gewalt: wir sind für euch da, und eines müsst ihr wissen, wenn ihr zu uns kommt, reden wir garantiert mit niemandem darüber, es sei denn, ihr erlaubt uns das. In Deutschland finden nur fünf Prozent der misshandelten Kinder den Weg zum Kinderschutzbund, kam bei einer großen Befragung heraus. Warum? Weil die Kinder Angst haben, dass sofort ihre Eltern verständigt werden, wenn sie zum Jugendamt gehen. Was wir grundsätzlich falsch machen: wir beantworten die Probleme nicht so, dass der Adressat merkt, dass er Subjekt des Geschehens und nicht Objekt von Hilfsbereitschaft ist. Nötig ist also eine Verzahnung von Schule und Jugendhilfe, von Schule mit anderen Kräften, die außen sind und die Schule dabei stärken können, diesen erweiterten Erziehungsauftrag wahrzunehmen. Und Eltern brauchen Unterstützung, wenn sie alleine nicht klar kommen.
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Wir sollten vielleicht die Diskussion stärker mit dem Thema Stadt in Verbindung bringen. Es gibt Verbindungslinien, nicht nur die kommunale Verantwortung für Schulen. Zunächst ist es wichtig, dass Erfurt aufrüttelt und die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenkt. Typisch für Gewaltakte dieser Art, für Amokläufe - die übrigens bislang nur in den USA vorkamen, man muss sich auch überlegen, woran das liegt - ist, dass sie als Startpunkt nicht das Verbrechen haben, sondern erst einmal die Verzweiflung und den Entschluss, sich selbst umzubringen. Am Beginn steht die Selbsttötungsabsicht, dann kommt eine - davon bin ich überzeugt - durch Medien angeleitete Orientierung an bestimmten Modellen, wie man aus dieser Welt "abtritt". Das war bei Goethes Werther mit einem großen Anstieg der Selbstmordquote so. Das ist bei diesem japanischen Dichter so, der jedes Jahr immer noch viele Liebespaare animiert, den Liebestod zu sterben, und in diesen Zusammenhang gehören eben auch und vor allem Brutalisierungen in den Medien, Computerspiele usw. Aber erst einmal muss man sich überlegen, wie es denn kommt, dass wir gerade in diesem Alter eine so hohe Selbstmordrate bei den Jungen haben, etwa dreimal so hoch bei den Jungen wie bei den Mädchen. Um welche Verzweiflungen geht es da? Welche Rolle spielen Vereinzelung, Vereinsamung und Rückzug aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang?
Ich weiß nicht, wie das in Erfurt war. Aber in meinen Augen gibt es einen engen Zusammenhang zum Fehlen von Orten der Begegnung. Übrigens ist auch Schule ein Begegnungsort. Das Thema Ganztagsschule hat auch eine tiefe soziale und kulturelle Bedeutung. Es fehlt einfach an Orten der Begegnung in der Stadt, in dem Stadtviertel, um die Ecke. Wenn wir zulassen, dass die Freizeitangebote immer stärker kommerzialisiert und immer stärker konzentriert werden an bestimmten Orten wie etwa Multiplexkinos oder dem Fußballstadion draußen auf der grünen Wiese - und eben nicht mehr hier gleich um die Ecke -, dann wird es für Jugendliche schwer, ein soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten und dann befördern wir einen Prozess der Vereinzelung und vor dem Hintergrund der medialen Verrohung auch einen Prozess stärkerer Gewalttätigkeit.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Dieses Podium ventiliert die drei Begriffe "Zusammenhalt", "Sicherheit", "Zukunft" vor dem Hintergrund "Wandel in unserer Gesellschaft". Wandel eben in unserer Gesellschaft - dazu gehört natürlich auch die sehr aktuelle Zäsur, diese schmerzliche Zäsur durch das Ereignis in Erfurt, die wir hier auch mit der Stoßrichtung Stadt behandelt haben. Um das Fazit zu ziehen: Einen solch singulären, eruptiven Anfall von fürchterlicher tödlicher Gewalt kann man sicher nicht kausal an das Prinzip Stadt binden. Ich denke, soweit sind wir uns hier zu diesem Falle doch einig.
Ich möchte Sie einmal sehr banal fragen: Leben wir oder wohnen wir eigentlich in Städten? Sie, ganz persönlich, leben oder wohnen Sie in einer Stadt, Herr Perger?
|
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Ich wohne in Hamburg und gehe von da aus auf Reisen. Meine Stadterfahrung findet meistens anderswo statt. Aber ich bin ein Stadtkind, bin in Wien aufgewachsen und weiß, was eine große Stadt ist. Wien ist anders, natürlich, und das ist gut so. Aber Wien ist eine Stadt, wirklich.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Herr Professor Nida-Rümelin, jetzt sind Sie ein Weiß-Blauer im besten Sinne. Sie sind, glaube ich, auch in München geboren, haben dort ein humanistisches Studium absolviert. Jetzt hat Sie die politische Karriere nach Berlin verschlagen. Wo leben Sie, wo wohnen Sie?
|
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Ich lebe jetzt in Berlin und bin nur noch sehr selten in München, weil sich das mit den Terminen nicht vereinbaren lässt. Das Merkwürdige bei bestimmten politischen Ämtern ist: man verliert weitgehend die Möglichkeit, am kulturellen Leben einer Stadt teilzunehmen, und das ist ein Verlust an Lebensqualität. Es ist paradox: man ist zuständig für Kulturpolitik, aber hat nicht mehr die Zeit, seinen kulturellen Interessen nachzugehen. Ich weiß auch nicht, ob das der Politik so gut tut. Obwohl ich jetzt bald anderthalb Jahre in Berlin lebe, habe ich den Eindruck, dass meine Frau, die seit der gleichen Zeit in Berlin wohnt, viel eher hier lebt als ich, weil ich doch im Wesentlichen nur zwischen Büro und Wohnung hin und her fahre und relativ wenig vom alltäglichen Leben mitbekomme.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Mal von dieser sehr individuellen Bindung abgesehen, was müssen wir denn erreichen, wenn wir den Wert "Stadt" ansprechen, der ja als Ferment extrem wichtig ist für unser Verständnis von Lebensgefühl? Was müssen Bürgerinnen und Bürger denn empfinden, damit sie in der Stadt wohnen und leben wollen?
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Für mich ist das Leben in der Stadt richtig lebendig geworden über meine beiden relativ jungen Kinder. Das ist der Schlüssel, man merkt, hier braucht es Lebensqualität. Wenn ich an die Pfadfindergruppe meines Sohnes denke - zu sechst haben sie angefangen, jetzt sind sie 70 Jugendliche und Kinder in dieser Organisation -, was die an Leben gestalten! Oder wenn ich an die Sportvernetzungen denke, an meine eigene Vernetzung in die Bürgerstiftung, die ganz stark von Jugendprojekten lebt. Lebensqualität ist die Vernetzung mit Bürgern, mit denen man gemeinsame Interessen hat, Lebensqualität ist, dass Dinge sich ändern, dass sie gut werden, dass sie in Nachbarschaft mit anderen gestaltet werden. Freilich, ein Leben ohne Kinder wäre arm, da hätte ich dann diese ganzen Vernetzungen gar nicht so erfahren und vielleicht auch nicht den Bedarf gesehen, mich einzumischen. Ich kann nur jedem diese Erfahrungen wünschen, weil sie gewahr machen, wie sehr die junge Generation auf Spielräume nachmittags angewiesen ist. Und dann bleibt das nichts Leeres, über das man halt so redet; man merkt vielmehr: das Jugendzentrum ist ja miserabel, da stehen nur eine wacklige Tischtennisplatte, ein altes Flippergerät und ein langweiliger Sozialarbeiter rum, na ja, da rührt sich nix.
Dann gründet man eine Bürgerinitiative, damit sich das ändert. Und auf einmal entsteht über diesen Bedarf, den Kinder artikulieren, Leben. Für mich sind Kinder die Chance, reinzuwachsen, zu erfahren, dass das mehr ist, als nur zu wohnen und Gast zu sein in einem Stadtteil, von dem man hofft, dass er einigermaßen sicher ist.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Wir entschuldigen uns vorab bei allen Sozialarbeitern.
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Der kann ja toll sein, ich muss das ergänzen. Ich habe wunderbare Sozialarbeiter erlebt. Aber wir haben doch die Jugendlichen - das ist jetzt auch Forschungserfahrung - gefragt, wenn sie eine Bande waren: Wo habt ihr euch denn kennen gelernt? Uns hat richtig entsetzt, wie viele sich in solchen Jugendzentren kennen gelernt haben und dass diese Zentren manchmal regelrecht Brutstätten der Jugendgewalt sind und eben nicht Prävention. Dann haben wir unterschieden und festgestellt, es gibt wunderbare Prävention in der Jugendarbeit, aber da muss dann mehr laufen, als das Karikaturbild, das ich eben gezeichnet habe. Es gibt sie, die Sozialarbeiter, die ein Sportgeschäft "ins Boot" holen und sagen: ihr verdient doch euer Geld mit den Jugendlichen, nun stellt hier mal ein paar Inliner zur Verfügung für die, die es nicht finanzieren können. Dann tun die das. Auf einmal wird eine Vernetzung von Sportverein und Jugendzentrum geschaffen, dann wird es lebendig, dann mischt es sich dort. Es sind nicht nur bestimmte Randgruppen, die das dann usurpieren. Es hängt sehr an tollen, motivierten Sozialarbeitern. Aus meiner Sicht ist ganz entscheidend, dass die Bürger sich einmischen und nicht sagen, das ist Sache der Polizei, der Sozialarbeit, mit denen klar zu kommen. Die Bürger müssen selber in die Jugendzentren hineingehen und ihre Ideen einbringen!
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Partizipation auch hier wieder, Herr Perger.
|
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Es liegt eben auch sehr daran, dass wir der Politik auch in der sozialen Verantwortung ihren Platz geben. Natürlich, je besser die Zivilgesellschaften, die privaten Initiativen funktionieren, desto mehr Chancen hat die Politik und desto mehr Chancen hat eine Stadt. Was für ein Irrsinn war doch die Propaganda der letzten anderthalb Jahrzehnte, die besagte: der Staat muss sich zurückziehen, er greift viel zu viel in das Leben der Bürger ein. Ein berühmtes Argument gegen die Ganztagsbetreuung von Kindern in Schulen lautet: der Staat soll mehr Freiraum geben. Wenn es Freiraum ist, dass die Kinder verwahrlosen dürfen, dann kann ich darauf verzichten.
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Ich will gerne noch ein Beispiel anführen, das genau zu dem passt. Wir haben in München kulturelle Stadtteilzentren. Die "Philosophie" - in jeder Stadt gibt es eine eigene Philosophie, wie solche Kulturarbeit in den Stadtteilen gemacht werden sollte - war und ist, dass nicht die Stadt z.B. in einem Neubaugebiet eine bestimmte Räumlichkeit schafft, um ein Bürgerhaus einzurichten, sondern dass wir möglichst an Orten mit historischer Patina, die von den Bürgerinnen und Bürgern selbst angenommen, ja besetzt werden, anknüpfen. Oftmals ist es ja so, dass die Stadt zunächst nicht weiß, was sie mit einem Areal machen soll. Dann vergehen ein paar Jahre, und in der Zwischenzeit kommen Bürger, Jugendliche, Jugendkulturen, die sagen, diese Halle brauchen wir jetzt für unsere Zwecke. Aus solchen ganz unterschiedlichen lokalen Initiativen sind kleine kulturelle Stadtzentren entstanden. Es gab parallel dazu immer die sozialdemokratische, aus Skandinavien geliehene Idee, größere Bürgerhäuser, 30 Millionen Mark oder mehr schwer, zu bauen. Ich habe erstens vorgeschlagen bis auf eine Ausnahme keine Bürgerhäuser des skandinavischen Typs mehr in Angriff zu nehmen, weil sich die Stadt damit übernimmt und weil diese nicht die nötige Flexibilität haben, die tatsächlichen kulturellen Bedürfnisse decken zu können. Zweitens dürfen wir aber bei den kleinen dezentralen Lösungen nicht der Illusion anhängen, dass mit privaten Trägervereinen und bürgerschaftlichem Engagement alleine eine solche lebendige Stadtteilkultur auf Dauer stabil bleiben kann. Zwar ist die Bereitschaft, sich zu engagieren, in der Bevölkerung nicht zurückgegangen, sie hat, auch in Deutschland, eher zugenommen. Aber die Bereitschaft, sich auf Dauer mit einem Projekt - wie früher über Jahre und Jahrzehnte - zu identifizieren, ja zum Teil seines Lebensinhalts zu machen, ist dramatisch zurückgegangen. Das heißt, die Vorstellung, dass wir eine stabile, dauerhafte, nur auf bürgerschaftlichem Engagement beruhende Struktur auf diese Weise bekommen, ist illusorisch geworden. Deswegen bestand dann das "Programm" bei uns in einer Teilprofessionalisierung, klein, überschaubar, anknüpfend an dem, was vor Ort geschieht, aber mit städtischer Hilfe, z.B. der Einstellung eines Geschäftsführers., um dann dem bürgerschaftlichen Engagement erst das Rückgrat zu geben, an das es sich sozusagen angliedern kann.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Der Bundeskanzler betonte heute Morgen, das Recht auf Sicherheit sei ein Grundrecht. Herr Pfeiffer, ich möchte Sie in diesem Zusammenhang aufgrund Ihrer Profession fragen ob Sicherheit in Städten nicht ein Mythos ist. Haben wir Sicherheit nicht nur in den Speckgürteln?
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Es ist richtig, Sicherheit ist eine Geldfrage geworden. Wenn wir fragen, wer sind denn die Opfer - auch das haben wir systematisch untersucht -, dann ist das Risiko von Menschen, die in sozialen Randlagen unserer Städte wohnen, am höchsten, Opfer irgendwelcher Straftaten zu werden, die wirklich weh tun, also von Körperverletzungsdelikten, Raub, Einbruch. Die wohlhabenden Menschen haben absolut einbruchsichere Häuser und Fenster, brauchen wenig Angst zu haben, denn in ihren Gebieten passiert auch wenig. Auch die Drogenabhängigkeit ist primär bei den Armen verortet und hängt eng mit den Alkoholexzessen in solchen Gebieten zusammen. Wenn wir nach Frankreich blicken mit seinen banlieux, wird es noch viel kritischer. Dort leben die ethnischen Minderheiten in Vororten mit katastrophalen Zuständen, sodass schon mal in den Schulen das Militär gerufen wird, um die Sicherheit auf den Schulhöfen zu garantieren. So schlimm ist es bei uns nicht. Aber wir müssen schon aufpassen, dass die Sicherheit kein käufliches Gut wird.
Ich empfinde es als einen wirklichen Fortschritt in Deutschland, was sich über die so genannten kommunalen Präventionsräte in den letzten zehn Jahren auf kommunaler Ebene getan hat, z.B. Runde Tische, zu denen man alle einlädt, die sich in irgendeiner Weise beteiligen wollen. Die Kirchen mit ihrer Jugendarbeit sind wichtig, auch mit ihrer Randgruppenarbeit. Die Unternehmen sind wichtig, weil sie Geld mit einbringen können, und die Polizei ist natürlich wichtig, weil sie die Fieberkurve in Gestalt von Kriminalitätsmessungen genau kennt. In den USA ist es perfektioniert. Da gibt die Polizei monatlich Stadtkarten heraus, aus denen immer deutlich hervorgeht, wo die Opfer wohnen, wo die Täter wohnen, wo die Tatorte liegen. Anhand dieser Informationen weiß man genau, wo es brennt, wo man einschreiten muss, wo man die Kräfte bündeln und konzentrieren sollte. Aber ich möchte daran erinnern: Prävention ist keine Angelegenheit, die man allein den Profis übertragen darf. Wir müssen die Bürger mit "ins Boot" nehmen, nicht aus Angst, sondern weil sie Lebensqualität haben wollen. Und wir müssen uns Gedanken machen, was die Rahmenbedingungen von Courage sind, von Bürgern, die sich zivil engagieren. Auch da gibt es ja Biographieforschung, nicht nur zu Gewalt. Es wird hierzulande gerne übersehen, dass es auch einer Kultur der Anerkennung für das Richtige bedarf. Hier müssen wir noch sehr viel lernen in Deutschland, andere sind uns weit voraus, wenn es gilt, Menschen zu preisen und öffentlich zu ehren, die etwas Tolles machen.
Wir müssen uns in diesem Zusammenhang schließlich über die Krise der Männlichkeit Gedanken machen. Denn Gewalt ist männlich, die Courage dagegen, die Barmherzigkeit, das Sich-Einmischen liegen viel stärker bei den Frauen. Wer mischt sich denn in der U-Bahn ein, wenn es kritisch wird? Das sind fast immer Frauen, und wer zuschlägt, das sind fast immer Männer. Diese Krise der Männlichkeit entsteht in den Vororten, dort brauchen wir Antworten, die den jungen Männern andere Idole, andere Perspektiven, andere Freizeitchancen vermitteln als das, was wir gegenwärtig anbieten. Wir brauchen dort, wo Randgruppen sich bündeln, ein ganz anderes Engagement der Sportvereine, und dazu müssen diese gestärkt werden. Wir brauchen dort wirklich Ganztagsschulen, weil die Eltern nachmittags oft nicht zu Hause sind und sich nicht kümmern können; dort brauchen wir auch eine Bündelung von ehrenamtlichen Engagements, sonst wird die Teilung in Sachen Sicherheit in der Tat immer stärker, hier die Fluchtburgen der reichen Bürger, die von privaten Sicherheitsdiensten bewacht werden, dort die Unsicherheitszonen, wie es sie früher in New York gegeben hat, wo man mir sagte: Da musst du dann aber aus der U-Bahn aussteigen, darüber hinaus darfst du nicht, das ist ganz gefährlich. Das hat sich heute verändert. Aber wir könnten in diese Richtung rutschen und müssen dafür, dass es nicht geschieht, etwas tun.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Im Grunde haben Sie alles gesagt. Ich will mich nur in einem Punkt selbst wiederholen, weil es zum Thema gehört: Sicherheit ist eines der schwierigsten Themen für die politische Auseinandersetzung. Es ist explosiv. Es birgt die größte Versuchung, damit demagogisch umzugehen. Und es ist leider eine große Versuchung, damit feige umzugehen. Was die Rede des Bundeskanzlers angeht, hatte man das Gefühl, da könnte die Balance gehalten worden sein: das Bürgerrecht auf Sicherheit massiv zu vertreten, ohne sich auf rechte Parolen einzulassen.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Nun sind ja die Bürgerinnen und Bürger nicht mit Hoheitsrechten ausgestattet. Und "neighbourhood watch" wie in den USA wollen wir nicht. Die Bronx in New York galt viele Jahre als gefährlich, ich denke, niemand von Ihnen wäre noch vor wenigen Jahren freiwillig in die Bronx gefahren, auch nicht am helllichten Tag. Die Bronx in New York gilt heute als einer der sicheren Stadtteile, revitalisiert ausschließlich durch Bürgerinitiativen, durch integratives Verhalten von Bürgern, die sich gegen die erheblichen Sicherheitsmängel zur Wehr gesetzt haben.
|
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Die Revitalisierung der Bronx wurde auch von der Wirtschaft massiv unterstützt, die ihr eigenes Interesse daran entdeckt hat. Ihre Gewinne sind dort am besten, wo auch die Gesellschaft gesund ist. Ich war gerade in New York und habe mit den Verantwortlichen geredet. Es war ganz stark die Wirtschaft, die dort investiert hat, weil sie gesehen hat, es ist in ihrem eigenen Interesse.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Sicherheit in den Städten, harmlose Frage: wer trägt die Verantwortung?
|
 Prof. Dr. John Friedmann Prof. Dr. John Friedmann
Was Herr Pfeiffer über das Männliche und die Kultur des Männlichen gesagt hat, hat mir gefallen. Ich komme nämlich aus einem Land, aus den Vereinigten Staaten, in dem wir eine Kultur der Gewalt haben. Eine Statistik besagt, wenn ich mich recht erinnere, dass die Gewaltrate in den USA zwanzigfach höher ist als in Deutschland. Woher kommt das? Es ist ein kultureller Unterschied, nicht so sehr ein Unterschied zwischen Städten wie etwa Los Angeles und Berlin. Es ist eine gewisse Art, Konflikte auszutragen, die sich in Deutschland eingebürgert hat und die nicht sogleich zu Gewalttätigkeiten führt. Wie könnte man das fördern, frage ich mich. Ich habe keine Antwort darauf. Aber irgendwie muss doch eine Kultur der Nonviolence, des nicht gewalttätigen Vorgehens gefördert werden als Modell des persönlichen Vorgehens.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Wenn wir über Sicherheit in unseren Städten sprechen, meinen wir nicht nur Kriminalstatistiken. Ich möchte Sie einfach mal fragen: Wann beginnt denn Gewalt in Städten? Kennen Sie die Theory of the Broken Windows, diese uralte Theorie, dass das zerbrochene Fenster, das eben nicht ersetzt wird, das man monatelang zerbrochen in einem Haus belässt, den nächsten Steinwurf erst evoziert? Es gibt eine interessante Studie der Essener Polizei, die ich hier ganz kurz zur Diskussion stellen möchte. Gefragt wurden Essener Bürger, was ihnen in ihrer Stadt Angst macht. Das erstaunliche Ergebnis: es war nicht die Angst vor dem spektakulären Verbrechen, es war vielmehr diese schwelende Dauerangst vor Vandalismus, vor einer Atmosphäre von Verwahrlosung. Davor haben die Menschen in unseren Städten Angst. Sehen Sie das auch so?
|
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Die Theorie in dem Buch über die Broken Windows, dass nämlich das zerbrochene Fenster der Anfang der Verwahrlosung ist, transportiert die ganz wichtige Erkenntnis, dass man den Anfängen der Verwahrlosung wehren muss; nur dann erhöhen sich die Chancen, andere Versuchungen in den Griff zu bekommen. Allerdings ist es natürlich kein Allheilmittel, und es braucht schon eine gewisse Struktur. Diejenigen, die die Fenster zerschlagen, haben auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Und wir kennen es aus dem Graffitibereich, der zur Zeit des Herrn Naegeli in Zürich auch Kunst war. Da haben doch viele von uns gesagt: ach, das ist doch mal nett, etwas gegen die grauen Städte. Wir sehen heute, wie grässlich das sein kann. Kaum hat man irgendwo etwas übermalt, ist schon wieder was drauf.
Man muss klar sagen: die Schwester der Theorie von den Broken Windows war die Strategie der Zero Tolerance, das heißt der Ansatz, mit Null Toleranz vorzugehen und die Vergehen gnadenlos zu verfolgen. Das war ein populäres New Yorker Konzept und wurde zum Teil in Europa, vor allem in Großbritannien, imitiert. Das bedeutete auch: Wer in der U-Bahn schwarzfährt, ist ein potenzieller Straftäter. Statistisch ließ es sich sogar belegen, weil einige, die beim Schwarzfahren aufgegriffen wurden, auch ein Messer dabei hatten. Die Grenze zur Intoleranz ist dabei sehr schnell erreicht. Komischerweise sind es in gemischten Vierteln immer wieder diejenigen, die dunkle Hautfarbe haben oder sonst irgendwie anders aussehen, die im Zuge der Zero Tolerance als erste aufgegriffen werden.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Wo beginnt Unsicherheit in Städten, wo beginnt latente Verunsicherung? Sie sprechen im Zusammenhang mit Kriminalitätsbereitschaft das Schwarzfahren an. Darauf möchte ich noch einmal eingehen, funktionierender ÖPNV und Sicherheit. Ich kaufte mir gestern hier in Berlin ein Tagesticket und sagte zu der Verkäuferin, dass das aber teuer sei. Sie sagte dann: "Na klar, seitdem fahren ja och 40 Prozent mehr schwarz." So, frage ich mich, haben die alle ein Messer dabei? Ich denke, da ist ein permanenter Zusammenhang im städtischen Gefüge, das ist ja auch das Faszinierende, Stadt lebt, Stadt verändert sich, Stadt bedingt sich selbst. Darf ich Sie zum Schluss fragen: Ist dieses Jahrhundert, mit so vielen Bürden aus der Taufe gehoben, ein Jahrhundert der Städte oder wird es eher ein Jahrhundert der Reflexion über Städte?
|
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Die empirischen Daten sind eindeutig, Herr Friedmann wird das sofort bestätigen: Die Verstädterung nimmt zu. Wir haben das merkwürdige Phänomen, dass wir insgesamt weltweit weitere Verstädterung haben, die großen Metropolen, die großen Ballungszentren werden einen noch größeren Prozentsatz der Bevölkerung umfassen - mit all den Problemen, auch sozialen Problemen, die damit zusammenhängen. Allerdings sieht man jetzt auch zum Teil klarer, warum die Menschen in die Städte ziehen. Früher wurde manchmal so getan, als sei es völlig irrational, beispielsweise aus funktionierenden dörflichen Sozialstrukturen in die Slums von Rio de Janeiro zu ziehen. Inzwischen hat ein genauerer Blick gezeigt: es gibt gute Gründe dafür, z.B. ist in diesen Slums oder Favelas die Lebensqualität, über das ganze Jahr betrachtet, deutlich besser als draußen in den Dörfern. Es gibt z.B. eine gewisse medizinische Grundversorgung. Es ist überhaupt faszinierend, sich genauer mit den Sozialstrukturen in solchen Favelas, die uns immer als ein Schreckgespenst dargestellt werden, auseinander zu setzen. Ich war öfters in Rio und habe mir ein eigenes Bild zu machen versucht.
Auf der einen Seite haben wir sicher eine Verstädterung weltweit, auf der anderen Seite haben wir, z.B. in Europa, besonders in Ostdeutschland, das Phänomen der Schrumpfstädte, der Städte, die durch starken Bevölkerungsverlust geprägt sind. So hat Halle seit der deutsch-deutschen Vereinigung ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. Aber ich warne davor, zu sehr zu dramatisieren. So, wie wir den Aufwuchs verkraftet haben, werden wir vielleicht den Abwuchs verkraften. Sicher, da gibt es viel zu diskutieren. Ich finde es ganz wesentlich, dass wir an einem integrativen Stadtmodell festhalten, an der Vision einer integrierten zivilen Stadt mit öffentlichen Räumen, mit Begegnungsorten, staatlicherseits mitverantwortet und von der Bürgerschaft mitgestaltet, und dass wir dieses Modell der Tendenz zur Kommerzialisierung, Desintegration, zum Kontrollverlust über diese Entwicklung entgegensetzen.
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Die Vision ist wunderschön. Aber für unser Land sehe ich eine Riesenaufgabe, die wir bisher nicht ansatzweise bewältigt haben: Wie bewältigen wir die angesichts des Geburtenrückgangs nötige kommende Einwanderungswelle besser als bisher? Sie wird keine Riesewelle sein, aber sie wird permanent sein. Für mich ist die kritische Frage, wie wir wegkommen von dem Modell der 90-Jahre. Da haben wir eine Zuwanderung von drei Millionen Menschen gehabt, und nur eine Million ist im Arbeitsmarkt gelandet. So darf das nicht bleiben. Zuwanderung primär in den Sozialstaat halten wir nicht aus, halten auch die Menschen nicht aus, die hierher kommen; das schafft Riesenkonflikte auch um Armut und Reichtum. Denn um ein Ausgangsbild zu nehmen: dieses trichterförmige Erben betrifft nur die Deutschen, die hier was zu erben haben, die Ausländer, die hierher kommen, haben nichts zu erben.
Vor uns steht also ein riesiges Wachstum der sozialen Gegensätze. Das müssen wir überbrücken durch perfekte Zurichtung unserer Schulen, unseres ganzen Bildungssystems auch auf die Menschen, die zu uns kommen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit eröffnen, dass sie über Bildung in diese Gesellschaft hineinwachsen. Genau das schaffen wir bisher nicht annähernd, denn ich sehe im Durchschnitt 8,5 Prozent der jungen Türken in Gymnasien, dagegen 44 Prozent der jungen Deutschen. Hier ist für mich der Schlüssel. Und hier müssen die Bürger selber drängen, dass die soziale Integration der Einwanderer einigermaßen gut geht. Das ist für mich das zentrale Problem der Großstädte. Dafür müssen wir beispielsweise die Dienstleistungsberufe ganz anders öffnen als bisher. Die Konflikte, um die es hier geht, werden beispielsweise nicht mit einer primär deutschen Polizei bewältigt. In der Polizei müssen die Zuwanderer ihrem Anteil entsprechend repräsentiert sein, damit die Konflikte kommunikativ bewältigt werden können.
Ich habe freilich eine Hoffnung. Das Zauberwort heißt Mediation auf allen Ebenen. Wir brauchen eine andere Streit- und Auseinandersetzungskultur. Die Schulen begreifen das immer mehr. Wir haben eine wachsende Zahl von Schulen, die Schulmediation zu einem Inhalt ihrer Schulausbildung machen; Kinder lernen, mit Konflikten umzugehen, und zwar verbal, indem man beide Seiten hört, indem man Kompromisse sucht. Auch in der Justiz haben wir plötzlich Mediation; das versuche ich selber in großen Modellversuchen in der Justiz einzuführen. Ähnliches gilt im Hinblick auf andere gesellschaftliche Auseinandersetzungen. In Deutschland sind wir sehr am Dazulernen, was eine kommunikative Konfliktbearbeitung betrifft, gerade auf der Ebene der Städte. Wenn uns beides gelingt, die Streitkultur, die Kommunikationskultur zu verbessern und die Integration ins Bildungswesen auf der kommunalen Ebene zu erreichen, dann bin ich ganz optimistisch, dass die Vision von Herrn Nida-Rümelin auch stimmen kann.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Es ist ja nicht meine Aufgabe, Politiker zu loben, aber ich muss schon sagen, dass mir Ihre beiden Visionen doch eine gewisse Hoffnung machen. Denn eigentlich lässt mich das Gegenbild, eine Art Alptraum nicht mehr los, seit ich Ralf Dahrendorf gelesen habe. In einem Diskurs über die Auswirkungen der Globalisierung auf unsere Gesellschaft, unsere städtische Gesellschaft, meint Dahrendorf, es sei nicht die unwahrscheinlichste Option, dass das 21. Jahrhundert ein autoritäres Jahrhundert wird - unter den Leitmotiven "Demokratie", "Sicherheit", "Schutz vor Bedrohungen", mit etwas mehr als nur ein paar Kameras an öffentlichen Orten, mit etwas mehr als nur ein paar mehr Kompetenzen für die Sicherheitsbehörden zum Schutz der Bürger, weil sich die Bedrohung erhöht und Selbstmordattentäter nicht mehr nur im Nahen Osten, sondern überall herumlaufen und Durchgeknallte plötzlich zu einer allgemeinen Bedrohung werden. Aber das muss nicht so sein. Dahrendorf sagt bewusst, es ist nicht die unwahrscheinlichste Option, aber sie ist nicht zwingend.
 Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Die Entwicklung geht nicht in Richtung Diktatur, sondern eher in Richtung Oligarchie im Sinne von Herrschaft der Reichen.
 Dr. Werner A. Perger Dr. Werner A. Perger
Die Diktatur, wie wir sie aus der Geschichte kennen, bleibt voraussichtlich Geschichte. Aber die Demokratie, die dann kommt, ist nicht mehr die Demokratie, die wir jetzt haben, die wir ziemlich gut finden, in der wir streiten und für die wir streiten. Aber da es auch diese Visionen gibt, bin ich doch optimistisch. Jedenfalls - um noch einmal zum Thema zurückzukommen - entscheidet sich die Zukunft in den Städten.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
In den Städten entscheidet sich die Zukunft. Herr Prof. Friedmann, macht Ihnen das Angst oder ist es eine Chance, die wir nutzen können?
|
 Prof. Dr. John Friedmann Prof. Dr. John Friedmann
Die Chance zum Wandel ist immer da, denn es ist uns nicht gegeben, uns dem Wandel nicht auszusetzen. Der Wandel ist das Stetige, und die Statik ist eigentlich die Ausnahme. Es kommt also mehr darauf an, in welche Richtung wir uns wandeln wollen. Das ist eine richtige Frage und zum großen Teil eine Frage der Werte. Es ist überdies eine persönliche wie auch soziale Frage. Und deswegen meine ich, dass die Soziale Stadt Anhaltspunkte liefert für eine Überlegung hinsichtlich der sozialen Werte im Leben.
 Brigitte Bastgen Brigitte Bastgen
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir konnten hier oben auf diesem Podium den Auftrag, den wir übernehmen sollten, natürlich nur partiell erfüllen. Natürlich wird der eine oder die andere von Ihnen jetzt sagen, über dies und jenes hätte man unbedingt auch noch reden müssen. Natürlich, ich kann Ihnen nur sagen: Sie werden dazu viel Zeit haben, auch noch über ihre Themen zu reden, z.B. in der anschließenden Kaffeepause. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine Bemerkung. Ich denke, meine Herren, dass Sie unter diesen drei sehr, sehr starken Begriffen - Zusammenhalt, Sicherheit, Zukunft - eines auf jeden Fall überaus deutlich gemacht haben: ganz gleich, wie man zur Stadt steht, ob negativ, ob positiv, deutlich wurde, dass Städte schon zu Beginn unserer Zivilisation die Kernzentren waren und dass sie Kraftzentren bleiben werden, ganz gleich, wie die Stadt im Jahre 2025, wenn 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden, aussehen wird. Sie haben hier auch sehr deutlich gemacht, dass Menschen in den Städten Hilfe suchen und Menschen in den Städten Hilfe geben. Eigentlich wird in den Städten über unsere conditio humana entschieden. Und der Kampf gegen Fremdenhass, gegen Segregation, gegen Negativismen wird in den Städten entschieden - oder eben gar nicht.
|
|

 Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Prof. Dr. Christian Pfeiffer Dr. Werner A. Perger
Dr. Werner A. Perger Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Prof. Dr. Christian Pfeiffer Dr. Werner A. Perger
Dr. Werner A. Perger Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Prof. Dr. Christian Pfeiffer Prof. Dr. John Friedmann
Prof. Dr. John Friedmann Dr. Werner A. Perger
Dr. Werner A. Perger Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Prof. Dr. Christian Pfeiffer
Prof. Dr. Christian Pfeiffer Dr. Werner A. Perger
Dr. Werner A. Perger Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Dr. Werner A. Perger
Dr. Werner A. Perger Prof. Dr. John Friedmann
Prof. Dr. John Friedmann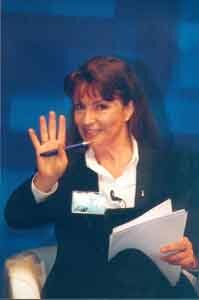 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur ersten Podiumsdiskussion des Kongresses begrüßen. Ich habe die sehr schöne Aufgabe, die Diskussionsrunde zu moderieren. Zunächst möchte ich meine äußerst unterschiedlichen, sehr interessanten Gäste begrüßen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur ersten Podiumsdiskussion des Kongresses begrüßen. Ich habe die sehr schöne Aufgabe, die Diskussionsrunde zu moderieren. Zunächst möchte ich meine äußerst unterschiedlichen, sehr interessanten Gäste begrüßen.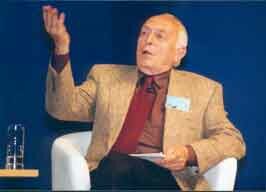 Ich weiß nicht, ob ich diesem Diktum beipflichten würde. Historisch gesehen ist es bestimmt so, wie Sie gesagt haben. Aber ich meine, dass eine ganz große Änderung im Gang ist. Heutzutage sprechen wir als Planer eher von einer Stadtregion als von einer ummauerten Stadt. Zu Zeiten meines Vaters oder meines Großvaters war ja Wien noch eine ummauerte Stadt. Und für Max Weber bedeutet die Mauer die Abgrenzung des Städtischen vom Ländlichen. Wir sagen immer, wir ziehen in die Stadt, um in Freiheit zu leben. Stadt macht frei, Stadtluft macht frei, das war das Leitmotiv.
Ich weiß nicht, ob ich diesem Diktum beipflichten würde. Historisch gesehen ist es bestimmt so, wie Sie gesagt haben. Aber ich meine, dass eine ganz große Änderung im Gang ist. Heutzutage sprechen wir als Planer eher von einer Stadtregion als von einer ummauerten Stadt. Zu Zeiten meines Vaters oder meines Großvaters war ja Wien noch eine ummauerte Stadt. Und für Max Weber bedeutet die Mauer die Abgrenzung des Städtischen vom Ländlichen. Wir sagen immer, wir ziehen in die Stadt, um in Freiheit zu leben. Stadt macht frei, Stadtluft macht frei, das war das Leitmotiv. Frau Bastgen, die Stadt, da stimme ich Ihnen zu, ist natürlich in der Geschichte Motor von Veränderung und von Entwicklung gewesen. Aber was wir jetzt beobachten, ist natürlich in erster Linie, dass sie Schauplatz von Ver-änderungen ist. Die Städte können diese Ver-änderungen so wenig direkt beeinflussen, wie heute nationale Regierungen dies tun können. Wir kennen alle den Spruch: "All politics is local." Und wir kennen auch den Satz: "Man muss global denken, aber lokal handeln", weil die Politik eben vor Ort stattfindet. Aber es gilt heute auch die Einsicht: "All economics is global", und wir sprechen deshalb von der Globalisierung. Die Auswirkungen der Globalisierung spürt man heute am stärksten in den Städten.
Frau Bastgen, die Stadt, da stimme ich Ihnen zu, ist natürlich in der Geschichte Motor von Veränderung und von Entwicklung gewesen. Aber was wir jetzt beobachten, ist natürlich in erster Linie, dass sie Schauplatz von Ver-änderungen ist. Die Städte können diese Ver-änderungen so wenig direkt beeinflussen, wie heute nationale Regierungen dies tun können. Wir kennen alle den Spruch: "All politics is local." Und wir kennen auch den Satz: "Man muss global denken, aber lokal handeln", weil die Politik eben vor Ort stattfindet. Aber es gilt heute auch die Einsicht: "All economics is global", und wir sprechen deshalb von der Globalisierung. Die Auswirkungen der Globalisierung spürt man heute am stärksten in den Städten.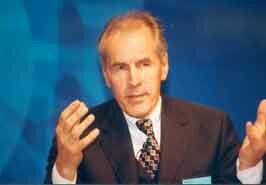 Für mich liegt die Herausforderung für die Städte insbesondere darin, mit einigen Zahlen und Daten umgehen zu müssen:
Für mich liegt die Herausforderung für die Städte insbesondere darin, mit einigen Zahlen und Daten umgehen zu müssen: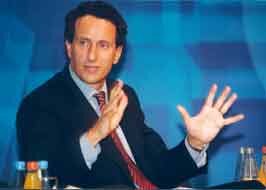 Wir sollten da anknüpfen, wo Herr Friedmann aufgehört hat. Herr Friedmann hatte gesagt, die behaupteten Unterschiede zwischen Europa, Asien und Amerika seien Vergangenheit. Ich spitze es etwas zu: Wir haben es mit einer globalen Stadtentwicklung zu tun. Die Unter-schiede werden sich nivellieren. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner befunden: Spaziergänger brauchen wir nicht in der Stadt. Wir brauchen auch keine Bürgersteige. Wer spazieren gehen will, der soll in den Stadtpark gehen. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner auch gefordert, wir sollten sorgfältig unterscheiden zwischen erstens Regionen, in denen gearbeitet wird, in denen "Dreck" entsteht, zweitens Regionen, in denen gewohnt wird und wo es ruhig sein muss, weil die Menschen schlafen müssen, und drittens Regionen, in denen Unterhaltung stattfindet. Ich denke, es ist gut, dass diese Visionen der Stadtplaner nicht vollständig umgesetzt wurden, sie haben genug Schaden angerichtet.
Wir sollten da anknüpfen, wo Herr Friedmann aufgehört hat. Herr Friedmann hatte gesagt, die behaupteten Unterschiede zwischen Europa, Asien und Amerika seien Vergangenheit. Ich spitze es etwas zu: Wir haben es mit einer globalen Stadtentwicklung zu tun. Die Unter-schiede werden sich nivellieren. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner befunden: Spaziergänger brauchen wir nicht in der Stadt. Wir brauchen auch keine Bürgersteige. Wer spazieren gehen will, der soll in den Stadtpark gehen. Vor wenigen Jahrzehnten haben Stadtplaner auch gefordert, wir sollten sorgfältig unterscheiden zwischen erstens Regionen, in denen gearbeitet wird, in denen "Dreck" entsteht, zweitens Regionen, in denen gewohnt wird und wo es ruhig sein muss, weil die Menschen schlafen müssen, und drittens Regionen, in denen Unterhaltung stattfindet. Ich denke, es ist gut, dass diese Visionen der Stadtplaner nicht vollständig umgesetzt wurden, sie haben genug Schaden angerichtet.