soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
8.3 Aktivierung und Beteiligung in der Programmumsetzung
![]() Ausgangssituation in den Gebieten
Ausgangssituation in den Gebieten
Die Erfahrungen in den Modellgebieten verdeutlichen, dass es teilweise sehr unterschiedliche Ausgangssituationen für Aktivierung und Beteiligung in den verschiedenen Quartieren gab. In gut einem Drittel der Modellgebiete existierten zu Beginn der Programmumsetzung nur sehr wenige oder gar keine Vereine und Initiativen - mithin bürgerschaftliche Organisationsformen im Sinne eines Gemeinwesens. Dies korrespondiert mit der Feststellung, dass es zu Beginn der Programmumsetzung in einigen Gebieten eine nur geringe Eigeninitiative der lokalen Akteure gab - möglicherweise weil sozial benachteiligte Gruppen teilweise Hemmungen haben, sich zu engagieren. Die Mitgliedschaft in einem Verein - für viele Kommunen und auch Evaluatoren ein wichtiger Indikator zur Messung von "Gemeinwesen" - ist bei einigen Bevölkerungsgruppen eher unüblich (1). Individuelle Probleme dominieren gegenüber allgemeinen quartiersbezogenen Themen (2). Im Extremfall sind ein "Ghetto-Wir-Gefühl", Mangel an Solidarität, ein nur geringes Verpflichtungsgefühl, Lethargie und Frustration in der Bewohnerschaft Ausgangspunkte für die Programmumsetzung (3). Hohe Fluktuation, der Fortzug einkommensstärkerer und der Zuzug benachteiligter Haushalte erschweren die Stabilisierung von Gemeinwesenstrukturen (4).
Auf der anderen Seite konnte die Vor-Ort-Arbeit in einem weiteren guten Drittel der Modellgebiete bereits auf einer aktiven Vereins- und Initiativenlandschaft aufbauen, was allerdings nicht in jedem Fall bedeuten musste, dass diese Gruppierungen anfangs miteinander in Kontakt standen; in vielen Fällen war dafür zunächst erhebliche Vernetzungsarbeit zu leisten (5) . In einigen Gebieten wurden bei "traditionellen" deutschen Sport- und Kulturvereinen eher ein Rückgang, dafür aber eine Zunahme von Migranten-Clubs und -Initiativen - insbesondere der türkischen Bevölkerung - beobachtet (6) .
|
Abbildung 89: Netzwerkkonstellationen in den Programmgebieten (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
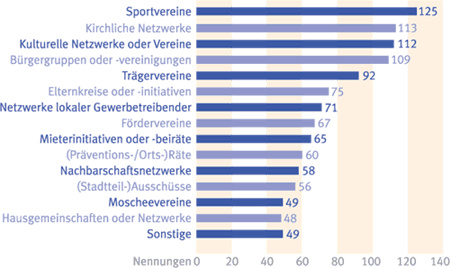 |
|
Deutsches institut für Urbanistik |
Auch in den Programmgebieten basieren die Gemeinwesenstrukturen sehr stark auf Sport- oder kulturellen Vereinen; daneben spielen kirchliche oder kulturelle Netzwerke sowie Bürgergruppen oder -vereinigungen eine wichtige Rolle. Weniger institutionalisierte Gruppierungen wie Nachbarschaftsnetzwerke oder Hausgemeinschaften werden in der Befragung dagegen seltener genannt.
In den Programmgebieten (inklusive Modellgebieten) wird eine breite Palette an Aktivierungstechniken eingesetzt. Besonders häufig wurden Informationsangebote und -veranstaltungen, Beratungsangebote, Stadtteilfeste und (aktivierende) Befragungen genannt. Informationsarbeit, Stadtteilfeste sowie die Akteursvernetzung gelten als besonders wichtige Elemente. Der Stellenwert von aktivierenden Befragungen, Gebäude- und Gebietsbegehungen sowie Beratung hat - wie die zweite gegenüber der ersten Befragung zeigt - insgesamt zugenommen.
|
Abbildung 90: Eingesetzte Aktivierungstechniken (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
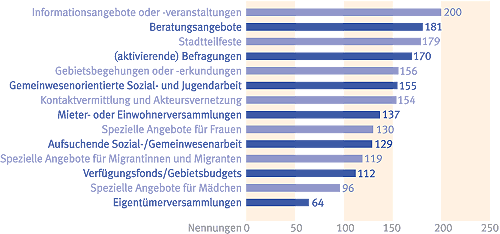 |
|
Deutsches institut für Urbanistik |
Trotz intensivierter Aktivierungsarbeit in der Mehrzahl der Modellgebiete betonen viele PvO-Teams, dass es in diesem Bereich noch immer Nachholbedarf gibt. Für Ludwigshafen - Westend wird beispielsweise empfohlen, dass in Zukunft "noch intensiver als bisher eine ,aufsuchende Aktivierung' der Bewohner betrieben" werden sollte (7) . Zu einem ähnlichen Schluss kommt das PvO-Team für Hamburg- Altona - Lurup, wo zwar die Aktivierung der Quartiersbevölkerung bereits erfolgreich, unter verschiedenen Gesichtspunkten gleichwohl noch verbesserungsfähig sei (8) .
Auch im Bremer Modellgebiet sind nach Einschätzung der PvO sowohl eine Intensivierung aufsuchender Ansätze - unter anderem, um vor allem Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund besser zu erreichen - als auch insgesamt eine bessere Abstimmung der Maßnahmen aufeinander notwendig (9) . Für Halle - Silberhöhe wird ein niedrigschwelliges Angebot an Beteiligungs- und Aktivierungsformen vorgeschlagen: "Die gewählten Aktivierungs- und Beteiligungstechniken zielen ... nur auf eine sehr kleine Personengruppe, die bereit und in der Lage ist, sich im Stadtteil zu engagieren" (10) . Auch aus Sicht der PvO Leipziger Osten ist es notwendig, "dem Aspekt Aktivierung künftig eine sehr viel größere Bedeutung zuzumessen, um Eigeninitiative und Organisationsgrad der Quartiersbevölkerung zu stärken und sie damit für die Teilnahme an Beteiligungsprozessen zu befähigen" (11) .
In den Programmgebieten werden als Beteiligungsformen am häufigsten Arbeitsgruppen, Arbeitskreise oder Workshops sowie Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche angeboten. Stadtteilkonferenzen oder -foren spielen für knapp zwei Drittel der Programmgebiete eine Rolle.
|
Abbildung 99: Beteiligungsmöglichkeiten in den Programmgebieten (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
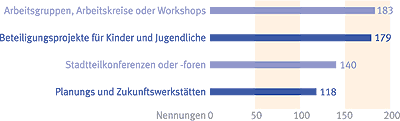 |
|
Deutsches institut für Urbanistik |
Während im Frühjahr 2001 zum Zeitpunkt der Zwischenberichterstattung in fast einem Drittel der Modellgebiete noch keinerlei Beteiligungsmöglichkeiten eingerichtet worden waren, spielt Partizipation heute überall eine Rolle - wenn auch mit von Fall zu Fall sehr unterschiedlicher Ausprägung in Bezug auf Anlass, Ziel, Thema, zeitliche Kontinuität. Beteiligung findet in den Modellgebieten vor allem in Form von Gebietsforen (im weiteren Sinne Runde Tische, Stadtteilarbeitskreise usw.) - oftmals in Verbindung mit Themen-Arbeitsgruppen - statt. Neben diesen Partizipationsangeboten mit Veranstaltungscharakter spielen auch hier (zielgruppenspezifische) beteiligungsorientierte Projekte ("Mitmachprojekte") eine wichtige Rolle.
Wie schon im Bereich Aktivierung scheint in vielen Modellgebieten auch die bisher geschaffene Basis für Beteiligung noch ausbau- und verbesserungsfähig zu sein. Dies gilt gleichermaßen für Städte und Gemeinden mit vergleichsweise großen Beteiligungserfahrungen. Für Hamburg-Altona - Lurup wird beispielsweise konstatiert, dass bestimmte Zielgruppen nicht erreicht werden, obwohl eine Vielzahl an Instrumenten, Konzepten und Methoden der Bürgerbeteiligung zur Verfügung steht. Zudem sei zu fragen, ob die Wünsche der Beteiligten ausreichend berücksichtigt werden (12) . Auch im Ludwigshafener Modellgebiet konnte eine "dauerhafte Beteiligung aller Zielgruppen im Quartier noch nicht" erreicht werden: "Um eine kontinuierliche Beteiligung sicherzustellen, bedarf es allerdings Strukturen und persönlicher Kontakte im Quartier, die erst in einem mittelfristigen zeitlichen Horizont aufgebaut werden können" (13) . Für Hannover - Vahrenheide wird empfohlen, Maßnahmen zur Aktivierung und Beteiligung "angesichts der beobachtbaren Rückzugs- und Resignationstendenzen in der Bevölkerung so niedrigschwellig wie möglich" (14) anzusetzen. Für die Neunkirchener Innenstadt wird unter anderem das Spannungsfeld zwischen Top-down- und Bottom-up-Ansätzen problematisiert: "Die Beteiligung erfolgte bisher auf Initiative der Verwaltung, vorwiegend in der Programmplanungsphase. Für den weiteren Umsetzungsprozess ist allerdings eine weitergehende Beteiligung z.B. im Rahmen der Projektkonzeption unerlässlich. Dies scheint allerdings in einer traditionellen Verwaltungsstruktur schwierig, da intensive Beteiligungsprozesse wenig eingeübt sind. ... Im weiteren Umsetzungsprozess sind vor allem Aktivitäten zur umfassenden Beteiligung der Bewohner auszubauen, um dem integrativen Ansatz gerecht zu werden." (15)
![]() Erreichbarkeit der Quartiersbevölkerung
Erreichbarkeit der Quartiersbevölkerung
Angesichts der Tatsache, dass in den Programmgebieten wie z.B. in Flensburg - Neustadt "in den letzten zwei Jahren viel an Beteiligung, Kommunikation und Begegnung entstanden ist" (16) , bleibt zu fragen, welche Bevölkerungsgruppen wirklich erreicht wurden. Aus Leinefelde - Südstadt wird berichtet, dass durch "ein breites Spektrum von Aktivierungsformen ... unterschiedliche Bevölkerungsgruppen angesprochen und zunehmend auch erreicht" worden sind (17) .
|
Tabelle 18: Einschätzung der Erreichbarkeit von Bevölkerungsgruppen (n=222; Zweite Befragung Difu 2002); Hervorgehoben sind die jeweils vier häufigsten Nennungen bei den positiven und negativen Einschätzungen. |
|||||||
|
Bevölkerungsgruppe |
+ + |
+ |
+/- |
weiß nicht |
k.A. |
||
|
Kinder |
57 |
102 |
21 |
6 |
2 |
12 |
22 |
|
Jugendliche (Mädchen) |
31 |
98 |
38 |
13 |
6 |
12 |
24 |
|
Jugendliche (Jungen) |
32 |
101 |
40 |
10 |
2 |
12 |
25 |
|
Alte Menschen |
22 |
82 |
45 |
22 |
4 |
19 |
28 |
|
Angehörige fremder Ethnien |
14 |
61 |
63 |
26 |
9 |
18 |
31 |
|
Aussiedlerinnen/Aussiedler |
7 |
42 |
48 |
30 |
16 |
35 |
44 |
|
Alleinerziehende |
4 |
46 |
66 |
25 |
3 |
45 |
33 |
|
Arbeitslose, Sozialhilfe-empfängerinnen und -empfänger |
9 |
45 |
63 |
41 |
2 |
32 |
30 |
|
Frauen |
32 |
91 |
41 |
2 |
1 |
20 |
35 |
|
Männer |
10 |
65 |
64 |
23 |
2 |
21 |
37 |
|
Andere |
9 |
4 |
7 |
2 |
1 |
17 |
182 |
|
Deutsches institut für Urbanistik |
|||||||
Mit den bisher praktizierten Aktivierungs- und Beteiligungsansätzen werden nach Einschätzung der kommunalen Ansprechpartnerinnen und -partner für das Programm Soziale Stadt vor allem Kinder, Jugendliche, Frauen und alte Menschen erreicht. Problematischer stellt sich dagegen die Erreichbarkeit von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Arbeitslosen/Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern sowie Migrantinnen und Migranten dar. Diese Trends werden durch die Erfahrungen in den Modellgebieten größtenteils bestätigt, wobei hier in zwei Dritteln der Fälle auch die Erreichbarkeit von (jugendlichen) Migrantinnen und Migranten als problematisch beschrieben wird.
Ein anderes Problem, das im Endbericht zu Hannover - Vahrenheide angesprochen wird, betrifft die Reichweite von Beteiligung: Es "dominieren in der lokalen Politik und Verwaltung bis heute formale Kommunikationsformen und Verfahrensregeln, die viele der im Stadtteil lebenden Menschen schon allein durch ihre förmliche Struktur ausgrenzen (Rednerliste, Anträge stellen usw.). ... Nur ein äußerst geringer Teil der betroffenen Bewohnerschaft, in der Regel Personen mit hinreichenden soziokulturellen Ressourcen der Kommunikation und Konfliktfähigkeit, nehmen diese Foren wahr. Sporadische Beteiligungen am Bürgerforum von Personen mit Migrationshintergrund sowie auch von Personen aus den sozial benachteiligten Milieus reichen nicht aus, ein notwendigerweise kontinuierliches Engagement zu gewährleisten" (18) . Hier knüpfen auch Empfehlungen des PvO-Teams zur Programmumsetzung im Leipziger Osten an: Es erscheint sinnvoll, "lokal und zeitlich begrenzte Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten - beispielsweise im Rahmen von Projektrealisierungen -, um auch außerhalb des Forums ... Partizipationsstrukturen aufbauen zu können" (19) .
Der Mangel an Entscheidungsbefugnissen auf der lokalen Ebene und damit das Fehlen von Möglichkeiten eines schnellen Handelns waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Hinderungsgrund für erfolgreiche Aktivierung und Beteiligung. Zur Aktivierung der Bevölkerung und zur Initiierung eines Selbstorganisationsprozesses ist daher die Einrichtung von Verfügungsfonds oder Stadtteilbudgets hilfreich, wenn nicht notwendig, mittels derer kleinere Projekte und Maßnahmen schnell und unbürokratisch verwirklicht werden können. Dabei spielt weniger die Summe der verfügbaren Mittel eine Rolle als vielmehr die Möglichkeit, diese Gelder unkompliziert direkt vor Ort einzusetzen: Die Programmumsetzung in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, dass "selbst mit kleinen Beträgen viele Projekte kurzfristig realisiert werden können, die ansonsten an den Finanzierungsmodalitäten scheitern würden" (20) .
In mehr als der Hälfte der Programmgebiete ist ein Verfügungsfonds eingerichtet worden (128 Nennungen = 58 Prozent), in gut einem Drittel der Quartiere gab es zum Zeitpunkt der Befragung dagegen kein eigenes Budget (85 Nennungen = 38 Prozent). Ähnlich sind die Relationen in den Modellgebieten: In mehr als der Hälfte der Quartiere gibt es bereits einen Verfügungsfonds (21) . In den meisten Fällen steht dafür eine jährliche Summe zwischen 12 500 und 25 000 Euro zur Verfügung.
|
Abbildung 100: Entscheidungsgremium zur Vergabe von Mitteln aus dem Verfügungsfonds (n=128, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
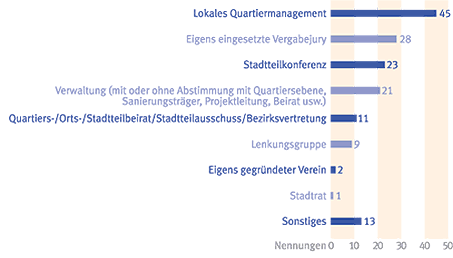 |
|
Deutsches institut für Urbanistik |
Über die Mittelverwendung entscheidet in den Programmgebieten sehr häufig das lokale Quartiermanagement. Andere Gremien, die öfter genannt wurden, sind eigens eingerichtete Vergabejurys, Stadtteilkonferenzen und die Verwaltung selbst. Diese Vielfältigkeit spiegelt sich auch in der Organisation der Entscheidung über die Mittelvergabe in den Modellgebieten: In Flensburg bestimmen die in den Sanierungsbeirat entsandten Betroffenenvertreterinnen und -vertreter über die Mittelverwendung für das Gebiet. In Hamburg entscheidet das lokale Beteiligungsgremium ("Luruper Forum"), in Schwerin das Stadtteilmanagement, in Leipzig das "Forum Leipziger Osten" über den Modellgebietsfonds sowie das lokale Quartiermanagement über den Verfügungsfonds in der "Kernzone" des Modellgebiets. In Gelsenkirchen wird der Verfügungsfonds ("Pauschalmittel") bisher vom Stadtteilbüro verwaltet; für den Ausbau stärker bewohnergetragener Strukturen könnte hier aus Sicht der PvO "die Bereitstellung eines selbstverwalteten ,lokalen Verfügungsfonds'" ein wichtiger Schritt sein (22).
Eine besonders weit reichende Variante des Verfügungsfonds gibt es in Berlin (23): Hier wurde für jedes Gebiet ein Quartiersfonds in Höhe von rund 500 000 Euro (1 Mio. DM) eingerichtet, über dessen Verwendung ein Vergabeausschuss befindet, der zu 51 Prozent mit nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern besetzt ist; die verbleibenden 49 Prozent setzten sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden, Vereinen, Initiativen, lokalen Gruppen, Senioreneinrichtungen, Gewerbe/Einzelhandel, Wohnungswirtschaft, Mieterbeiräten, Schulen/Schülerschaft, Elternvertretungen sowie den bereits in das Quartiermanagementverfahren involvierten Einzelpersonen zusammen. Daneben steht pro Berliner Quartiermanagement-Gebiet noch ein Aktionsfonds mit jährlich rund 15 000 Euro (30 000 DM) für die Realisierung von Projekten zur Verfügung, die von Bewohnerinnen und Bewohnern, Initiativen und Vereinen vorgeschlagen werden. Ein Vergabebeirat aus Quartiersbewohnerinnen und -bewohnern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Schulen, Initiativen und Vereinen entscheidet über den Mitteleinsatz. Das PvO-Team Kottbusser Tor stellt fest, dass durch den Einsatz von Quartiers- und Aktionsfonds mehr Bewohnerinnen und Bewohner als bisher erreicht werden.
(1) Schröder/Werth, S. 67. ![]()
(2) Geiss/Kemper/Krings-Heckemeier, S. 73. ![]()
(3) Krings-Heckemeier/Heckenroth/Geiss, S. 58. ![]()
(4) Cramer/Schuleri-Hartje, S. 53; Krings-Heckemeier/Heckenroth/Geiss, S. 58. ![]()
(5) Knorr-Siedow/Jahnke/Trostorff, S. 75. ![]()
(6) Mussel/Kreisl, S. 65. ![]()
(7) Schröder/Werth, S. 81. ![]()
(8) Breckner und andere, S. 117. ![]()
(9) Franke/Meyer, S. 68. ![]()
(10) Geiss/Kemper/Krings-Heckemeier, S. 86. ![]()
(11) Böhme/Franke, Programmbegleitung, S. 67. ![]()
(12) Breckner und andere, S. 117. ![]()
(13) Schröder/Werth, S. 80 f. ![]()
(14) Geiling und andere, Begleitende Dokumentation, S. 162. ![]()
(15) Jacob und andere, S. 93 f. ![]()
(16) Frinken/Rake/Schreck, S. 106. ![]()
(17) Buhtz und andere, S. 89. ![]()
(18) Geiling und andere, Begleitende Dokumentation, S. 131 f. ![]()
(19) Böhme/Franke, Programmbegleitung vor Ort, S. 67. ![]()
(20) Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungsprogramms, S. 72. ![]()
(21) Berlin-Kreuzberg - Kottbusser Tor, Flensburg - Neustadt, Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke- Nord, Hamburg-Altona - Lurup, Hannover - Vahrenheide-Ost, Leinefelde - Südstadt, Leipzig - Leipziger Osten, Nürnberg - Galgenhof-Steinbühl, Schwerin - Neu Zippendorf. Für Cottbus - Sachsendorf-Madlow ist die Einrichtung eines solchen Budgets geplant. ![]()
(22) Austermann/Ruiz/Sauter, S. 96. ![]()
(23) Hierzu und zum Folgenden: Beer/Musch, "Stadtteile ...", S. 131 ff. ![]()
|
Quelle: Soziale Stadt - Strategien für die Soziale Stadt, Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt", Deutsches Institut für Urbanistik 2003 |
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005







