soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
7.3 Quartiermanagement in den Programmgebieten der Sozialen Stadt
Das "Drei-Ebenen-Modell" bildete in der zweiten Difu-Befragung den Hintergrund zur Formulierung der Fragen zum Thema "Organisation und Management". Für 80 Prozent der Gebiete (1) werden sowohl auf der Verwaltungs- als auch auf der Quartiersebene sowie im intermediären Bereich Quartiermanagement-Aufgaben wahrgenommen und sind entsprechende Gremien eingerichtet worden. Ausschließlich verwaltungsgesteuerte Ansätze bilden die Ausnahme, eine Delegierung aller Aufgaben auf die Quartiersebene wurde überhaupt nicht genannt.
|
Tabelle 15: Steuerungs- und Handlungsebenen von Quartiermanagement (Zweite Befragung Difu 2002) |
||
|
In Quartiermanagement einbezogene Ebenen |
Nennungen |
|
|
abs. |
% |
|
|
Verwaltung, intermediärer Bereich und Quartier |
179 |
80,6 |
|
Verwaltung und intermediärer Bereich |
16 |
7,2 |
|
Verwaltung und Quartier |
4 |
1,8 |
|
Nur Verwaltung |
6 |
2,7 |
|
Intermediärer Bereich und Quartier |
6 |
2,7 |
|
Nur intermediärer Bereich |
3 |
1,4 |
|
Nur Quartier |
0 |
0,0 |
|
Keine Angabe |
8 |
3,6 |
|
Gesamt |
222 |
100,0 |
|
Deutsches institut für Urbanistik |
||
Insgesamt lassen sich diese Ergebnisse als Fortschritt der Programmimplementierung interpretieren: Bei der ersten Difu-Befragung (2000/2001) wurde nur für knapp die Hälfte der Programmgebiete angegeben, Elemente von Quartiermanagement eingerichtet zu haben. Für gut 40 Prozent wurde dieser Schritt geplant, während für ein Zehntel kein Quartiermanagement eingerichtet oder vorgesehen war. Inzwischen gilt Quartiermanagement als unerlässlicher Bestandteil der Programmumsetzung. Außerdem wird in den meisten Kommunen die Notwendigkeit gesehen, Organisationsstrukturen von Stadtteilentwicklung auf allen beteiligten Steuerungsund Handlungsebenen zu entwickeln und miteinander zu verknüpfen.
![]() Quartiermanagement auf der Verwaltungsebene
Quartiermanagement auf der Verwaltungsebene
Für rund 60 Prozent der Programmgebiete ist auf Verwaltungsebene eine dezernatsübergreifende Lenkungsgruppe eingerichtet worden. Als deren Hauptaufgaben wurden am häufigsten die Projektauswahl für die Mittelvergabe sowie die Entwicklung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts genannt. Für ebenfalls rund 60 Prozent wurde die Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe auf Ämter-/Arbeitsebene angegeben. Auch für dieses Gremium stehen die Projektauswahl für die Mittelvergabe sowie die Entwicklung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts im Vordergrund der Aufgaben.
|
Tabelle 16: Management- und Organisationsformen auf Verwaltungsebene (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
||
|
Management- und Organisationsformen |
Nennungen |
|
|
abs. |
% |
|
|
Ressortübergreifende Arbeitsgruppe |
134 |
60,4 |
|
Dezernatsübergreifende Lenkungsgruppe |
130 |
58,6 |
|
Gebietsbeauftragte/r |
114 |
51,4 |
|
Andere |
35 |
15,8 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||
Eine Gebietsbeauftragte oder ein Gebietsbeauftragter ist für gut die Hälfte der Gebiete eingesetzt worden. Als Zuständigkeitsbereiche dieser Koordinationsstelle wurden in der Befragung vor allem Berichtswesen, Mittelkoordination, generelle Koordinations- und Moderationsaufgaben, außerdem - wie bei den ressortübergreifenden Gremien auch - Projektentwicklung und Entwicklung/Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts genannt.
|
Abbildung 78: Gremien und Aufgaben auf Verwaltungsebene (Zweite Befragung Difu 2002)* |
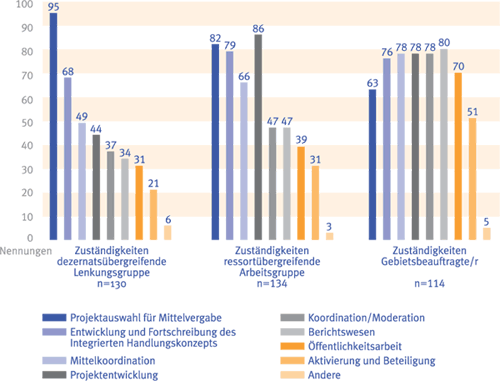 |
|
* In dieser Übersicht wurden die Unfrageergebnisse zum Thema Gremien und Aufgaben auf Verwaltungsebene zusammengefasst. Da auf Fragen in jeder Kategorie unterschiedlich viele Kommunen geantwortet haben, liegen hier drei unterschiedliche Grundgesamtheiten (n) zugrunde. |
|
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Auch in knapp zwei Dritteln der Modellgebiete (10 von 16) waren bis zum Sommer 2002 auf der Verwaltungsebene dezernatsübergreifende Steuerungsgremien eingerichtet worden. Für sechs dieser Gebiete existiert zusätzlich eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe auf Ämterebene. In weiteren vier Städten ohne Steuerungsgremium auf Dezernatsebene sind ebenfalls ämter-/ressortübergreifende Arbeitsgruppen eingerichtet worden. Gebietsbeauftragte im weitesten Sinne oder Arbeitsgruppen, die diese Aufgabe wahrnehmen, sind lediglich in fünf Kommunen nominiert worden (Flensburg, Halle, Leipzig, Ludwigshafen, Schwerin).
Steuerungsgremien auf Verwaltungsebene sind in der Regel durch Vertreterinnen und Vertreter der federführenden Verwaltungsstellen sowie der für die Programmumsetzung zuständigen Dezernate und/oder Ämter besetzt. In Cottbus, Flensburg, Leinefelde, Neunkirchen, Nürnberg, Schwerin und Singen ist darüber hinaus die Wohnungswirtschaft beteiligt. In Leipzig wurde der "Beirat Integrierte Stadtteilentwicklung" eingerichtet, der Empfehlungen für den Einsatz von Fördermitteln aus den Programmen Soziale Stadt, URBAN und EFRE ausspricht; neben Verwaltungsakteuren sind auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, von Vereinen und Verbänden sowie das Arbeitsamt beteiligt. Nicht in jeder am Programm teilnehmenden Kommune sind die Steuerungsgremien mit allen involvierten Ämtern besetzt. Hier stellt sich die Frage, ob der Anspruch des Programms Soziale Stadt erfüllt werden kann, eine integrierte Quartiersentwicklung mit einem möglichst breiten Spektrum von Handlungsfeldern ressortübergreifend zu unterstützen, wenn die Abstimmungs- und Steuerungsarbeit auf Verwaltungsebene im Kern von nur wenigen Ressorts übernommen wird.
Die meisten PvO-Teams betonen, dass für die Wirksamkeit von Quartiermanagement die Überwindung von Ressortgrenzen und der Aufbau kooperativer Strukturen auf der Verwaltungsebene von zentraler Bedeutung sind. Insoweit wird allerdings vielfach noch Nachholbedarf konstatiert; so kommt das PvO-Team für Cottbus - Sachsendorf-Madlow zu dem Schluss: "Das tatsächliche kooperative und integrierte Arbeiten bedarf noch kommunikativer und ideeller Unterstützung, um Ressortegoismus und Konkurrenz zu überwinden. Das Bewusstsein ressortübergreifender Verantwortung der Verwaltungsspitze für das Programm ,Soziale Stadt' muss noch verstärkt werden." (2) Und für das Modellgebiet Kassel - Nordstadt heißt es: "Das Steuerungsmodell funktioniert immer dann, wenn zwischen den beteiligten Fachämtern und Dezernaten win/win-Situationen hergestellt werden können oder Ressourcen- und Interessenkonflikte durch ausreichende Mittelausstattung und klare Zuständigkeitsregelungen vermieden werden können. Der integrierte Handlungsansatz ... stößt dann an seine Grenzen, wenn im Verfahren Zielkonflikte auftreten und kein Konsens hergestellt werden kann. Eine Veränderung von Entscheidungsabläufen stößt auf tradierte Denkweisen und Arbeitsstrukturen. Die ressortspezifischen Sicht- und Handlungsweisen lassen sich langsamer umwandeln als integrierte Konzepte es erfordern." (3)
Insgesamt erweist es sich für Quartiermanagement auf der Verwaltungsebene als sinnvoll, dass die Vernetzungs- und Bündelungsarbeit bei der oder dem Gebietsbeauftragten liegt - dies unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit, eine solche Koordinierungsstelle einzurichten oder zumindest Personalkapazitäten für entsprechende Aufgaben freizustellen -, während für das Management von Einzelprojekten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen beteiligten Ressorts verbindlich verantwortlich sein sollten, um die oder den Gebietsbeauftragte(n) nicht mit dem operativen Geschäft der Programmumsetzung Soziale Stadt zu überlasten (4) . Außerdem zeigen die Erfahrungen, dass die Gremien mit entscheidungsbefugten Teilnehmerinnen und Teilnehmern besetzt sein müssen, um ohne Rücksprache mit den vertretenen Verwaltungseinheiten oder Institutionen beschluss- und handlungsfähig zu sein.
![]() Quartiermanagement im intermediären Bereich
Quartiermanagement im intermediären Bereich
Die in der zweiten Difu-Befragung am häufigsten genannten Quartiermanagement- Gremien im intermediären Bereich sind themenbezogene Arbeitsgruppen oder -kreise sowie Workshops, Foren und Runde Tische. In gut der Hälfte der Gebiete werden Stadtteilkonferenzen veranstaltet. Eine Stadtteilmoderatorin oder ein Stadtteilmoderator wurde in knapp der Hälfte der Gebiete eingesetzt:
|
Tabelle 17: Management- und Organisationsformen im intermediären Bereich (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
||
|
Management- und Organisationsformen |
Nennungen |
|
|
abs. |
% |
|
|
Themenbezogene Arbeitsgruppen oder -kreise |
168 |
75,7 |
|
Workshops, Foren, Runde Tische |
167 |
75,2 |
|
Stadtteilkonferenz |
127 |
57,2 |
|
Stadtteilmoderator/in |
105 |
47,3 |
|
Andere |
42 |
18,9 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
||
Die Aufgaben und Zuständigkeiten dieser Gremien ähneln sich in weiten Teilen. Bei themenbezogenen Arbeitsgruppen/-kreisen, Workshops, Foren und Runden Tischen wurden Aktivierung und Beteiligung sowie Projektentwicklung am häufigsten genannt. Für Stadtteilkonferenzen, Stadtteilmoderatorinnen und -moderatoren kommen steuernde und koordinierende Aufgaben hinzu.
|
Abbildung 79: Gremien und Zuständigkeiten im intermediären Bereich (Zweite Befragung Difu 2002)* |
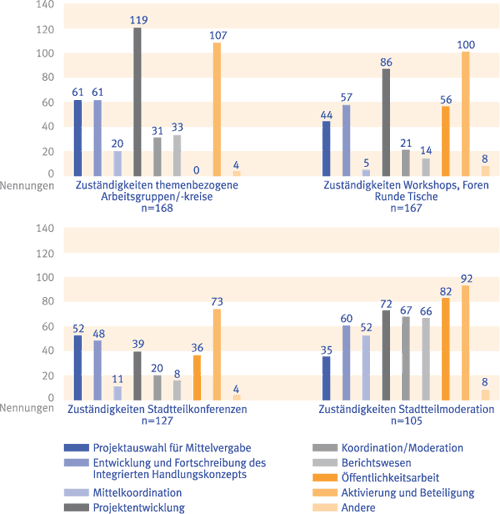 |
|
* In dieser Übersicht wurden die Umfrageergebnisse zum Thema Gremien und Aufgaben im intermediären Bereich zusammengefasst. Da auf Fragen in jeder Kategorie unterschiedlich viele Kommunen geantwortet haben, liegen hier drei unterschiedliche Grundgesamtheiten (n) zugrunde. |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Auch in drei Vierteln der Modellgebiete ist der intermediäre Bereich Bestandteil von Quartiermanagement, wenngleich in unterschiedlicher Form und Intensität: Stadtteilkonferenzen oder ähnliche übergreifende Informations- und Diskussionsforen zu grundsätzlichen Abstimmungsfragen für ein breites Akteursspektrum werden lediglich in neun Gebieten angeboten. In den restlichen drei Modellgebieten finden Abstimmungen in vergleichsweise geschlossenen, überwiegend mit professionellen Akteuren besetzten Gremien statt. Somit sind in sieben Modellgebieten keine (öffentlichen) Beteiligungsplattformen im intermediären Bereich eingerichtet worden. Demnach sind in den Modellgebieten dezernats- und ämterübergreifende Steuerungsgremien in der Verwaltung sowie Vor-Ort-Büros im Quartier stark vertreten, während die Beteiligung möglichst vieler lokal relevanter Akteure (5) im intermediären Bereich vielfach noch verbesserungswürdig erscheint.
![]() Quartiermanagement auf der lokalen Umsetzungsebene
Quartiermanagement auf der lokalen Umsetzungsebene
Auf der Quartiersebene sind in rund 80 Prozent der Gebiete Vor-Ort- oder Stadtteilbüros eingerichtet worden. Die Aufgaben der hier tätigen Fachkräfte liegen vor allem in den Bereichen Aktivierung und Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Moderation, Projektentwicklung sowie Berichtswesen. Vor-Ort-Büros werden häufig nicht nur vom lokalen Quartiermanagement, sondern auch als Treffpunkte für Vereine und (Interessen-)Verbände, als allgemeine Bürgertreffs (in einigen Fällen mit Quartierscafé) und/oder als Beratungsstellen genutzt.
Vor-Ort-Büros werden offenbar von der großen Mehrheit der Programmbeteiligten inzwischen als unverzichtbare Voraussetzung für die konkrete Stadtteilarbeit betrachtet. "Als wichtig für die Arbeit des Quartiersmanagements werden ,Offenheit und Zuhören-Können', die ,regelmäßige Besetzung des Stadtteilladens' und die ,Kontinuität der Personen vor Ort' angesehen." (6) Wenn möglich, sollten bereits vor Ort tätige Akteure - Netzwerke, Institutionen - die Aufgabe des lokalen Quartiermanagements übernehmen oder zumindest in dessen Arbeit integriert werden. Ein positives Beispiel hierfür ist die Einrichtung des "lokalen Managements" Anfang des Jahres 2002 in Bremen - Gröpelingen; diese Aufgabe wurde von einem Mitarbeiter des Amtes für soziale Dienste übernommen, der auch schon vor Beginn der Programmumsetzung Soziale Stadt vor Ort tätig war und das Quartier seit langer Zeit kennt (7) . Auf jeden Fall ist der Aufbau parallel arbeitender und daher konkurrierender Quartiermanagement-Strukturen zu vermeiden, wie bereits auf dem Impulskongress Quartiermanagement festgestellt wurde (8) .
|
||||||||
|
von links nach rechts: Abbildung 81: Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt (Foto: Stadt Leinefelde) Abbildung 82: Stadtteilbüro Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord (Foto: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |
Abbildung 83: Stadtteilbüro Ludwigshafen Westend (Foto: Stadt Ludwigshafen) Abbildung 84: Stadtteilbüro Schwerin Neu Zippendorf (Foto: Stadt Schwerin) Abbildung 85: Hinweis auf das Stadtteilbüro des Quartiersmanagements Berlin-Prenzlauer Berg Helmholtzplatz (Foto: Wolf-Christian Strauss , Berlin) |
Das persönliche Engagement und die Identifikation von Quartiermanagerinnen und -managern mit den komplexen Aufgaben integrierter Quartiersentwicklung können kaum erfolgreich sein, wenn in den Kommunen nicht zumindest mittelfristig die zur Absicherung der Quartiermanagement-Tätigkeiten notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen garantiert sind. Dies scheint in vielen Kommunen ebenso eingeschätzt zu werden (9) , denn die Verträge von mehr als einem Drittel der hauptverantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufen ein bis drei Jahre, von einem guten Drittel sogar über einen längeren Zeitraum. Auf der anderen Seite enden solche Verträge im verbleibenden knappen Drittel der Gebiete nach maximal einem Jahr, was sich unter Umständen kontraproduktiv auf die Arbeit vor Ort und das Erzielen von Erfolgen auswirkt.
|
Abbildung 86: Aufgaben auf der Quartiersebene (n=182, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
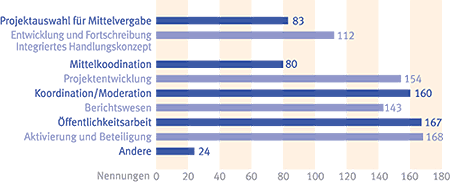 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Als Arbeitgeber für das Quartiermanagement vor Ort werden am häufigsten freie/private Träger sowie die Kommunen genannt. Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt in gut der Hälfte der Gebiete (130 Gebiete) aus Mitteln des Programms Soziale Stadt, in einem knappen Drittel (69 Gebiete) aus anderen kommunalen Mitteln. Ein ähnliches Verhältnis gilt für die Finanzierung von Miet- und Sachkosten der Stadtteilbüros. In Niedersachsen und Sachsen sind auch Sanierungsträger vergleichsweise oft an der Finanzierung von Personal beteiligt (Niedersachsen: 6 von 23 Gebieten, Sachsen: 3 von 9 Gebieten). In Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz wird das Programm Soziale Stadt häufiger als in den anderen Bundesländern als Finanzierungsquelle genannt.
|
Abbildung 87: Stadtteilbüro: Finanzierung von Personal-, Miet- und Sachkosten (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |
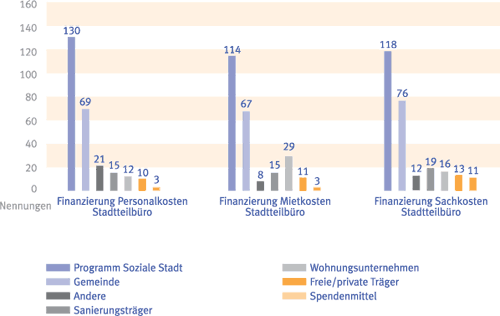 |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
![]() Zusammenwirken der drei Quartiermanagement-Ebenen
Zusammenwirken der drei Quartiermanagement-Ebenen
Die Kooperation der drei Quartiermanagement-Ebenen muss vor dem Hintergrund der Unterschiede zwischen "Systemwelt" und "Lebenswelt" gestaltet werden, die sich unter anderem im Problem "zweier Geschwindigkeiten" äußern: dem durch die Antragstellung auf Fördermittel entstandenen zeitlichen Vorlauf der Verwaltung, ihrer zeitlichen Gebundenheit durch Vorgaben des Haushaltsrechts zur Jährlichkeit des Mitteleinsatzes und ihrem Zwang zu Planungseffizienz sowie zur Einhaltung von Programmlaufzeiten und Bewilligungszeiträumen stehen die Prozesshaftigkeit, Eigendynamik, Komplexität und damit meist deutlich unterschiedliche Geschwindigkeiten im intermediären Bereich, vor allem auf der Quartiersebene, gegenüber (10) .
Unter anderem aufgrund dieser Problematik ist es neben der jeweiligen Organisation der drei Bereiche unerlässlich, auch die Zusammenarbeit zwischen diesen Ebenen sowohl vertraglich als auch über formelle und informelle Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zu regeln ("Schnittstellenmanagement") (11) . Dies ist auch wichtig, weil einige Aufgaben zugleich auf mehreren Ebenen wahrgenommen werden. So können beispielsweise sowohl die Gebietsmoderatoren (intermediärer Bereich) als auch die vor Ort tätigen Fachleute in die Organisation des Stadtteilbüros involviert sein. An der Organisation und Moderation von Veranstaltungen ist neben der Gebietsmoderatorin oder dem Gebietsmoderator im intermediären Bereich oftmals auch die Verwaltung beteiligt, was zumindest dann zu (Loyalitäts-) Konflikten führen kann, wenn beispielsweise die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Stadtteilforums etwas "gegen" die Verwaltung durchzusetzen versuchen, die oder der Forumsvorsitzende - gewissermaßen das "Sprachrohr" des Gremiums - aber selbst Verwaltungsmitarbeiterin oder -mitarbeiter ist. Dies wird spätestens dann zum Problem, wenn im Plenum keine entscheidungsbefugten Delegierten aus der Verwaltung vertreten sind, die direkt angesprochen werden können.
Die vertikale Vernetzung zwischen den drei Ebenen erfolgt in den meisten Modellgebieten durch die Teilnahme von Vor-Ort-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern an Verwaltungsgremien oder - umgekehrt - die Beteiligung von Politik und Verwaltung an lokalen und intermediären Foren; sie ist damit nicht im Sinne eines "Schnittstellenmanagements" gesondert geregelt. So heißt es beispielsweise für Hamburg- Altona - Lurup: "Während die Organisationsstrukturen vor Ort ... als umfassendes soziales Netzwerk zu bezeichnen sind, in dem Arbeitsteilungen und Themenschwerpunkte sowie deren Verknüpfung in weiten Teilen bereits selbsttragend funktionieren, erweist sich die Verknüpfung der Vor-Ort-Ebene mit der Ebene der Verwaltungsorganisationen, insbesondere der Fachbehördenebene noch als entwicklungsbedürftig. Das unter anderem mit dieser Aufgabe betraute [lokale] Quartiersmanagement hat ... zu wenig Ressourcen und Durchsetzungskraft, um eine umfassende Verknüpfung dieser Ebenen zu leisten." (12) Der Aufbau kooperativer Strukturen zwischen Verwaltung und den anderen Ebenen stellt sich auch für Flensburg - Neustadt als große Herausforderung dar: "Es hat sich im Laufe der ... Zeit erwiesen, dass die Rollenverteilung zwischen ... [einzelnen Fachbereichen und] dem Stadtteilmanagement ... als Daueraufgabe konstruktiv klar definiert werden muss. Aufgrund ... des hohen integrativen Anspruchs des Programms ,Soziale Stadt' ergeben sich immer wieder thematische Überschneidungen. Dann ist es hilfreich, sich auf ein genau verabredetes Kooperations- System beziehen zu können." (13)
Im intermediären Bereich erscheint es notwendig, das Verhältnis zwischen Gebietsmoderatorin oder -moderator und Verwaltung formal und inhaltlich zu klären, um beispielsweise im Konfliktfall zwischen beiden Bereichen keine Loyalitätsprobleme der jeweils im Rahmen von Quartiermanagement verantwortlichen Akteure entstehen zu lassen. Eine solche Regelung kann mittels einer vertraglichen Vereinbarung erzielt werden. Gleiches gilt für die Regelung des Verhältnisses von intermediärem Bereich und Quartiersebene - auch hier erscheint es sinnvoll, Aufgaben und Formen der Zusammenarbeit über Verträge und Qualitätsvereinbarungen festzuschreiben (14) . Intermediäre und lokale Arbeitsgremien benötigen außerdem Entscheidungsbefugnisse und materielle Ressourcen, um Beschlüsse zeitnah umsetzen zu können. Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang Verfügungsfonds (15) , für die ebenfalls Regeln zur Entscheidung über die Mittelvergabe aufgestellt werden müssen.
|
Abbildung 88: Steuerungsmodell des Nordstadt-Projekts in Kassel* |
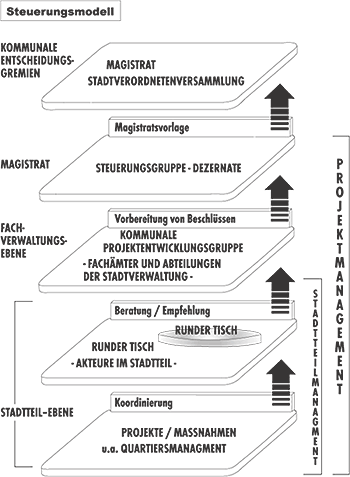 |
|
* Quelle: Kommunale Arbeitsförderung, Stadt Kassel |
Ein Beispiel für die Regelung der Zusammenarbeit der drei Quartiermanagement- Ebenen findet sich im Modellgebiet Kassel - Nordstadt. Dort entscheidet eine dezernatsübergreifende Steuerungsgruppe auf Grundlage der Zeit- und Mittelplanung über Prioritäten für die Projektumsetzung. Grundlage für diese Entscheidungen, die vom Magistrat berücksichtigt werden, sind Empfehlungen der Kommunalen Projektentwicklungsgruppe (entspricht einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe, mithin der operativen Verwaltungsebene). Diese wiederum orientiert sich an den Arbeitsergebnissen des Runden Tisches aus dem intermediären Bereich. Eine intensive Verzahnung unterschiedlicher Entscheidungs- und Beratungsgremien ist auch für die Modellgebiete Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke- Nord, Halle - Silberhöhe, Leipziger Osten und Ludwigshafen - Westend entwickelt worden.
(1) Eine Antwortmöglichkeit auf die Frage, welche Gremien auf Verwaltungsebene eingerichtet worden sind, lautete "Stadtteil- oder Quartiermanager/innen". Diese Möglichkeit wurde von den Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern zwar am häufigsten genannt; allerdings scheint es hier in vielen Fällen zu einem Missverständnis gekommen zu sein: sowohl die Zahl der Nennungen als auch die Angaben bezüglich der Zuständigkeitsbereiche dieser Funktionsträger weisen sehr große Ähnlichkeiten mit den Antworten zur Quartiersebene auf. Es ist daher davon auszugehen, dass bei den Angaben zur Rubrik "Stadtteil- oder Quartiermanager/innen" die jeweilige Steuerungs- oder Handlungsebene oftmals nicht beachtet, sondern pauschal im Sinne eines generellen "Ja" oder "Nein" geantwortet wurde. Daher wurde diese Rubrik nicht berücksichtigt. ![]()
(2) Knorr-Siedow/Jahnke/Trostorff, S. 105. ![]()
(3) Mussel/Kreisl, S. 82. ![]()
(4) Vgl. Franke/Grimm, Quartiermanagement, S. 5 ff. ![]()
(5) Dazu gehören Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, lokale oder lokal tätige Vereine, Organisationen, Initiativen und Träger, Schulen, Kirchen, Gewerbetreibende, Hauseigentümer und Wohnungsunternehmen, die Polizei usw. ![]()
(6) Mussel/Kreisl, S. 58. ![]()
(7) Franke/Meyer, S. 54 f. ![]()
(8) Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Quartiermanagement, S. 65 (AG 3 b: Aktivierung der Bevölkerung). ![]()
(9) Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Programmgebiete, für die Angaben zu Vertragslaufzeiten der im Stadtteilbüro Beschäftigten gemacht wurden (insgesamt 122 Gebiete = 55 Prozent). ![]()
(10) Böhme/Franke, Programmbegleitung, S. 65. ![]()
(11) Vgl. Franke/Grimm, Quartiermanagement, S. 8. ![]()
(12) Breckner und andere, S. 115. ![]()
(13) Frinken/Rake/Schreck, S. 91. ![]()
(14) Franke/Grimm, Quartiermanagement, S. 8 und S. 12. ![]()
(15) Vgl. Kapitel 8. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005





