soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Impulsreferat in der Arbeitsgruppe 11:
Qualitätsmerkmale Integrierter Handlungskonzepte für benachteiligte Stadtgebiete
Matthias Sauter, Arbeitsgruppe Bestandsverbesserung der Universität Dortmund
Spätestens seit dem Start des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" im Jahr 1999 sind Integrierte Handlungskonzepte oder -programme für benachteiligte Stadtgebiete zu einem bundesweit anerkannten Instrumentarium einer sozial orientierten Stadterneuerungspolitik geworden. Konzeptionelle Vorreiter waren hier - neben einzelnen Städten - vor allem das Land Nordrhein-Westfalen mit seinem 1993 beschlossenen ressortübergreifenden Handlungsprogramm "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" sowie der Stadtstaat Hamburg mit dem so genannten "Armutsbekämpfungsprogramm" (1994-1998). Andere Bundesländer (vor allem Bremen, Berlin und Hessen) folgten diesen Beispielen mit einem gewissen zeitlichen Abstand.
Abbildung 1: Bund-Länder-Programm "Die Soziale Stadt"
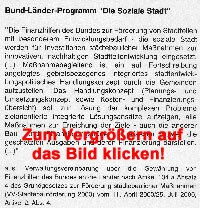 |
Inzwischen sind zahlreiche Städte in Deutschland dazu übergegangen, ihre Aktivitäten zur Stabilisierung und Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete mit Hilfe von Integrierten Handlungskonzepten zu koordinieren und die vor Ort verfügbaren Ressourcen in Form so genannter "Mehrzielprojekte" zu bündeln. Allein im Rahmen des nordrhein-westfälischen Landesprogramms werden derzeit 33 solcher Gebiete in 25 Städten mit zum Teil erheblichen öffentlichen Mitteln gefördert. In Bezug auf ihre Organisationsform weisen diese Stadtteilprogramme in der Regel folgende Gemeinsamkeiten auf:
- Einrichtung eines zeitlich befristeten "Sonderprojektes" innerhalb der kommunalen Verwaltungsstruktur,
- überwiegende Finanzierung der Erneuerungsaktivitäten über staatliche Fördermittel,
- Gründung einer ämterübergreifenden Koordinierungsgruppe zur verwaltungsinternen Abstimmung der Programme,
- Aufbau und Stärkung von bewohner- und akteursgetragenen Stadtteilgremien,
- Einrichtung eines dezentralen Stadtteil- und/oder Quartiersmanagements als "Motor" des örtlichen Entwicklungsprozesses.
Abbildung 2: Integrierte Handlungskonzepte - eine Definition
 |
Bei allen Unterschieden im Detail (z.B. in Bezug auf die Frage, was Stadtteil- oder Quartiersmanagement leisten kann und soll) besteht die wesentliche Aufgabe integrierter Stadtteilprogramme in der gebietsbezogenen Verknüpfung von städtebaulichen, infrastrukturellen, sozialen, ökonomischen, kulturellen und umweltbezogenen Aktivitäten, um auf diese Weise - so die Hoffnung - einen "synergetischen Mehrwert" gegenüber den herkömmlichen sektoralen Handlungsansätzen zu erzeugen und damit die Wirksamkeit der Gesamtmaßnahme entscheidend zu verbessern. Im Idealfall bedeutet dies z.B., dass in den betreffenden Gebieten Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen mit Projekten der Stadterneuerung und bestandsorientierten Aktivitäten der Wohnungswirtschaft verknüpft werden, dass Schulen mit dem Arbeitsamt und der örtlichen Wirtschaft kooperieren, um "Brücken zum formellen Arbeitsmarkt" zu errichten, dass die kommunale Wirtschaftsförderung die Stärkung lokal-ökonomischer Strukturen als strategisch bedeutsames Handlungsfeld versteht, und dass örtliche Infrastruktureinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen ihre Räumlichkeiten auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für soziale und kulturelle Aktivitäten der Stadtteilbevölkerung zur Verfügung stellen.
Abbildung 3: Handlungsfelder integrierter Stadtteilprogramme
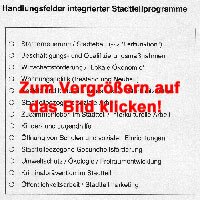 |
Für eine bundesweite Bewertung der Wirkungen gebietsbezogener Handlungsprogramme ist es noch zu früh. Das Bund-Länder-Programm "Die soziale Stadt" befindet sich erst in seinem dritten Jahr. Dementsprechend ist die Mehrzahl der Erneuerungsprojekte, die in diesem Zeitraum initiiert werden konnten, noch nicht abgeschlossen. Lediglich Nordrhein-Westfalen und Hamburg - sowie mit einigen Abstrichen auch Berlin, Bremen und Hessen - können auf längere Erfahrungen mit integrierten Stadtteilprogrammen zurückblicken. Zu den positiven Veränderungen, die dort zu beobachten sind, zählen insbesondere die bauliche und städtebauliche Aufwertung der betroffenen Gebiete, die Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastrukturangebote, die Schaffung zusätzlicher - in der Regel allerdings zeitlich befristeter - Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie die Beteiligung der Bewohnerschaft an der Planung und Umsetzung der verschiedenen Erneuerungsaktivitäten.
Abbildung 4: Erfolge integrierter Stadtteilprogramme
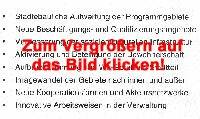 |
Der Erfolg oder Misserfolg integrierter Erneuerungsansätze hängt von mehreren Faktoren ab. Neben der Rückendeckung durch die gesamtstädtische Politik, dem Umfang der verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen und dem Engagement der beteiligten Akteure ist dabei vor allem die Qualität der jeweiligen Stadtteilprogramme selbst von entscheidender Bedeutung. Gerade hier sind in der Praxis allerdings erhebliche Unterschiede festzustellen. So sind manche Handlungskonzepte kaum mehr als eine additive Zusammenstellung von sektoralen Maßnahmen und Projekten, während sich andere Konzepte durch komplexe und ressortübergreifend angelegte Entwicklungsstrategien auszeichnen. Zu den Merkmalen solcher "Qualitätskonzepte" gehört es in der Regel, dass sie zwischen den analytischen Bezugsebenen "Planung", "Handlung" und "Resultat" unterscheiden und zu jeder der drei Ebenen differenzierte Aussagen machen. Wesentliche Leitfragen für diese Betrachtungsweise sind unter anderem:
- Welche Veränderungen sollen im Programmgebiet erreicht werden (Impact/Outcome)?
- Welche (Verwaltungs-)Leistungen müssen zu diesem Zweck erbracht werden (Output)?
- Von wem und auf welchem Weg sollen die angestrebten Leistungen erbracht werden (Throughput/Implementation)?
- Welche Ressourcen können/sollen für welche Aufgaben eingesetzt werden (Input)?
- Wie kann der Erfolg des Gesamtprogramms und seiner einzelnen Maßnahmen und Projekte gemessen werden (Controlling/Evaluation)?
Abbildung 5: Integrierte Handlungskonzepte - Bezugsebenen
 |
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen werden im Folgenden die wichtigsten Strukturelemente erläutert, die Integrierte Handlungskonzepte für benachteiligte Stadtgebiete enthalten sollten.
- (1) An vorderster Stelle zu nennen ist hier - neben einer gesamtstädtisch hergeleiteten Gebietsauswahl (Sozialraum-Monitoring!) - eine fundierte Analyse der Stärken und Schwächen des jeweiligen Erneuerungsgebiets (z.B. im Rahmen einer SWAT-Analyse).
- (2) Unverzichtbar sind zudem die Darstellung eines konsistenten Zielsystems und die Festlegung von geeigneten Indikatoren zur Bewertung der Programmergebnisse und -wirkungen.
- (3) Darauf aufbauend sollten die Strategien und Handlungsschwerpunkte beschrieben werden, mit deren Hilfe der Erneuerungsprozess initiiert und vorangetrieben werden soll. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage, wie die Erfolge des Programms auch nach dem Ende der staatlichen Sonderförderung dauerhaft gesichert werden können ("Verstetigungsstrategie").
- (4) Essenzielle Konzeptbausteine sind außerdem konkrete Aussagen zur Organisationsstruktur (Federführung, beteiligte Verwaltungsressorts, Stadtteilmanagement usw.) und zur Programmsteuerung (Koordination, Ressourcenbündelung, Controlling usw.).
- (5) Erst auf der Grundlage dieser Angaben sollten dann diejenigen Projekte und Maßnahmen erläutert werden, die für die erste (!) Phase des Stadtteilprogramms vorgesehen sind. Die Projektvorschläge für spätere Programmphasen sollten hingegen erst im weiteren Prozessverlauf entwickelt werden, um genügend Spielräume für eine beteiligungsorientierte Programmqualifizierung (siehe unten) zu eröffnen.
- (6) Zu den Schlüsselinformationen Integrierter Handlungskonzepte gehört darüber hinaus eine Übersicht über Art und Umfang der Finanzmittel, die für die verschiedenen gebietsbezogenen Aktivitäten (voraussichtlich) zur Verfügung stehen werden. Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang darzulegen, wie mögliche Unterhalts- und Folgekosten der Projekte nach dem Ende des Programms aufgebracht werden können "(finanzielle Nachhaltigkeit").
Abbildung 6: Integrierte Handlungskonzepte - Strukturelemente
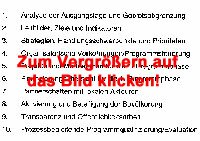 |
Die sechs genannten Strukturelemente entsprechen im Prinzip - auch wenn sie keineswegs durchgängig Berücksichtigung finden - der "klassischen" Logik eines rationalen und zielorientierten Verwaltungshandelns. Angesichts der Komplexität der Herausforderungen in benachteiligten Stadtgebieten genügt dies jedoch nicht. Notwendig ist vielmehr, dass diese administrative Binnenperspektive systematisch um verwaltungsexterne Sichtweisen und Kompetenzen ergänzt wird.
- (7) Dies kann insbesondere dadurch geschehen, dass in den Handlungskonzepten verdeutlicht wird, mit welchen privaten Akteursgruppen (Wohnungsgesellschaften, Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Wohlfahrtsverbände, Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden usw.) die Stadt im Rahmen des Erneuerungsprozesses zusammenarbeiten möchte und wie solche "lokalen Partnerschaften" konkret aussehen könnten.
- (8) Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei auch auf die Frage gerichtet werden, wie die örtliche Bevölkerung aktiv in den Prozess der Stadtteilentwicklung eingebunden werden kann und welche Entscheidungskompetenzen an bewohnergetragene Gremien (Stadtteilforen, Runde Tische, Beiräte usw.) übertragen werden sollen.
- (9) Eine derartige akteurs- und bewohnerorientierte Vorgehensweise erfordert zudem eine professionelle gebiets- und programmbezogene Öffentlichkeitsarbeit, die in ihren Grundzügen ebenfalls auf Konzeptebene beschrieben werden sollte.
- (10) Zu den zentralen Aufgaben Integrierter Handlungskonzepte gehört es schließlich, inhaltliche und organisatorische Rahmenbedingungen für eine prozessbegleitende Evaluation der Stadtteilprogramme durch externe Fachleute zu benennen. Aufgabe solcher Evaluationen sollte es sein, kontinuierlich quantitative und qualitative Erkenntnisse über den Verlauf und die Wirkungen der Erneuerungsaktivitäten zu gewinnen, die von den verantwortlichen Akteuren zur Ergänzung und Weiterentwicklung der jeweiligen Handlungskonzepte genutzt werden können ("permanente Programmqualifizierung").
|
Quelle: Impulskongress Integratives Handeln für die soziale Stadtteilentwicklung, Dokumentation der Veranstaltung am 5. und 6. November 2001 in Essen (Veranstalter: Deutsches Institut für Urbanistik, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) in Kooperation mit Viterra, Essen), Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, 2002 |
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005