soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Die Stabilisierung von Stadtquartieren -
Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"
Dr. Rolf-Peter Löhr,
Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
I. Vorbemerkung
|
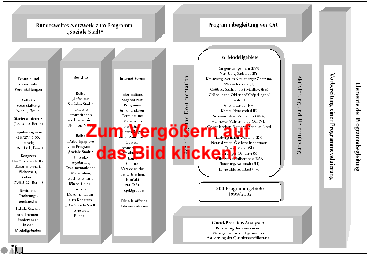 |
Abbildung 1: Elemente der Programmbegleitung |
Abbildung 2: Handlungsfelder der Projektdatenbank zum Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt"
|
3. Gebietstypisierung 
50 Prozent der in das Programm Soziale Stadt aufgenommenen Gebiete befinden sich in Städten mit über 100 000 Einwohnern, 40 Prozent in Städten zwischen 20 000 und 100 000 Einwohnern und zehn Prozent sogar in noch kleineren Städten. Soziale Stadt ist also keineswegs ein Großstadtprogramm, sondern die von ihm aufgegriffene Problematik, diese soziale Segregation zeigt sich auch in vielen kleineren Städten und Gemeinden, und der Handlungsansatz ist deshalb überall gefordert.
Von der baulichen Struktur her handelt es sich bei den Gebieten um Großsiedlungen am Stadtrand, Altbauquartiere eher in Innenstadtnähe, zum Teil auch gemischte Quartiere.
Der Ausländeranteil und der Anteil an Sozialhilfeberechtigten ist vielfach doppelt so hoch wie in der Gesamtstadt; dies gilt auch für den Anteil an Kindern und Jugendlichen. Das liegt zum Teil an den ausländischen Haushalten, aber auch daran, dass deutsche Familien mit vielen Kindern ebenfalls besonders armutsgefährdet sind und häufig nur in solchen benachteiligten Quartieren eine Wohnung finden.
4. Ziel und Handlungsansätze 
Ziel des Programms Soziale Stadt ist, die Abwärtsspirale in den benachteiligten Quartieren zu stoppen und eine positive, selbsttragende Entwicklung einzuleiten. Um diesem Ziel näher zu kommen, verfolgt das Programm drei Ansätze:
Der erste Ansatz hat einen Verwaltungs- und Politikbezug, das heißt, es muss sich etwas in der Verwaltung und der Art der Politik ändern. Es wird nicht so sein, dass man mit den Mitteln wie bisher weiterarbeiten kann, deswegen sind das Entscheidende die Querschnittsorientierung, die Ressortkooperation, die Mittelbündelung, ein integriertes Handlungskonzept. Da die Menschen im Mittelpunkt stehen und sie komplexe Probleme haben, muss auch die Antwort darauf eine komplexe sein. Man muss in besonderer Weise zusammenarbeiten, und es ist nicht damit getan, mit spezialisierten Angeboten für enge, spezielle Zwecke etwas zu bewegen. Zum Beispiel müssen Schulen, die ja eine ganz wichtige Rolle haben, aber in vielen dieser Gebiete an der Entwicklung nicht beteiligt sind, unbedingt einbezogen werden. Dasselbe gilt für Gesundheitsfragen, für Umwelt, für soziale Arbeit, Jugendhilfe, Barrierefreiheit.
Bemerkenswert ist, dass es in anderen Politikbereichen eine ähnliche, auf Integration und Kooperation angelegte Entwicklung gibt. Im Bereich Gesundheit gibt es die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation von 1987, die Gesundheit als Wohlergehen, als Wohlbefinden definiert, das heißt, es kommt darauf an, dass man nicht nur manifeste Krankheiten in den Blick nimmt, sondern die gesamte Lebenssituation des Menschen betrachtet und wie man ihm hier helfen kann. Und man stellt fest, dass viele Menschen zwölfmal im Jahr oder öfter zum Arzt gehen, es ihnen aber nicht besser geht, weil die Bedingungen, unter denen sie krank werden, nicht geändert werden. Es geht um mehr als Krankheitsbehandlung; integrierte Gesundheitsförderung tut Not, wie sie die Weltgesundheitsorganisation WHO unter anderem mit ihrem Programm .Gesundheit 21. fordert. Sie knüpft damit schon von ihrem Titel her an die bekannteste Forderung eines integrierten Ansatzes an, nämlich an die Agenda 21, die eine nachhaltige Entwicklung nur bei einer Zusammenschau und Kooperation der drei Handlungsbereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales als möglich ansieht.
Der zweite Ansatz ist der Quartierbezug, also die Orientierung an einem bestimmten Gebiet, das in irgendeiner Weise abgegrenzt ist, und nicht die Beschränkung auf eine bestimmte Zielgruppe. Diese Gebietsabgrenzungen stellen ein Problem dar, und wir sind damit nicht immer sehr glücklich: Manchmal sind die Gebiete viel zu groß, haben an die 100 000 Einwohner, andere dagegen sind sehr klein und haben nur 3 000 oder noch weniger Einwohner. Irgendwo dazwischen sollte die Einwohnerzahl schon liegen, da man sonst gar keine eigenständige lokale Entwicklung initiieren kann.
Der lokale Bezug wird viel diskutiert. Es gibt viele Soziologen, die sagen, dass die Menschen heute in den Städten nicht mehr auf ein Quartier, auf einen Stadtteil bezogen sind, sondern in der ganzen Stadt leben und diese im Grunde wie Touristen konsumieren. Wo sie gerade wohnen und leben, ist eigentlich egal. Wenn man sieht, wie häufig Familien und viele Haushalte umziehen, dann könnte man denken, dass man dahin zieht, wo es gerade .in" ist, wo es modern ist, aber eine Beziehung zum Quartier hat man nicht. Stadtentwicklung müsse daher immer gesamtstädtisch oder gar regional ansetzen. Dies ist sicherlich eine richtige Beobachtung, die aber nur für einen Teil der Bevölkerung gilt. Für die Menschen in den Quartieren der Sozialen Stadt ist es zum großen Teil ganz anders, weil sie gar keine Möglichkeit haben, in ein anderes Gebiet zu ziehen. Sie kommen aus ihrem Gebiet häufig nicht hinaus, vor allem die Kinder, aber auch viele Erwachsene, besonders viele Mütter. Das ist ihre Lebenswelt, und wenn man für die Menschen etwas tun will, dann muss man etwas für das Quartier tun. Nur auf Quartiersebene lassen sich zum Beispiel Bürgermitwirkung und der Aufbau des für eine positive Quartiersentwicklung so wichtigen sozialen Kapitals organisieren.
Auch der Aufbau lokaler Ökonomie, um den Menschen in den benachteiligten Quartieren eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben, bedarf der örtlichen Fokussierung. Es ist der traditionelle Ansatz der Wirtschaftsförderung, Gewerbegebiete bereitzustellen und besonders Hightech zu fördern. Ein anderer, viel mühsamerer, schwierigerer und für viele Wirtschaftsförderer ungewohnter Weg ist es, etwas für die vielen kleinen, unscheinbaren Unternehmen mit zehn oder weniger Beschäftigten zu tun, Existenzgründung in diesem Feld zu fördern. Das passt zu der Sanduhr, von der ich vorhin sprach: Auch im unteren Bereich wachsen trotz einer hier nicht hilfreichen Arbeitsmarktpolitik Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten, mit denen man sicherlich nicht reich wird, aber durchaus seinen Lebensunterhalt verdienen und zufrieden sein kann. Aber auch hier bedarf es der Beratung und der Förderung der Unternehmen wie der Menschen selbst.
Der dritte Ansatz ist die Bürgermitwirkung, die im Mittelpunkt des Programms steht und mit der herausgehobenen Rolle, die sie den Bürgerinnen und Bürgern zukommen lässt, das wirklich Neue darstellt. Bürgerbeteiligung im traditionellen Sinn ist ein sehr unzulänglicher Ansatz, es bedarf vielmehr der Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger bei der Zielentwicklung, Planung und Entscheidung. Dies ist ein Prozess, der oft einen langen Vorlauf erfordert und für den es mehr braucht als nur eine Postwurfsendung, die zur Bewohnerversammlung einlädt. Damit erreicht man nur die .Berufsbürger" und die anderen gar nicht. Werden innovative Methoden wie etwa Planungszelle oder Bürgergutachten eingesetzt, stellt sich heraus, dass die Menschen erstens vielfach bereit sind mitzumachen, und zweitens sehr gute Ideen haben. Sie wissen sehr gut, welche Probleme es in ihrem Gebiet gibt, und haben keineswegs, wie immer gesagt wird, illusorische oder egoistische Vorstellungen, sondern wissen oft ganz genau, was möglich und machbar ist.
Ein wichtiges, über das Programm Soziale Stadt finanzierbares Instrument zur Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger und zu ihrer Einbeziehung in die lokalen Entscheidungsstrukturen ist das Quartiermanagement. Die Bedeutung der Bündelung der vielfältigen Ressourcen und von Management und Organisation verdeutlicht die beigefügte Grafik, die Prof. Staubach für die Dortmunder Nordstadt entwickelt hat (Abbildung 3). Sie sehen hier eine Vielzahl von Akteuren, die in diesem Gebiet des Programms Soziale Stadt tätig sind. Wirtschaft und Polizei etwa fehlen dabei noch. Diese Vielfalt macht aber deutlich, dass es darauf ankommt, die Akteure für ein koordiniertes und kooperatives Vorgehen zu gewinnen, nicht aber sie durch eine von außen aufgedrückte Organisationsstruktur zu verprellen. In Dortmund ist dieses Problem gut gelöst, weil sich die Soziale Stadt hier als eine solidarische Stadt und als Gemeinschaftsinitiative mit vielen Partnern versteht, die Vielfalt und neue Wege der Kommunikation und Kooperation als Stärken des Programms ansieht und einsetzt.
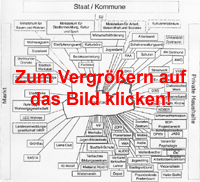 |
Abbildung 3: Akteursvielfalt in einem Programmgebiet der Sozialen Stadt |
Die Problematik einerseits und die notwendige komplexe und sensible Vorgehensweise andererseits macht die Aufgabenstruktur des Quartiermanagements deutlich, wie sie in dem beigefügten Schaubild idealtypisch dargestellt ist (Abbildung 4). Dabei ist dieses Schaubild nicht ein theoretisches Konstrukt, sondern basiert auf zahlreichen praktischen Erfahrungen bundesweit, insbesondere des Instituts für stadtteilbezogene soziale Arbeit und Beratung der Universität Essen und des Deutschen Instituts für Urbanistik mit dem Programm Soziale Stadt und vergleichbaren Vorläuferprogrammen, vor allem in Nordrhein-Westfalen mit dem Programm Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf.
Hier wird deutlich, dass das Quartiermanagement im Regelfall drei Funktionen zu erfüllen hat, nämlich eine Funktion auf der Ebene der Gemeinde, bei der eine Gebietsbeauftragte oder ein Gebietsbeauftragter die Koordination und Gesamtprojektsteuerung übernimmt und für die Ressourcenbündelung verantwortlich ist, dann die Funktion einer Fachkraft, die im Stadtteilbüro vor Ort die Bewohnerinnen und Bewohner und die sonstigen lokalen Akteure unterstützt, beteiligt und gegebenenfalls aktiviert. Dazwischen bedarf es zumindest in größeren Gebieten einer intermediären Ebene, auf der die Vernetzung der Akteure und die Abstimmung der Projekte erfolgen. Dies kann durch Stadtteilforen oder sonstige Einrichtungen geschehen, die es in vielen Städten gibt und die eine auf die jeweiligen konkreten örtlichen Bedingungen zugeschnittene Strukturierung erfahren haben.
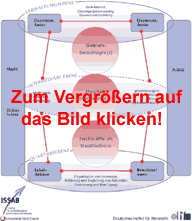 |
Abbildung 4: Quartiermanagement. Aufgabenbereiche und Organisation |
Wichtig ist dabei immer, dass die Wirtschaft und der dritte Sektor, also die Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit, ebenso beteiligt werden wie die örtliche Politik. Vor allem diese sieht in solchen Strukturen eine Gefahr, weil sie hier einen Machtverlust für sich und einen Machtgewinn für die Verwaltung befürchtet. Auch die Wohlfahrtsverbände sehen die Gefahr einerseits von Entprofessionalisierung, weil zu viel .Laienarbeit. oder ehrenamtliche Tätigkeit die fachlichen Standards absenke, und andererseits von Mittelschichtorientierung, weil die Anforderungen an solche Bürgerbeteiligung nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern bewältigt werden könnten. Gerade deshalb aber ist es wichtig, dass eine Aktivierung vor Ort stattfindet und dabei mit allen Bürgerinnen und Bürgern das Gespräch gesucht und ein Verfahren entwickelt wird, das auch sie in die Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse im Gebiet einbezieht und sie hierzu befähigt (Empowerment).
Wenn dies wirksam geschieht, dann ist die demokratische Legitimation des Verfahrens gesichert, dann ist ein Reputationsverlust für die Politik vermieden und Klientelpolitik erschwert worden. Auch zeigt die Erfahrung, dass die Bürger durchaus in der Lage sind, singuläre Interessen zu überwinden und an gemeinschaftlich zu tragenden Projekten und Zielen mitzuwirken. Politik wie Verwaltung sind hierbei ein wichtiger Partner der Bürgerinnen und Bürger und können und müssen diese unterstützen. Die Chancen für die Politik liegen insbesondere darin, dass sie mit dem politischen Grundsatzbeschluss eines integrierten Handlungskonzepts auf der Grundlage eingehender Bürgermitwirkung selber die Richtlinien der Entwicklung in dem Gebiet bestimmt, dass sie in die örtliche Willensbildung einbezogen wird und diese mitgestaltet, dass sie eine gesamtstädtische Sicht und Solidarität einbringen und die Prozesse als konstruktive Ergänzung repräsentativer Demokratie betrachten kann.
Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger kann so abgebaut werden, und auf diese Weise können sogar Anstöße für eine Politikveränderung im Großen erfolgen, wie sie etwa bei der Arbeitsförderung und Wirtschaftsförderung, der Wohneigentumsförderung oder der Wohnungsbauförderung notwendig sind. Bei Letzterer ist durch die Fortentwicklung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes in ein Gesetz zur sozialen Wohnraumförderung schon ein wichtiger Erfolg gelungen.
Für die Verwaltung bedeutet die interne Kooperation nicht nur einen fachlichen Kompetenzzuwachs, sondern auch einen Effektivitäts- und Effizienzgewinn, der die Erfüllung öffentlicher Aufgaben kostengünstiger gestaltet und zugleich das Ziel der Bürgernähe und der Unterstützung durch die Bevölkerung näher rückt.
Dafür sind Verfügungsfonds von Bedeutung, wie sie z.B. hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in vielen anderen Ländern zum Einsatz kommen. Den Bürgerinnen und Bürgern wird .freies. Geld an die Hand gegeben, was einige Länder als Gefahr sehen, weil man nicht weiß, was diese damit machen. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass die Beteiligten sehr verantwortlich mit dem Geld umgehen und das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, selbst unmittelbar etwas zu bewegen, und das führt sie an die Mitwirkung an lokalen Entscheidungs- und Planungsprozessen heran und fördert ihre Motivation zur Mitwirkung. Diese korrespondierenden Entscheidungsstrukturen und Verwaltungsorganisationen sind sehr wichtig. Es gibt viele unterschiedliche Modelle: Es kann ein Verein oder ein Bürgerforum sein. Wichtig ist, dass die örtliche Politik, die Verbände, die Wirtschaft, vor allem die Wohnungswirtschaft, und auf der anderen Seite natürlich die Verwaltung einbezogen werden. Was in dem Forum beschlossen wird, muss eine gewisse Verbindlichkeit für den Stadtrat haben, damit es auch wirklich umgesetzt wird.
IV. Kritik am Programm Soziale Stadt 
Das Programm Soziale Stadt erfährt aus allen mit seiner Umsetzung in irgendeiner Weise beteiligten Bereichen von der Politik bis zur Wirtschaft, von der Verwaltung bis zu den Verbänden, viel Zustimmung und Unterstützung. In vielen Gebieten ist es gelungen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Man kann fast schon von einer .Bewegung. sprechen. Gleichzeitig aber gibt es auch erhebliche Kritik am Programm. Hierauf will ich im Folgenden näher eingehen.
1. Beschränkung auf Investitionen 
Häufig ist als Kritik zu hören, das Programm Soziale Stadt sei deshalb unzureichend, weil es auf Investitionen beschränkt sei und daher wichtige Elemente der Stadtteilentwicklung nicht umfasse.
Hierauf ist zu entgegnen, dass die Beschränkung auf Investitionen aus dem Grundgesetz folgt. Art. 104 a Abs. 4 Grundgesetz beschränkt den Bund darauf, Finanzhilfen für Investitionen der Länder zu leisten. Allerdings wird der Begriff der Investition in der Städtebauförderung traditionell weit ausgelegt. So fallen hierunter alle Maßnahmen, die in einem notwendigen Zusammenhang mit der Investition stehen oder zu ihrer Vorbereitung erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch für die Bürgerbeteiligung, da lange schon erkannt ist, dass die nachhaltige Wirksamkeit einer Investition nur sichergestellt werden kann, wenn diese mit einer intensiven Bürgerbeteiligung verbunden war. Aus diesem Grund sind die Mittel für Quartiermanagement und Verfügungsfonds, die wesentlich zur Aktivierung und Mitwirkung der Bürgerschaft an der Quartiersentwicklung beitragen, aus dem Programm Soziale Stadt finanzierbar.
Weitere Maßnahmen, etwa aus den Bereichen Jugendhilfe oder Sozialarbeit, lassen sich unmittelbar mit Mitteln aus der Sozialen Stadt nicht finanzieren. Hier kommen aber der integrative Charakter und die Aufforderung zur Kooperation und Mittelbündelung, die das Programm prägen, zum Tragen. Mir erscheint es viel sinnvoller, wenn Maßnahmen in anderen Politiksektoren auch von den dafür zuständigen Behörden und Verbänden und sonstigen Einrichtungen geleistet werden, weil nur auf diese Weise auch das notwendige fachliche Know-how in die Leistungserbringung einbezogen wird. Keinesfalls darf es so weit kommen, dass die Städtebauförderung nun etwa selbst die Jugendhilfe macht. Auch die Ressourcen und Netzwerke, die von den anderen Fachverwaltungen und Fachverbänden über lange Jahre aufgebaut wurden und die für eine optimale Leistungserbringung unentbehrlich sind, könnte die Stadtentwicklung allein nicht fruchtbar machen.
2. Unzureichende Mittelausstattung 
Eine weitere Kritik am Programm lautet, es sei mit zu wenig Mitteln ausgestattet. Investitionsmaßnahmen seien in viel größerem Maße erforderlich, als dies das Programm ermöglicht.
Hierzu ist zum einen wieder auf die mögliche Bündelung mit Mitteln aus anderen Investitionsprogrammen hinzuweisen, auch auf die klassische Städtebauförderung, die Wohnungsbauförderung oder die Verkehrswegefinanzierung, die mit dem Programm Soziale Stadt verbunden werden können. Auch ist hier wieder auf die Notwendigkeit der Kooperation mit anderen Ressorts und deren Mitteln und Kompetenzen hinzuweisen. Zudem liegt in dieser Struktur des Programms auch ein Anreiz zur Änderung in Denken und Handeln von Politik und Verwaltung in Richtung eines integrierten Vorgehens und vor allem einer substanzielleren Bürgermitwirkung. Diese aber erhöht die Zielgenauigkeit des Mitteleinsatzes und ermöglicht weitergehende Effekte als eine .bloße. Investition. Es kommt also nicht auf mehr Mittel an, sondern auf mehr Innovation.
3. Kaschierung des Abbaus von Sozialleistungen 
Hinter der Kritik, das Programm Soziale Stadt diene nur der Kaschierung des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen, steht meines Erachtens vielfach ein wesentlich auf finanzielle Maßnahmen verengter Begriff des Sozialstaats.
Die Diskussion über eine Reform des Sozialstaats ist schon alt. Bereits in den 70er-Jahren wurden die Grenzen des Sozialstaats diskutiert, in den 80ern war die Rede vom Umbau des Sozialstaats, und in den 90er-Jahren war der schlanke Staat, der sich auf seine Kernaufgaben reduziert und alles andere privaten Marktakteuren überlässt, im Gespräch. Derzeit ist aktuell der Ansatz des aktivierenden Staats, mit dem eine Diskussion aufgegriffen wird, die schon Ende der 70er-Jahre geführt wurde. Schon 1979 legte etwa Johanno Strasser in seinem Buch .Grenzen des Sozialstaats?. genau die Probleme offen, die wir heute diskutieren. Er sah in der effektiven Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Erbringung sozialstaatlicher Leistungen einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung des Staates und in der hierin liegenden .Koproduktion. ein wesentliches Element zur Erhöhung der Zielgenauigkeit und damit Sparsamkeit staatlicher Leistungen.
Auch heute wird die Modernisierung der Verwaltung in Richtung stärkerer Bürgerorientierung und damit Effizienzsteigerung diskutiert. So spricht etwa Kurt Beck, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, von der Notwendigkeit einer .Streetworking bureaucracy., die auf die Bürger zugeht und deren Mitwirkungsbereitschaft ermöglicht und einfordert. Quartiermanagement und Empowerment, wie sie vom Programm Soziale Stadt gefordert und gefördert werden, sind wichtige Elemente, nicht nur Kosten zu sparen, sondern um die Qualität und Akzeptanz der Leistungserbringung deutlich zu erhöhen. Mit Neoliberalismus, wie manche argwöhnen, hat dies also gerade nichts zu tun.
Allerdings darf die Verantwortungsteilung, wie sie das Konzept des aktivierenden Staats zwischen unter anderem Staat und Gesellschaft vorsieht, nicht zu einer Verantwortungsabschiebung missbraucht werden, bei der sich der Staat aus seiner Verantwortung völlig verabschiedet. Wird aber die Verantwortungsteilung ernst genommen, sind auch die Bürgerinnen und Bürger zur Verantwortungsübernahme bereit und schaffen so mit die Basis für einen funktionierenden und nachhaltigen Sozialstaat.
4. Bloßer Stadtteilbezug statt gesamtstädtischer Orientierung 
Die Kritik, das Programm sei auf einzelne Stadtteile beschränkt und vernachlässige die notwendige gesamtstädtische Perspektive, ist richtig und falsch zugleich.
Richtig ist auf der einen Seite, dass ohne einen hinreichenden gesamtstädtischen Bezug weder eine zutreffende Gebietsauswahl erfolgen noch die Solidarität der Gesamtstadt mit den benachteiligten Quartieren eingefordert werden kann. Wichtig ist vor allem auch die Prävention in anderen Stadtteilen durch eine vorsorgliche .Quartierspflege., um die Eskalation von Problemen dort zu vermeiden und von vorneherein die Entwicklung .sozialen Kapitals. und von Mitwirkungsstrukturen zu fördern.
Auf der anderen Seite ist der Stadtteil gerade für Menschen in den benachteiligten Quartieren ihr eigentlicher Lebensraum. Das für die Stabilisierung dieser Quartiere notwendige .soziale Kapital., also die Vernetzungen untereinander und die gegenseitige Hilfe und Unterstützung, lässt sich nur in räumlich begrenzten Quartieren, in Sozialräumen aufbauen. Zudem würde ein räumlich umfassender Ansatz Politik und Verwaltung noch mehr überfordern, als es vielfach mit dem Programm Soziale Stadt ohnehin schon der Fall ist. Das Programm Soziale Stadt kann daher durchaus als ein Pilotprojekt für eine Reform der Stadterneuerungspolitik und auch der Stadtpolitikerneuerung angesehen werden. Es ist ein wichtiger Anstoß für Politik und Verwaltung, Bürgerschaft und Wirtschaft einschließlich der Wohnungswirtschaft, für Verbände und Initiativen, neue, effiziente und nachfragegerechte Strukturen und Angebote zu entwickeln.
5. Zeitliche Begrenzung 
Der Begriff Programm und die Jährlichkeit der Mittelansätze verleiten viele Kritiker dazu, von einer zeitlichen Begrenzung des Programms Soziale Stadt auszugehen.
Soziale Stadt ist aber ein Bestandteil der Städtebauförderung, die es bereits seit 1971 gibt. Ebenso wie dieses Grundprogramm soll auch Soziale Stadt als ein stetiges Programm entwickelt werden, da gerade in den Gebieten der Sozialen Stadt nicht zu erwarten ist, dass die Probleme in kurzer Zeit gelöst werden können. Auch klassische Sanierungsgebiete hatten bei aller notwendigen Zügigkeit der Durchführung eine Maßnahmedauer von zehn bis 15 Jahren. Das mit dem Programm auch verfolgte Ziel einer Stärkung der Demokratie und eines Abbaus von Politikverdrossenheit ist nur zu erreichen, wenn mit dem Programm nicht ein kurzfristiger Aktionismus gefördert wird, sondern mit langem Atem eine ernsthafte Verhaltens- und Verwaltungsänderung angestrebt werden. Dies hat die Bundesregierung erkannt und setzt sich für eine Verstetigung ein.
6. Simultanpolitik 
Es ist zutreffend, dass durch das Programm die Strukturen anderer Politikfelder, die mit sehr viel mehr Mitteln und Macht ausgestattet sind, nicht unmittelbar verändert werden.
Aber durch seinen integrativen Charakter, seine starke Bürgerorientierung und die große politische Aufmerksamkeit, die das Programm errungen hat, deutet sich auch an, dass andere Politikfelder sich strukturell wandeln. Von dem Programm gehen daher durchaus auch Anstöße für eine Änderung gesamtstaatlicher Politik aus. Alle, auch und besonders die Wohnungsunternehmen, die an der Umsetzung des Programm auf die eine oder andere Art beteiligt sind und davon nicht unbeträchtliche Vorteile haben, sollten daher mit dazu beitragen und daran mitwirken, auch die Politik und die Gelder in Bereichen wie Arbeitsmarktförderung, Wohneigentumsförderung oder Wirtschaftsförderung zu einem relevanten Teil für das Politikfeld der Sozialen Stadt fruchtbar zu machen. Dann kann aus dem Programm Soziale Stadt mehr als ein Programm zur Stadterneuerung werden, nämlich ein Anstoß zur Politikerneuerung, auch und gerade im Interesse der Menschen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 15.04.2004