soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Bildungsimpulse im Rahmen des Programms Soziale Stadt
Podiumsdiskussion
Moderation:
- Dr. Rolf-Peter Löhr, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
Auf dem Podium:
- Jörg Schulenburg, Ansprechpartner des Bildungsnetzwerks LBV, Berlin
- Harald Lehmann, Schulleiter der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck, Gelsenkirchen
- Markus Nau, Beratungsdienste der AWO München
- Dr. Michael Hüttenberger, Schulleiter der Erich-Kästner-Schule, Darmstadt
- Birka Schmittke, Schulleiterin der Georg-Weerth-Realschule, Berlin
- Hartmut Brocke, Vorstandsvorsitzender/Direktor der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI), Berlin
- Dr. Heidede Becker, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
 Ich möchte die Podiumsteilnehmer bitten, aufs Podium hochzukommen, weil wir jetzt zum Thema diskutieren wollen. Bis dahin will ich noch einmal auf etwas zurückkommen, das Herr Brocke zum Schluss sagte. Es hört sich so selbstverständlich an: "Mitwirkung, Beteiligung der Städte". Aber diese Mitwirkung ist überhaupt nichts Selbstverständliches, sondern muss erkämpft werden: Es gibt ein neues Projekt der Bertelsmann Stiftung, "Mitwirkung", das sich auf Kinder und Jugendliche in öffentlichen Prozessen bezieht. Und es gibt einen Spitzenvertreter der Kommunen, der die Teilnahme der Kommunen daran ablehnt mit dem Argument, hier werde die kommunale Selbstverwaltung tangiert und missachtet...
Ich möchte die Podiumsteilnehmer bitten, aufs Podium hochzukommen, weil wir jetzt zum Thema diskutieren wollen. Bis dahin will ich noch einmal auf etwas zurückkommen, das Herr Brocke zum Schluss sagte. Es hört sich so selbstverständlich an: "Mitwirkung, Beteiligung der Städte". Aber diese Mitwirkung ist überhaupt nichts Selbstverständliches, sondern muss erkämpft werden: Es gibt ein neues Projekt der Bertelsmann Stiftung, "Mitwirkung", das sich auf Kinder und Jugendliche in öffentlichen Prozessen bezieht. Und es gibt einen Spitzenvertreter der Kommunen, der die Teilnahme der Kommunen daran ablehnt mit dem Argument, hier werde die kommunale Selbstverwaltung tangiert und missachtet...
Wir haben eine neue Partnerin auf dem Podium, die sich noch nicht mit einem Beitrag vorgestellt hat, Frau Becker vom Difu. Frau Becker, was haben Sie aus der Sicht Soziale Stadt aus dem, was hier seitens nicht städtebaulicher Bereiche zum Thema Bildung gesagt wurde, gelernt?
 Dr. Heidede Becker
Dr. Heidede Becker
 Mir erscheint es auch angesichts der Zeit wichtig, ein paar Anmerkungen zu machen, die sich insbesondere aus der Perspektive der Umsetzung des Programms Soziale Stadt auch stärker an diejenigen hier im Raum richten, die zu den Bildungsakteuren gehören und vielleicht auch noch nicht so viel über die Soziale Stadt wissen. Die Soziale Stadt umfasst inzwischen - das wurde heute Morgen schon gesagt, aber ich denke, das wissen wirklich nicht alle, das merke ich immer wieder auf Transferveranstaltungen - über 360 Programmgebiete in 252 Städten und Gemeinden. Diese Programmgebiete sind genau dadurch gekennzeichnet, dass das Ausmaß an Arbeitslosigkeit, an Abhängigkeit von Transferleistungen und in den alten Bundesländern auch der Anteil der Haushalte mit Migrationshintergrund sehr viel größer sind als in der jeweiligen Gesamtstadt. Angesichts der bedrückenden Tatsache, dass hierzulande die Abhängigkeit zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg sehr stark ist, sind das genau die Gebiete, in denen die Verbesserung der Bildungssituation eine ganz zentrale Rolle spielt. Das bedeutet aber auch, dass die Institutionen der Bildungsarbeit hier eine besonders anspruchsvolle Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen zu leisten haben, unter Beteiligung aller im Gebiet lebenden, aller im Gebiet handelnden Akteure. Frau Mielenz bekräftigte heute Morgen noch einmal, dass es sich um benachteiligte Gebiete und um benachteiligte Haushalte handelt. Und das heißt aber wiederum - Stichwort "Ungleiches nicht gleich behandeln" -, dass diese Gebiete und Haushalte auf zusätzliche Unterstützung, natürlich immer auch belegt durch gute Konzepte, angewiesen sind. Uns fällt ab und zu, abgesehen von den zahlreichen sehr guten Beispielen, auf, dass in manchen Programmgebieten der Mut fehlt zu sagen, wir erbringen für die Gesamtstadt eine ganz wichtige Integrationsleistung. Auch deshalb haben diese Gebiete die Berechtigung, zusätzlich gefördert zu werden.
Mir erscheint es auch angesichts der Zeit wichtig, ein paar Anmerkungen zu machen, die sich insbesondere aus der Perspektive der Umsetzung des Programms Soziale Stadt auch stärker an diejenigen hier im Raum richten, die zu den Bildungsakteuren gehören und vielleicht auch noch nicht so viel über die Soziale Stadt wissen. Die Soziale Stadt umfasst inzwischen - das wurde heute Morgen schon gesagt, aber ich denke, das wissen wirklich nicht alle, das merke ich immer wieder auf Transferveranstaltungen - über 360 Programmgebiete in 252 Städten und Gemeinden. Diese Programmgebiete sind genau dadurch gekennzeichnet, dass das Ausmaß an Arbeitslosigkeit, an Abhängigkeit von Transferleistungen und in den alten Bundesländern auch der Anteil der Haushalte mit Migrationshintergrund sehr viel größer sind als in der jeweiligen Gesamtstadt. Angesichts der bedrückenden Tatsache, dass hierzulande die Abhängigkeit zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg sehr stark ist, sind das genau die Gebiete, in denen die Verbesserung der Bildungssituation eine ganz zentrale Rolle spielt. Das bedeutet aber auch, dass die Institutionen der Bildungsarbeit hier eine besonders anspruchsvolle Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen zu leisten haben, unter Beteiligung aller im Gebiet lebenden, aller im Gebiet handelnden Akteure. Frau Mielenz bekräftigte heute Morgen noch einmal, dass es sich um benachteiligte Gebiete und um benachteiligte Haushalte handelt. Und das heißt aber wiederum - Stichwort "Ungleiches nicht gleich behandeln" -, dass diese Gebiete und Haushalte auf zusätzliche Unterstützung, natürlich immer auch belegt durch gute Konzepte, angewiesen sind. Uns fällt ab und zu, abgesehen von den zahlreichen sehr guten Beispielen, auf, dass in manchen Programmgebieten der Mut fehlt zu sagen, wir erbringen für die Gesamtstadt eine ganz wichtige Integrationsleistung. Auch deshalb haben diese Gebiete die Berechtigung, zusätzlich gefördert zu werden.
Wir hatten heute Morgen von Frau Jung gehört, dass dieses Ganztagsschulprogramm eben noch nicht auf die Gebiete der Sozialen Stadt bezogen ist. Das Sozialpädagogische Institut (SPI) hat im Internet einmal eine Aufstellung von Ganztagsschulen gemacht, die bereits in Gebieten der Sozialen Stadt vorhandene und ebenso beantragte Ganztagsschulen auflistete. Eine solche Beobachtung und Auswertung der Entwicklung wäre ganz besonders wichtig.
Bildung im Stadtteil hat in den ersten Phasen der Programmumsetzung deutlich an Bedeutung gewonnen. Aber alle sind sich einig, dass hier eine noch stärkere Prioritätensetzung erfolgen muss. Ganz kurz die wichtigsten Strategien, die im Rahmen der Sozialen Stadt in diesem Handlungsfeld Bildung im Stadtteil bisher zum Tragen gekommen sind. Ich greife hier zwei, drei Punkte auf, die in der nordrhein-westfälischen Evaluierung zum Thema Bildung im Stadtteil, die ja leider heute nicht vorgestellt werden konnte, auch angesprochen sind. Eines ist deutlich: In den Gebieten der Sozialen Stadt ist die Stadtteilorientierung vieler Schulen stärker ausgeprägt als in vielen anderen Gebieten. Neben dieser öffnung der Schulen zum Stadtteil oder auch der stärkeren Aufmerksamkeit des Stadtteils für die Ressource Schule sind als Strategien sehr stark vertreten die Sprachförderung, weiter Nachmittagsangebote und Ganztagsbetreuung, wobei heute Morgen daran auch sehr deutlich Kritik geübt wurde. Herr Kneip etwa hat beschrieben, wie die musischen Aktivitäten, die von mus-e angeboten werden, bisher noch wenig mit dem gesamten Curriculum der Schule verbunden sind. Die musisch-kulturellen Angebote spielen in Nordrhein-Westfalen eine ganz große Rolle. Dies gilt ähnlich für die Bereiche Konfliktschlichtung, Gesundheitsförderung, Sport und Bewegung, wobei in der genannten Evaluierung betont wurde, dass hier noch Defizite zu verzeichnen sind, gerade in den Bereichen Gesundheitsfürsorge und Sport und Bewegung. Die Verbesserung der Spiel- und Lernumgebung in den Gebieten gehört zu den Hardwaremaßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt, die sehr stark zum Tragen kommen und auch nicht unterbelichtet sein sollten. Es wird deutlich, dass der Ausbau zur Ganztagsbetreuung hier auch eine Menge Unterstützung erfährt.
Abschließend zwei Anmerkungen: Trotz vieler Erfolge und vieler spannender Projekte im Rahmen der Sozialen Stadt und speziell in den Programmgebieten gibt es erheblichen Nachholbedarf. Dies betrifft erstens die Erarbeitung und Fortschreibung der Integrierten Handlungskonzepte. Sie sind ja das strategische Instrument der Umsetzung des Programms. Und sie sind aus unserer Sicht auch das Instrument, mit dem wirklich das Zusammenarbeiten der verschiedensten Akteure aus allen Handlungsfeldern organisiert werden kann. Ganz wichtig dabei - und hier gibt es ein großes Defizit - sind die Zielformulierung und die Operationalisierung der Ziele.
Zweitens vergessen viele, die im Programm Soziale Stadt sehr aktiv und engagiert sind, trotzdem häufig, dass die Kenntnis des Programms in den Städten, auch in den Programmgebieten der Sozialen Stadt, häufig bei vielen Akteuren nicht vorausgesetzt werden kann und dass es deshalb sehr wichtig ist, hier den handlungsfeldbezogenen und den übergreifenden Erfahrungsaustausch zu intensivieren.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Für mich waren bei allen Projekten, von denen wir heute Nachmittag gehört haben, drei Aspekte ganz zentral. Erstens: Es wird Leben und Lernen als eine Einheit zusammengebracht, sie sind nichts Getrenntes nach dem Motto "Wir lernen für das Leben". Es geht vielmehr um "lernen im Leben". Das Zweite ist, wir trauen den Kindern, wir trauen den Lehrern, wir trauen den Gebieten eine Menge zu und stellen fest: Es gibt eine Menge mehr an Potenzial, als wir vorher gedacht haben. Und das Dritte: Die Strukturen bilden sich aus den Projekten heraus, sie sind nicht unbedingt mit den Strukturen, die man so kennt, zu vereinbaren, zu vergleichen. Das wäre dann auch meine Frage: Wie geht das, gibt es da Probleme? Aber ich will Sie jetzt nicht fragen, sondern das Publikum bitten, Fragen zu den Projekten zu stellen.
Susanne Burcharth, Deutsches Jugendinstitut, München, aus dem Publikum
Ich habe eine Frage an Herrn Lehmann. Sie haben Ihre Präsentation mit dem Satz eröffnet: "Die Schule wurde bewusst so konzipiert." Darauf bezieht sich meine Frage: Wer war daran beteiligt? Wie ist das Konzept zustande gekommen? Wo sind die Entscheidungen getroffen worden? Mich interessiert die Struktur, die dahinter steckt. Gibt es zum Beispiel ein ausgeprägtes Leitbild in der Kommune, dass gesagt wird, in sozialen Brennpunkten müssen wir so etwas machen? Oder ist es eher ein Einzelkämpfer, der gesagt hat, ich boxe das jetzt hier durch? Ging es dabei um informelle Absprachen? Dieser gesamte Prozess interessiert mich schon sehr, weil wir am Deutschen Jugendinstitut das auch systematisch untersuchen. Was führt überhaupt dazu, dass solche Projekte so konzipiert werden?
 Harald Lehmann
Harald Lehmann
 Wir sind ja eine Schule in freier Trägerschaft. Die Evangelische Kirche von Westfalen, eine große Landeskirche, ist Träger dieser Schule, die eine Ersatzschule ist, das heißt, sie ersetzt eine vergleichbare staatliche Schule am Ort. Es gibt kein Schulgeld, und wir nehmen Kinder nach den gleichen Rahmenbedingungen wie staatliche Schulen auf. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat nur ganz wenige Schulen, der Run darauf war groß. In den 80er-Jahren kam deshalb die überlegung auf, ob wir nicht eine neue gründen sollten. Dann hat man gesagt: wir haben bereits vier Gymnasien, zwei Realschulen, wir brauchen nicht noch eine zusätzliche. Und wenn überhaupt eine Schule in privater Trägerschaft zu rechtfertigen ist, dann wenn sie etwas Modellhaftes macht. Manches, was modellhaft ist, können freie Träger eher machen. Wir hatten keinerlei Erfahrungen im Bereich von Gesamtschule als Schulträger und wir wollen eine solche Schule dann nicht dahin setzen, etwa auf die grüne Wiese, wo das relativ einfach ist, sondern wir wollen sie ganz bewusst dahin setzen, wo vielleicht keiner sie erwartet. Heute Morgen ist mal gesagt worden: Die besonders guten Schulen müssen an die besonders schwierigen Standorte.
Wir sind ja eine Schule in freier Trägerschaft. Die Evangelische Kirche von Westfalen, eine große Landeskirche, ist Träger dieser Schule, die eine Ersatzschule ist, das heißt, sie ersetzt eine vergleichbare staatliche Schule am Ort. Es gibt kein Schulgeld, und wir nehmen Kinder nach den gleichen Rahmenbedingungen wie staatliche Schulen auf. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat nur ganz wenige Schulen, der Run darauf war groß. In den 80er-Jahren kam deshalb die überlegung auf, ob wir nicht eine neue gründen sollten. Dann hat man gesagt: wir haben bereits vier Gymnasien, zwei Realschulen, wir brauchen nicht noch eine zusätzliche. Und wenn überhaupt eine Schule in privater Trägerschaft zu rechtfertigen ist, dann wenn sie etwas Modellhaftes macht. Manches, was modellhaft ist, können freie Träger eher machen. Wir hatten keinerlei Erfahrungen im Bereich von Gesamtschule als Schulträger und wir wollen eine solche Schule dann nicht dahin setzen, etwa auf die grüne Wiese, wo das relativ einfach ist, sondern wir wollen sie ganz bewusst dahin setzen, wo vielleicht keiner sie erwartet. Heute Morgen ist mal gesagt worden: Die besonders guten Schulen müssen an die besonders schwierigen Standorte.
Jetzt zu der Frage, wie das dann in der Kommune war. Es war gar nicht einfach. Die Schule war ungeheuer umstritten. In der politischen Gesäßgeographie - so beschreibe ich das immer - auf der linken Seite von GEW bis wer weiß wohin haben alle gesagt: Wir brauchen in Gelsenkirchen keine klerikale Schule. Und auf der rechten Seite, konservatives Spektrum, wurde gesagt, warum gibt die Evangelische Kirche ihr knappes Geld für so ein Teufelszeug wie eine integrierte Gesamtschule aus. Und wenn ich vorhin von den hohen Anmeldezahlen sprach, die wir jetzt haben - die haben wir in den ersten zwei Jahren nicht gehabt. Da haben wir für unsere 150 Plätze 156 und dann 159 Kinder gehabt. Den - wenn Sie so wollen - guten Ruf hat sich die Schule erst erarbeiten müssen. Das architektonische Konzept alleine war dafür nicht verantwortlich.
Hinzu kommt: Gelsenkirchen war pleite. An diesem Standort brauchte man aber eigentlich in der Tat eine Schule. Es gab dort eine nicht mehr wirklich gewollte Hauptschule. Da war es natürlich für die Kommune - das hat wohl letztlich dazu geführt, dass der Rat zugestimmt hat - relativ attraktiv, einen Träger von außen zu bekommen, der sich verpflichtete, die Schule in gewisser Weise als Stadtteilschule zu führen. Die Kommune brauchte nicht selbst zu bauen.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Gab es sozusagen politische Probleme mit der Konzeption, mit der Schulverwaltung? Gibt es curriculare Probleme? Gibt es haftungsrechtliche Probleme? Es fällt einem ja eine ganze Menge an möglichen Problemen ein, wenn man selbst ein bisschen mit Schule zu tun hatte: Die Kinder dürfen etwa in den Pausen in der Klasse bleiben. Das ist ja keineswegs selbstverständlich. Das hört sich so banal an, ist es aber nicht.
 Birka Schmittke
Birka Schmittke
 Bei mir geht es ganz einfach: Alles, was in Berlin kostenneutral bleibt, das darf ich tun. Das heißt, solange wir unsere Curricula selbst schreiben oder solange wir unsere Projekte selbst gestalten, solange wir das Ganze auch noch erfolgreich tun, hat keiner etwas dagegen. Um ein Beispiel zu nennen, den Kurs "Grundlagen der Unternehmensführung": Da haben wir uns tatsächlich mit dem Partnerunternehmen hingesetzt und haben von Klassenstufe 7 bis 10 einen Lehrplan geschrieben. Der ist relativ schnell und ohne Probleme genehmigt worden, weil auch immer die Logos der Firmen, die daran mitgearbeitet haben, mit drauf waren. Damit unterstellte man uns zugleich Kompetenz. So einfach ist das, wenn man denn will. Aber Unterstützung gibt es keine. Man muss im- mer wieder nachfragen, bei welchem Zuständigen liegt das Konzept gerade, was fehlt noch. Man muss immer wieder nachfragen und dann schafft man das auch, das sind die einzigen Hindernisse.
Bei mir geht es ganz einfach: Alles, was in Berlin kostenneutral bleibt, das darf ich tun. Das heißt, solange wir unsere Curricula selbst schreiben oder solange wir unsere Projekte selbst gestalten, solange wir das Ganze auch noch erfolgreich tun, hat keiner etwas dagegen. Um ein Beispiel zu nennen, den Kurs "Grundlagen der Unternehmensführung": Da haben wir uns tatsächlich mit dem Partnerunternehmen hingesetzt und haben von Klassenstufe 7 bis 10 einen Lehrplan geschrieben. Der ist relativ schnell und ohne Probleme genehmigt worden, weil auch immer die Logos der Firmen, die daran mitgearbeitet haben, mit drauf waren. Damit unterstellte man uns zugleich Kompetenz. So einfach ist das, wenn man denn will. Aber Unterstützung gibt es keine. Man muss im- mer wieder nachfragen, bei welchem Zuständigen liegt das Konzept gerade, was fehlt noch. Man muss immer wieder nachfragen und dann schafft man das auch, das sind die einzigen Hindernisse.
Kostenneutral zu bleiben, ist schon sehr, sehr schwierig. Wenn wir etwa den Deutschunterricht in Klassenstufe 7 verstärken, dann müssen wir an irgendeiner anderen Stelle kürzen, das heißt, wir kriegen nichts zusätzlich. Oder wenn wir Berufsorientierung schon ab Klassenstufe 7 organisieren - ich bin der Meinung, man bekommt das in den vorgesehenen zwei Jahren nicht hin, dass die Schülerinnen und Schüler für den Markt taff genug sind -, dann ist das unser Bier, und wir müssen gucken, wie wir das kompensieren. Das sind die Schwierigkeiten, nicht die Behörde, mal wird mit der und mal an ihr vorbei agiert. Unser Problem ist tatsächlich, Gelder ran zu scheffeln, und da sind wir genauso wie meine Vorredner. überall wo ein Projekt ist, das auch Geld ausschreibt, sind wir dabei. Wir haben überdies einen gut funktionierenden Förderverein, der z.B. vieles kompensiert, was von der Behörde her nicht möglich ist. Das nächste Projekt "Laptop-Klasse" wird sogar mit Eltern gemacht. Die Laptops kaufen die Eltern sogar selbst, und das in Friedrichshain-Kreuzberg. Es macht dann auch Spaß, an solchen Projekten zu arbeiten, wenn alle sich beteiligen, also Lehrer, Schüler, Eltern und dann eben noch die Firmen von außen.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Wie sind die Anmeldezahlen, und wo kommen die Kinder her, auch aus Friedrichshain- Kreuzberg?
 Birka Schmittke
Birka Schmittke
Ja, die Anmeldezahlen sind leider so hoch, dass wir ablehnen müssen. Das macht nicht Spaß, weil wir öffentlichkeitsarbeit betreiben. Das heißt, wir stellen unsere Schule auch vor, und das relativ stark. Wir haben ein richtiges Marketingkonzept, wie sich das für ein Unternehmen auch gehört. Es ist nun aber schwierig, ein Produkt anzupreisen und hinterher zu sagen: haben wir nicht mehr, ist nicht für Sie. Deshalb ist es für uns ein Problem, das wir gerne lösen würden. Wir haben das Bezirksamt aufgefordert, uns Alternativen aufzuzeigen, denn wir sind in einem Singer-Bau untergebracht. Berliner wissen, was das ist. Es ist eine schnucklige Platte ohne jegliches Nebengelass, das heißt, wir haben nicht einmal eine Aula. Wir haben uns also ein Schülerradio angeschafft, damit wir uns untereinander verständigen können. Wir haben das Bezirksamt gebeten, sie mögen uns doch eine Alternative aufzeigen. Es wird nämlich gerade ein Gymnasium in einem relativ schönen Altbau geschlossen, aber sie geben das lieber in den Liegenschaftsfonds, weil es dann nichts mehr kostet. Und wir erwirtschaften mit unserer hässlichen Platte 177 000 Euro im Jahr, weil wir völlig überfüllt sind und weil so eine Bewirtschaftung eines Gebäudes nach Schülerzahlen geht. Wir haben Zulauf, es spricht sich herum, das Konzept wird angenommen, aber wir können die Nachfrager leider nicht bedienen.
 Dr. Michael Hüttenberger
Dr. Michael Hüttenberger
 Die politische Vorgeschichte ist ein bisschen kompliziert. 1990 wurde beschlossen, in Kranichstein eine zweite Schule zu bauen. Damals gab es eine Elefantenkoalition im Stadtparlament zwischen CDU, FDP und SPD. Die Schule sollte nach dem Willen der SPD eine Sekundarschule werden. Der FDP war es relativ egal, und die CDU wollte auf jeden Fall eine zweite Grundschule. Der Kompromiss, der heraus kam, war: Wir machen grundsätzlich eine Sekundarstufe 1-Schule, nutzen die Schule aber vorübergehend als Grundschule. Sie können sich vorstellen, was das alleine für die Gebäudekonzeption bedeutet hätte. Im Grunde ist die Strategie, die man dann später entdeckt hat, dort schon Anfang der 90er-Jahre aufgegangen. Wir haben uns sehr schnell aus der Schulgemeinde heraus zusammengeschlossen und gemeinsam mit dem Stadtteil dagegen gewehrt. Wir haben versucht, alle Interessenten für ein solches Stadtteilzentrum - als solches war es nämlich auch geplant - miteinander zu vernetzen, um niemandem im Stadtparlament Anlass zu geben, widerstreitende Interessen aus dem Stadtteil politisch zu nutzen, um das ganze Vorhaben sein lassen zu können. Das ist uns durchgängig gelungen. Und so haben wir heute immer noch eine stark sachorientierte, kommunalpolitische Zusammenarbeit aller Parteien im Stadtteil, unbeeindruckt von irgendwelchen ideologischen Vorgaben im Stadtparlament.
Die politische Vorgeschichte ist ein bisschen kompliziert. 1990 wurde beschlossen, in Kranichstein eine zweite Schule zu bauen. Damals gab es eine Elefantenkoalition im Stadtparlament zwischen CDU, FDP und SPD. Die Schule sollte nach dem Willen der SPD eine Sekundarschule werden. Der FDP war es relativ egal, und die CDU wollte auf jeden Fall eine zweite Grundschule. Der Kompromiss, der heraus kam, war: Wir machen grundsätzlich eine Sekundarstufe 1-Schule, nutzen die Schule aber vorübergehend als Grundschule. Sie können sich vorstellen, was das alleine für die Gebäudekonzeption bedeutet hätte. Im Grunde ist die Strategie, die man dann später entdeckt hat, dort schon Anfang der 90er-Jahre aufgegangen. Wir haben uns sehr schnell aus der Schulgemeinde heraus zusammengeschlossen und gemeinsam mit dem Stadtteil dagegen gewehrt. Wir haben versucht, alle Interessenten für ein solches Stadtteilzentrum - als solches war es nämlich auch geplant - miteinander zu vernetzen, um niemandem im Stadtparlament Anlass zu geben, widerstreitende Interessen aus dem Stadtteil politisch zu nutzen, um das ganze Vorhaben sein lassen zu können. Das ist uns durchgängig gelungen. Und so haben wir heute immer noch eine stark sachorientierte, kommunalpolitische Zusammenarbeit aller Parteien im Stadtteil, unbeeindruckt von irgendwelchen ideologischen Vorgaben im Stadtparlament.
Worauf wir zu Beginn auch geachtet haben: wir haben zunächst einmal das Wort Gesamtschule oder gar Integrierte Gesamtschule nie benutzt, sondern formuliert, dass die Schule so sein muss, dass kein Kind per se aus dieser Schule ausgeschlossen ist und jede und jeder sie besuchen kann, unabhängig davon, welchen Bildungsabschluss sie oder er anstrebt. So haben wir verschiedene Koalitionswechsel und verschiedene Haushaltskrisen überlebt und in der Zwischenzeit ein ganz gutes Krisenmanagement entwickelt. Wir wissen, welche Eltern man zu welchen Parteiveranstaltungen schicken muss, damit sich die entsprechenden Politiker durch ihr jeweiliges Klientel angesprochen fühlen. Das waren zum einen Eltern von behinderten Kindern, das waren zum anderen Eltern, die beispielsweise in führender Position in einer Bank gearbeitet haben. Man entwickelt eine sehr genaue Adressatenorientierung, wie man seine Interessen durchsetzen will. Und am Schluss ist dann nach viel Mühe und viel Strategie ein Schulkonzept herausgekommen, das gut funktioniert. Insofern ist das, was das Quartiersmanagement über Soziale Stadt in Kranichstein professionell durchführt, schon in den frühen 90er-Jahren aus der Not heraus entstanden. Kranichstein war nämlich schon von jeher ein Stadtteil, in dem Sozialeinrichtungen erst geschaffen worden sind, als die Bürger gesagt haben: Vielleicht stellt ihr uns endlich einmal die Infrastruktur zur Verfügung, die wir zusätzlich zum Wohnen ebenfalls brauchen!
Matthias Frinken, Plankontor GmbH, Hamburg, aus dem Publikum
 Ich bin sehr beeindruckt von den drei Schulpraxisprojekten. Aber auch wenn es im Moment nicht so richtig opportun zu sein scheint, die Systemfrage zu stellen, wie heute zweimal herausgestellt wurde, so glaube ich doch, dass das Ganze nicht dem Zufall überlassen bleiben darf. Es darf doch nicht davon abhängen, ob in Stadtteilen mit Benachteiligungen nun gerade eine entsprechend günstige Akteurskonstellation vorhanden ist, dass ein gutes Projekt entsteht. Es muss doch ein bisschen systematischer anzugehen sein!
Ich bin sehr beeindruckt von den drei Schulpraxisprojekten. Aber auch wenn es im Moment nicht so richtig opportun zu sein scheint, die Systemfrage zu stellen, wie heute zweimal herausgestellt wurde, so glaube ich doch, dass das Ganze nicht dem Zufall überlassen bleiben darf. Es darf doch nicht davon abhängen, ob in Stadtteilen mit Benachteiligungen nun gerade eine entsprechend günstige Akteurskonstellation vorhanden ist, dass ein gutes Projekt entsteht. Es muss doch ein bisschen systematischer anzugehen sein!
Die drei Beispiele betreffend würde ich jetzt gerne fragen: Haben Sie denn Anträge gestellt oder das Programm Soziale Stadt an irgendeinem Punkt in Anspruch genommen? Also brauchten Sie dann vielleicht einmal die Aula oder einen Klassenraum oder einen besonderen Umbau oder Anbau, wo dann eine Verknüpfung zwischen Ihrem bildungspolitischen Ansatz und dem Programm Soziale Stadt wirklich stattgefunden hat?
 Dr. Michael Hüttenberger
Dr. Michael Hüttenberger
Der Staat vernachlässigt die Schulen in benachteiligten Quartieren strukturell, er stattet sie vergleichsweise schlecht aus. Ressourcen werden nach dem gleichen Schlüssel für eine vermeintlich gleiche Schülerpopulation zugewiesen. Es wird nicht die Strecke, der Lernweg belohnt - und entsprechende Mittel zugewiesen -, den man mit den Kindern vom Punkt "individuelle Anfangskompetenz" bis beispielsweise zum Punkt "zu erreichender Mindest-Bildungsstandard" erzielen muss. Ich schicke das vorweg.
Das bedeutet in unserer Schule: Wir sind darauf angewiesen, immer wieder zusätzliche Mittel zu akquirieren, um eine dauerhafte Verbesserung der Lernumfeldbedingungen zu erreichen. Dabei haben wir jede Menge Ideen, Konzepte und Projekte im Kopf, die wir gerne umsetzen würden. Wir hatten im Zuge des Neubaus für die Integrierte Gesamtschule (IGS) die Idee, im Rahmen eines Beteiligungsprojekts die Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung des Schulhofs verantwortlich einzubeziehen. Wir haben dann befürchtet: jetzt fühlt sich die Grundschule abgehängt, für sie kriegen wir das nicht hin, weil es dafür keine Mittel gibt. Dann hat sich beim IGS-Neubau ein Finanzierungsproblem eingestellt, es war kein Geld mehr für das Schulhofprojekt übrig, weil durch den Konkurs einer Baufirma das Baubudget verbraucht war, und das Schulhofprojekt aufgegeben wurde. Der zunächst benachteiligten Grundschule bot sich, weil die Schule im Fördergebiet Soziale Stadt liegt, plötzlich die Chance, ihr Schulhofprojekt umzusetzen. Die bislang mühsam akquirierten 20 000 Euro Spendengelder erweiterten sich auf 250 000 Euro, es wurde das Initiationsprojekt Soziale Stadt in Kranichstein. Wir konnten nämlich, als im Quartiersmanagement die Frage aufkam, "Was machen wir denn bloß?", sofort reagieren und anbieten "Wir hätten da etwas mit Schule". Wir haben dann von der Planung und Gestaltung bis zum Festefeiern alles mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam durchgeführt. In der Folge haben wir weitere Maßnahmen über ABMWohnumfeldverbesserung bis hin zu Bildungsseminaren für Eltern, LOS-Projekte, Beschäftigungsprojekte für Migrantenfrauen im Zusammenhang mit der Schulküche an Land ziehen können und darüber hinaus auch noch einfacheren Zugang zu Stiftungsmitteln gefunden, so dass in der Tat die öffentlichkeitswirksame Benennung des Quartiers als Soziale Stadt-Quartier uns eine ganze Menge bei der Akquisition von Ressourcen erleichtert hat - weil wir immer gezielt sagen konnten, was wir wollen. Wenn unsere Idee zu den Bedingungen gepasst hat, ging es, wenn nicht, haben wir es gelassen. Für eine ganze Menge Dinge fehlt aber immer noch das Geld.
 Harald Lehmann
Harald Lehmann
Die Frage, was wir in Anspruch genommen haben, kann ich so detailliert gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass wir einiges in Anspruch genommen haben. Ich bin Schulleiter dieser Schule erst seit 2 ½ Jahren. Ich weiß, beim Stadthaus, das wir haben, das sich zum Stadtteil öffnet, da sind Mittel drin. Das Stadtteilbüro Gelsenkirchen Schalke- Nord hatte dort auch über mehrere Jahre sein Domizil. Der Handwerkermarkt hat, so weit ich weiß, ebenfalls Mittel bekommen. Ich könnte das im Einzelnen nicht benennen, aber wir haben schon davon profitiert.
 Birka Schmittke
Birka Schmittke
Ich kann mit einem Nein antworten. Wir haben gar keine Anträge gestellt. Wir arbeiten nicht mit dem Kiez-Management zusammen. Ich kenne zwar den Kiez-Manager unseres Gebietes, aber ich habe seit drei Jahren von ihm weder irgendetwas gehört noch gesehen. Ich habe selbst immer ein Auge auf mögliche Fördermittel, weil es eben um Kosten und um Kooperation geht. Ich habe vor etlichen Jahren gelesen, dass es ein europäisches Projekt gibt in Berlin, URBAN. Es gibt auch jetzt mehrere Ergänzungsprojekte dazu. Dann habe ich mich hingesetzt und habe genau darauf zugeschnitten ein Projekt entworfen, was sonst eigentlich Projektmanager machen. Ich musste das Projekt viermal umschreiben, damit es immer wieder in die entsprechende Schublade passte, weil das URBAN-Konzept laufend geändert wurde. Nach anderthalb Jahren hatte ich es durch. Wir bekamen aus diesem Projekt - ich habe es gleich für drei andere Schulen noch mit beantragt, damit es sich auch lohnt - naturwissenschaftliche Räume. Aber wenn ich die Schwierigkeiten geahnt hätte am Anfang, hätte ich die Mittel woanders her beantragt.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Ohne Frage, EU und URBAN ist ein schwieriges Feld, aber immerhin. Herr Hüttenberger, Sie wollten noch etwas sagen.
 Dr. Michael Hüttenberger
Dr. Michael Hüttenberger
Eine kurze Ergänzung: Die vernetzte Struktur in Kranichstein gab es seit Beginn der 90er-Jahre über hauptamtliche Treffen, Stadtteilrunde, Kooperation Kindertagesstätten und und und, so dass das Programm Soziale Stadt 2000 auf eine bereits bestehende Netzwerk-Struktur traf. Wir hatten damals eine Hoffnung und eine Angst. Die Angst war, dass Profis eine gewachsene Struktur übernehmen, irgendwann einmal wieder gehen, und wir von vorne anfangen müssten. Die Hoffnung war, uns in diesem Prozess einzubinden, die ganze Verwaltungsorganisation an das Stadtteilmanagement abzugeben in dem Bewusstsein, uns damit zu entlasten und damit so stark sein zu können, dass, wenn Soziale Stadt einmal geht, wir die Strukturen immer noch haben.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Herr Schulenburg, zur Systemfrage: Sie haben mit mehreren Schulen einen Bildungsverbund hergestellt. Muss sich das Schulsystem ändern, damit das besser geht?
 Jörg Schulenburg
Jörg Schulenburg
 Ob das eine Frage nur des Schulsystems ist, kann man so einfach nicht beantworten. Was wichtig erscheint ist, dass die Rahmenbedingungen in den Schulen dahin gehend verbessert werden, dass mehr Raum für Schulmanagement geschaffen wird. Wir hatten unlängst eine Diskussion zu dem Thema, was denn Schulleiter in diesem Zusammenhang für Aufgaben haben. Sinnvoll wäre aus meiner Sicht, sich verstärkt angelsächsische Ansätze anzuschauen, die sich am Bild des Schulleiters als Schulmanager orientieren - eine Leitungsfunktion, die mehr als bisher davon ausgeht, dass der Schulleiter mehr Managementtätigkeiten ausübt. Beispiele wären hier die Bereiche öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Qualifizierung des Lehrkörpers. Diese Fragen halte ich für ganz wesentlich.
Ob das eine Frage nur des Schulsystems ist, kann man so einfach nicht beantworten. Was wichtig erscheint ist, dass die Rahmenbedingungen in den Schulen dahin gehend verbessert werden, dass mehr Raum für Schulmanagement geschaffen wird. Wir hatten unlängst eine Diskussion zu dem Thema, was denn Schulleiter in diesem Zusammenhang für Aufgaben haben. Sinnvoll wäre aus meiner Sicht, sich verstärkt angelsächsische Ansätze anzuschauen, die sich am Bild des Schulleiters als Schulmanager orientieren - eine Leitungsfunktion, die mehr als bisher davon ausgeht, dass der Schulleiter mehr Managementtätigkeiten ausübt. Beispiele wären hier die Bereiche öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Qualifizierung des Lehrkörpers. Diese Fragen halte ich für ganz wesentlich.
 Markus Nau
Markus Nau
 Beratungsdienste der AWO München Nein. Wir arbeiten ja mit zwei Schulen zusammen, mit einer Hauptschule und einer Realschule. Und wir erleben zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. An der Realschule ist es so, dass das vom Direktorat aus gewollt und auch gefördert wird. An der Hauptschule ist genau das Gegenteil der Fall, der Direktor sagt: "Macht mal", und wir haben engagierte Lehrer, die mitarbeiten. Es gibt jetzt keine Strukturen, die vorgegeben sind, dass etwa die Jugendhilfe mit der Schule zusammenarbeiten muss, und es gibt auch keine Absprachen.
Beratungsdienste der AWO München Nein. Wir arbeiten ja mit zwei Schulen zusammen, mit einer Hauptschule und einer Realschule. Und wir erleben zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. An der Realschule ist es so, dass das vom Direktorat aus gewollt und auch gefördert wird. An der Hauptschule ist genau das Gegenteil der Fall, der Direktor sagt: "Macht mal", und wir haben engagierte Lehrer, die mitarbeiten. Es gibt jetzt keine Strukturen, die vorgegeben sind, dass etwa die Jugendhilfe mit der Schule zusammenarbeiten muss, und es gibt auch keine Absprachen.
Ich denke auch, dass wir lernen müssen, uns besser zu verstehen. Aus der sozialen Arbeit heraus müssen wir auch die Schule verstehen lernen und umgekehrt; ein stärkerer Austausch ist nötig. Bei uns ist eben ein Bestreben zu sagen, wie können wir es schaffen, mit den Lehrern zusammenzuarbeiten, gemeinsame Teams einzurichten, gemeinsam zu besprechen, welche pädagogischen Grundlagen vorliegen. Aber von oben herab gibt es wenig Bestrebungen, eine Kooperation zu fördern.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Frau Schmittke, arbeiten Sie mit der Jugendhilfe zusammen? Nein, nicht? Jetzt eine Frage aus dem Publikum.
Heinz Metzen, Universität Bremen, aus dem Publikum
 Ich begleite das Familienbildungsprojekt "Fit für Familien" in Bremen wissenschaftlich und finde Herrn Brockes These, dass es einen Ort braucht, sehr interessant. Dies hätte ich gerne hier diskutiert. Wir Deutschen denken ja sehr idealistisch. Die Raumthese ist sehr ehrlich. Wenn wir einen zentralen Ort brauchen, wie groß darf dann das Feld um diesen Ort herum sein? Das war eine Frage, die mir beim Kurzvortrag von Herrn Schulenburg kam. Wie groß darf ein Quartier sein, 9 000, 5 000 Einwohner, damit es auch öffentlich einen Ort hat? Ein Bremer Stadtteil hat 30 000, 40 000 Einwohner. Ist die Frage klar?
Ich begleite das Familienbildungsprojekt "Fit für Familien" in Bremen wissenschaftlich und finde Herrn Brockes These, dass es einen Ort braucht, sehr interessant. Dies hätte ich gerne hier diskutiert. Wir Deutschen denken ja sehr idealistisch. Die Raumthese ist sehr ehrlich. Wenn wir einen zentralen Ort brauchen, wie groß darf dann das Feld um diesen Ort herum sein? Das war eine Frage, die mir beim Kurzvortrag von Herrn Schulenburg kam. Wie groß darf ein Quartier sein, 9 000, 5 000 Einwohner, damit es auch öffentlich einen Ort hat? Ein Bremer Stadtteil hat 30 000, 40 000 Einwohner. Ist die Frage klar?
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Ja, die Frage ist klar. Bei der Sozialen Stadt - jedenfalls mache ich diese Erfahrung - ist gerade in Zusammenarbeit mit Jugendhilfe eine der Stärken des Programms, dass wir solche Orte schaffen können. Jugendhilfe allein kann dies häufig nicht tun, nicht von alleine. Es ist auch immer ein Bedürfnis, dass es einen Ort gibt, an dem man sich treffen, wo man hinkommen kann. Die andere Frage ist: Was ist ein Sozialraum? Wie groß ist ein Gebiet Soziale Stadt? Da gibt es welche mit ganz wenigen Einwohnern, wo wir sagen, das ist vielleicht zu wenig, bis hin zu riesigen Gebieten, wo wir sagen, das ist eindeutig zu viel. Das ist aber eine Diskussion, die innerhalb des Bereichs Soziale Stadt läuft: Wie werden diese Gebiete ausgesucht, wie werden sie abgegrenzt, was sind die Kriterien? Hierzu könnte Herr Häußermann einiges sagen, könnten wir einiges sagen. Aber ich meine, hier möchten sich die Kommunen eher bedeckt halten, sie wollen das nicht fest klären. Vielleicht kann Herr Brocke etwas dazu sagen?
 Hartmut Brocke
Hartmut Brocke
 Es gibt in dieser Hinsicht natürlich kein "man nehme", sondern man muss überlegen, was ein Ort für einen Sinn hat, wenn er die Funktion eines sozialen Bildungsforums, eines sozialen Zentrums erfüllen soll. Wir wissen aus der Bildungsforschung und aus der Armutsforschung, dass ein Teil der Exklusion dieser Bevölkerungsgruppen darin besteht, dass sie sozusagen an Brückennetzen nicht mehr teilhaben, sondern nur noch an Sozialnetzen innerhalb eines bestimmten Milieus, die in sich geschlossen sind. Und dies macht das Stück fehlendes soziales und kulturelles Kapital aus. Die kennen eben nicht einen, der einen kennt, der es dann wirklich tut, um es einmal ein bisschen flapsig zu übersetzen. Und dies beschränkt natürlich die Fähigkeit, ein lokales Zentrum in Besitz zu nehmen, einen solchen Ort als eigenes Zentrum zu betrachten. Eine Allianz-Arena für 60 000 Leute würde ich da nicht als geeigneten sozialen Ort denken. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines solchen Gebiets können selber einschätzen, was ihre Nachbarschaft ist. Es gibt Untersuchungen von Toni Sachs-Pfeiffer, die festgestellt hat, dass es so etwas wie eine private Aneignung gibt. Das bezieht sich aber räumlich nicht weiter als auf maximal 200, 300 Meter, als würde man in Pantoffeln mal schnell noch Brötchen kaufen. Dann gibt es öffentliche und halb öffentliche Räume. Ich würde diese lokalen Zentren zu halb öffentlichen Räumen zählen. Hier ist auch der direkte Anknüpfungspunkt zur Sozialen Stadt oder zur ganzen Problematik von Städtebau: bei den Infrastruktureinrichtungen. Natürlich wäre es unglaublich schwierig in Ihrer Schule, die nichts anderes hat als vielleicht einen Keller, das auszubauen oder weiterzuentwickeln. In den Konzepten der anderen Projekte war das anders, wenn die Idee schon da war, eine Stadtteilöffnung für die Institution zu bauen, oder in dem geschilderten Fall, wenn die Schüler ihre Klassen selbst bauen. In eine derartige Situation würde ich gerne einmal kommen. Aber das ist immer nur die Gründerphase, die haben alles, und die anderen finden es vor und müssen sich die Räume neu erobern. Das begrenzt die Zahl. Ich würde sagen, 30 000 Bewohner ist auf jeden Fall zu viel. Ich würde von engeren Einzugsbereichen sprechen. Und ich würde auch nicht von folgender Relation ausgehen: ein lokales Zentrum für ein Gebiet der Sozialen Stadt. Wir haben Soziale Stadt-Gebiete mit 40 000 Bewohnern, und es gibt welche mit 800 oder 1 000 Bewohnern, richtig niedlich. Beides ist nicht ideal. Wenn man die Bürgerinnen und Bürger fragt, was das Geeignetste für sie ist, dann ergibt sich, wenn wir bei der Schule bleiben, der Einzugsbereich einer Grundschule mit mehreren Kitas.
Es gibt in dieser Hinsicht natürlich kein "man nehme", sondern man muss überlegen, was ein Ort für einen Sinn hat, wenn er die Funktion eines sozialen Bildungsforums, eines sozialen Zentrums erfüllen soll. Wir wissen aus der Bildungsforschung und aus der Armutsforschung, dass ein Teil der Exklusion dieser Bevölkerungsgruppen darin besteht, dass sie sozusagen an Brückennetzen nicht mehr teilhaben, sondern nur noch an Sozialnetzen innerhalb eines bestimmten Milieus, die in sich geschlossen sind. Und dies macht das Stück fehlendes soziales und kulturelles Kapital aus. Die kennen eben nicht einen, der einen kennt, der es dann wirklich tut, um es einmal ein bisschen flapsig zu übersetzen. Und dies beschränkt natürlich die Fähigkeit, ein lokales Zentrum in Besitz zu nehmen, einen solchen Ort als eigenes Zentrum zu betrachten. Eine Allianz-Arena für 60 000 Leute würde ich da nicht als geeigneten sozialen Ort denken. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines solchen Gebiets können selber einschätzen, was ihre Nachbarschaft ist. Es gibt Untersuchungen von Toni Sachs-Pfeiffer, die festgestellt hat, dass es so etwas wie eine private Aneignung gibt. Das bezieht sich aber räumlich nicht weiter als auf maximal 200, 300 Meter, als würde man in Pantoffeln mal schnell noch Brötchen kaufen. Dann gibt es öffentliche und halb öffentliche Räume. Ich würde diese lokalen Zentren zu halb öffentlichen Räumen zählen. Hier ist auch der direkte Anknüpfungspunkt zur Sozialen Stadt oder zur ganzen Problematik von Städtebau: bei den Infrastruktureinrichtungen. Natürlich wäre es unglaublich schwierig in Ihrer Schule, die nichts anderes hat als vielleicht einen Keller, das auszubauen oder weiterzuentwickeln. In den Konzepten der anderen Projekte war das anders, wenn die Idee schon da war, eine Stadtteilöffnung für die Institution zu bauen, oder in dem geschilderten Fall, wenn die Schüler ihre Klassen selbst bauen. In eine derartige Situation würde ich gerne einmal kommen. Aber das ist immer nur die Gründerphase, die haben alles, und die anderen finden es vor und müssen sich die Räume neu erobern. Das begrenzt die Zahl. Ich würde sagen, 30 000 Bewohner ist auf jeden Fall zu viel. Ich würde von engeren Einzugsbereichen sprechen. Und ich würde auch nicht von folgender Relation ausgehen: ein lokales Zentrum für ein Gebiet der Sozialen Stadt. Wir haben Soziale Stadt-Gebiete mit 40 000 Bewohnern, und es gibt welche mit 800 oder 1 000 Bewohnern, richtig niedlich. Beides ist nicht ideal. Wenn man die Bürgerinnen und Bürger fragt, was das Geeignetste für sie ist, dann ergibt sich, wenn wir bei der Schule bleiben, der Einzugsbereich einer Grundschule mit mehreren Kitas.
Günther Poggel, Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Sport, Berlin, aus dem Publikum
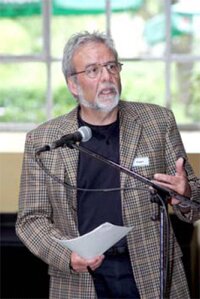 Herr Brocke hat gerade schon etwas vorweggenommen, was ich sagen wollte. Mit einem Ort ist nicht unbedingt eine Schule oder eine Kita gemeint, sondern es braucht, wie in einem Bildungsverbund, wo es sehr viele Orte gibt, die Verortung von Themenstellungen im Sozialen Stadtteil. Die Schulen eignen sich, die Kitas eignen sich, weil sie, wenn sie von den Bewohnern als "ihre" Schule, "ihre" Kita angenommen worden sind, natürlich Raum stellen, eine Identifikationsmöglichkeit geben.
Herr Brocke hat gerade schon etwas vorweggenommen, was ich sagen wollte. Mit einem Ort ist nicht unbedingt eine Schule oder eine Kita gemeint, sondern es braucht, wie in einem Bildungsverbund, wo es sehr viele Orte gibt, die Verortung von Themenstellungen im Sozialen Stadtteil. Die Schulen eignen sich, die Kitas eignen sich, weil sie, wenn sie von den Bewohnern als "ihre" Schule, "ihre" Kita angenommen worden sind, natürlich Raum stellen, eine Identifikationsmöglichkeit geben.
Zu der Frage nach der Abgrenzung sozialer Räume: Wir führen in Berlin in der Jugendhilfe die Diskussion seit etwa 15 Jahren und sind für uns eher auf die Antwort gekommen, dass wir uns zunächst einmal Räume abgrenzen, damit wir Daten bekommen. Das sind Datenräume, die nicht immer sehr passend zugeschnitten sind, weil die Verkehrszellen, für die es in Berlin Daten gibt, einmal zu ganz anderen Zwecken zugeschnitten wurden. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns an diese und an jene statistischen Gebiete halten, dann kann das in einigen Bezirken klappen, in anderen haut das überhaupt nicht hin, weil inzwischen auch die Stadtwirklichkeit darüber hinweg gegangen ist. Wir meinen aber auch die Abgrenzung von Räumen, und so haben wir im Senat auf den Antrag, den das Abgeordnetenhaus an uns gestellt hat, gesetzt: Planungschaos beenden, Planungsräume vereinheitlichen! Aber das geht nicht, nach jeder Fragestellung gibt es auch eigene Räume. Ein Kind hat das Haus, die Straße, wenn überhaupt bis hin zur Kita. Wenn sie älter werden im Jugendfreizeitalter, dann fahren sie im Mittelbereich los, das sind mehrere statistische Gebiete. "Unser" Alter hat die ganze Stadt erobert, wenn wir älter werden, reduziert es sich wieder auf das Haus. Es kommt immer auf die Fragestellung an. Wir haben uns zunächst auch sehr darüber echauffiert, dass die 17 Quartiermanagementgebiete in Berlin so willkürlich geschnitten sind. Es ist ein Aktionsraum für Fragestellungen, die übertragbar sind. Mit dem Geld hört es ja zunächst meist an der Grenze auf, aber die Werte sind übertragbar.
Eine Frage vielleicht noch an die drei Projekte in den Schulen. Ich halte diese Projekte ja für mehr oder minder auch aus ganz anderen Zusammenhängen entstanden. Heute Morgen haben Herr Faltermeier und Frau Mielenz ganz ähnlich gesagt, dass es weniger um das Nicht-Wollen geht, sondern um das Nicht-Wissen der jeweils anderen Seite. Hartmut Brocke und andere wie Herr Löhr haben es ja auch gesagt, dass oft die eine Seite nicht weiß, inwieweit sie denn von der anderen Seite Hilfe kriegen kann. Ingrid Mielenz nannte es "quer denken", die Bereitschaft ist vorhanden, "quer handeln" fällt aber schwer, weil vieles im Ressortdenken verhaftet ist. Wie kriegt man hier eine Veränderung hin? Das schien mir auch am Ende der Podiumsdiskussion heute Morgen eine der Schlüsselfragen zu sein, da hätte ich gerne noch eine Antwort.
 Dr. Michael Hüttenberger
Dr. Michael Hüttenberger
Orte sind Plätze, mit denen ich mich identifizieren kann. Deshalb legen wir als Schule natürlich Wert darauf, dass die örtliche Partei ihre Jahreshauptversammlung in der Schule abhält und der bürgerliche Gesangverein sein Konzert dort in der Schule gibt. Insofern nutzen auch die Schülerinnen und Schüler ihre Schule, weil sie sie selber mitbauen und mitgestalten können. Die Frage ist, wie man das beibehält. Eine unserer Ideen bei der Gestaltung des Grundschulhofs war, dass die Grundschüler ihn selbst "bauen" und sich mit ihm identifizieren. Jetzt sind die Grundschüler nach vier Jahren aus dieser Schule raus, und die nächsten Erstklässler haben keinen eigenen Bezug mehr zu diesem Hof. Für die ist es egal, ob den Hof vor ihnen Schüler gebaut haben oder Erwachsene, die sie nicht kennen. Ersteres ist natürlich insofern qualitativ besser, als das, was Kinder für sich selber geschaffen haben, für andere Kinder noch ein bisschen attraktiver ist als etwas, das sich Erwachsene vorstellen. Aber die unmittelbare Identifikation ist weg. Es geht darum - und das ist ein Riesenproblem in Sozialer Stadt -, Dauerhaftigkeit zu sichern. Ich vermeide das Wort Nachhaltigkeit. Wer finanziert mir die Folgeinvestition für die Dauerhaftigkeit eines Projektes? Wer gibt mir Gelder für den Folgeprozess, also wenn das Projekt einmal abgeschlossen ist, dass die nächsten Generationen von Kindern immer wieder Veränderungen vornehmen können?
 Dr. Michael Hüttenberger
Dr. Michael Hüttenberger
Ja, denn wenn etwas fertig ist, müssen wir Fördergelder für die Unterhaltung akquirieren. Das ist jedes Mal eine Riesendiskussion. Dann heißt es: Das muss die Kommune übernehmen. Nur, die hat kein Geld, ärgert sich sowieso, dass sie qua Komplementärfinanzierung über einen Haufen Haushaltsmittel für lange Zeit vorentschieden hat. Es wäre im Zusammenhang mit Sozialer Stadt wichtig, auch einmal darüber nachzudenken, wie man neu Geschaffenes erhalten kann.
Eine letzte Bemerkung: Als Kranichstein als Soziale Stadt-Standort ausgeguckt worden ist, wurde ein Teilgebiet, Kranichstein-Süd, ausgewählt. Jeder im Stadtteil hat sich an den Kopf gefasst und gefragt, was das denn soll. Am Anfang ist auch vom Quartiersmanagement diskutiert worden, dass die Bewohnerbefragung nur in diesem ausgewählten Gebiet stattfinden soll. Dabei sind auch alle anderen Bewohner von Sozialer Stadt betroffen. In einem Nachbeschluss wurden dann quasi sämtliche Jugend- und Sozialeinrichtungen noch in das Fördergebiet mit einbezogen. Auf diese Weise hat sozusagen der Stadtteil definiert, was sein Sozialraum und was sein Identifikationsraum ist, mit dem er sich befassen will.
 Harald Lehmann
Harald Lehmann
Identifikation ist, meine ich, nicht nur an die Räume gebunden. Auch wir haben unseren ersten Jahrgang an Schülern, der nicht mehr mitgebaut hat. Die Identifikation hat viel mehr etwas zu tun mit dem Image, das zum Beispiel ein Verein oder auch eine Schule hat. Im Falle von Kindern und Jugendlichen ist ganz wichtig, ob etwa der Fußballverein, dem sie angehören, ein Loser-Image oder ein Gewinner-Image hat. Obwohl die Bauphase bei uns abgeschlossen ist, können sich die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, sicher in einer ganz besonderen Weise mit dieser Schule identifizieren.
Ich wollte aber noch einmal auf die Ortsfrage zurückkommen, weil sie für mich eine große Anfechtung war. Wie ich sagte, sind wir Stadtteilschule in einem Stadtteil, der an die 20 000 Einwohner hat, aber wir sind auch noch mehr. 50 Prozent der Kinder nehmen wir aus dem Stadtteil auf, die anderen 50 Prozent aus dem Restgebiet der Stadt, dies ganz bewusst, weil ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass es nötig ist, geschlossene Milieus aufzubrechen, auch in der Schule. Wir können das nun tun, weil wir mittlerweile diese hohen Anmeldezahlen haben, wir tun es aber auch bewusst. Ich will Ihnen das einmal an einem Beispiel deutlich machen. Wir hatten in unserem Vertrag, den die Kirche mit der Stadt abgeschlossen hatte, ursprünglich eine Garantieerklärung für zwei benachbarte Grundschulen drin, dass wir deren Kinder in jedem Fall übernehmen. Als ich mir vor zwei Jahren die Zahlen und die Entwicklung angeguckt habe, bin ich davon abgerückt. Wir waren mittlerweile bei über 300 Anmeldungen. Und wenn ich mir die Anmeldungen aus diesen beiden Grundschulen, die eine Aufnahmegarantie hatten, angeguckt habe, kamen - hier darf ich das sicher sagen - alle unsere Problemkinder aus diesen beiden Schulen und andere nicht mehr. Aus diesen Schulen kriegten wir überhaupt kein Kind mehr mit einer Gymnasialempfehlung. Wir bekamen aus diesen beiden Schulen alle Kinder mit erheblichen Sprachproblemen und Migrationshintergrund, die nach sechs Grundschuljahren schon an der Grenze zum Sonderschulaufnahmeverfahren waren. Aus dem Rest Gelsenkirchens kriegten wir eine ganze Reihe von Anmeldungen von leistungsstarken Kindern. Und es stellte sich heraus - wir wollten ja Stadtteilschule für alle sein -, dass wir für eine bestimmte Klientel keine Stadtteilschule mehr waren. Und jetzt formuliere ich das mal so, wie das Eltern im Ruhrgebiet formuliert haben. Die haben gesagt: "Wenn die Chaoten, mit denen meine Kinder die letzten vier Jahre zusammen waren, jetzt alle garantiert wieder da sind, dann ist das für mein Kind jedenfalls die Schule nicht." Und ein bestimmtes Bildungsbürgertum karrt seine Kinder dann einmal quer durch Gelsenkirchen hin zum Gymnasium. Dann haben wir gesagt, wir müssen gegensteuern. Es waren harte Gespräche mit der Kommunalpolitik und auch mit den beiden benachbarten Grundschulen. Jetzt arbeiten wir gut zusammen. Wir bieten jetzt den Kindern im vierten Jahrgang aus dieser Schule, die für uns das größte Problem darstellte, eine Computer-AG an unserer Schule an. Ganz bewusst empfehlen die Lehrer die leistungsstärkeren Kinder da hinein. Mittlerweile haben wir auch ein verändertes Anmeldeverhalten. Diese Kinder, auch solche mit Gymnasial- oder Realschulempfehlung, die ein Jahr bei uns gewesen sind, sagen ihren Eltern dann hinterher, wir wollen auch auf diese Schule, weil sie diese ja schon kennen. Wir haben, wenn man so will, sehr bewusst gegengesteuert.
Das meine ich mit Aufbrechen von geschlossenen Milieus. Es gibt Nebeneffekte, die wir wollen, die ich aber in Gelsenkirchen überhaupt nicht an die große Glocke hänge. Zum Beispiel wollen wir sehr bewusst eine Integrationsschule sein. Was wir da konzeptionell machen, erzähle ich Ihnen gerne und trage ich auf jedem Podium vor. In Gelsenkirchen möchte ich nicht in die Schlagzeilen geraten mit dem Hinweis darauf, dass wir eine besonders gute Integrationspolitik machen. Nicht, weil wir eine solche Politik nicht machen, sondern wegen des Images, das wir nach draußen "verkaufen". Wenn man als Image angeheftet bekam, eine Schule zu sein, die besonders geeignet ist für Kinder mit Migrationshintergrund, dann haben sie nur noch Anmeldungen aus diesem Bereich. Beispiel ückendorf, ein Stadtteil mit einem hohen Ausländeranteil: Die ückendorfer Gesamtschule macht eine exzellente Politik, leistet exzellente Arbeit, aber sie hat auf Integration als sozusagen ihr hoch gehängtes Ziel gesetzt. Sie hat mittlerweile in den Jahrgängen 60 Prozent bis 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund, hat Mühe, ihre Klassen noch zu füllen. Und bei uns stehen die türkischen Eltern an und sagen: Wo soll unser Kind denn hin, wenn nicht zu Ihnen, nach ückendorf auf keinen Fall. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass man, wenn man Stadtteilschule sein will, gleichzeitig eine Politik macht, die versucht, die Milieus aufzubrechen.
 Hartmut Brocke
Hartmut Brocke
Ja, das ist wirklich ein heißes Eisen. Ich finde es akzeptabel und richtig, dass sich eine Schule überlegt, was schaffe ich und was schaffe ich nicht, was will ich, wie ist mein Konzept, wann setze ich das um. Insofern habe ich jetzt an Ihnen und Ihrer Schule keine Kritik. Aber eine Kommune kann so etwas nicht kalt lassen. Es kann doch nicht sein, dass wegen irgendwelcher Mischungsverhältnisse nach Ihrem Konzept oder Image sozusagen der Zugang für Kinder zur - ich übertreibe jetzt ein bisschen - einzigen Schule, die die Kinder wirklich noch richtig fördert, weil sie ein Integrationskonzept hat, das den Namen verdient, versperrt ist. So ist es ja eine Art Russisch-Roulette, ob ein Kind in die Schule reinkommt und gefördert werden kann oder nicht.
Ich denke, das ist der Punkt, an dem man über öffentliche und private Verantwortung und über Reformmodelle und Reformschulen politisch diskutieren muss. Und da tut es mir natürlich auch weh, dass es politisch nicht opportun zu sein scheint, dieses Ganztagsschulprogramm nun in einen expliziten Zusammenhang mit benachteiligten Stadtgebieten zu bringen, weil offensichtlich in der Politik noch die Vorstellung herrscht, dass man ein solches Programm nicht mit den Elendsschichten zusammenbringen sollte. Ich bedauere das sehr. Wobei ich auch meine, dass das nicht nur für benachteiligte Stadtgebiete eine gute Lösung ist, die Ganztagsproblematik trifft doch nicht nur die Schule, sondern sie trifft auch die Tagesbetreuung. Es geht um eine Nutzer- und Verbraucherqualität in den sozialen Einrichtungen und Angeboten zur Stärkung von Familien. Da sind die Ganztagsangebote nicht nur eine Spezialität für Schule, sondern sie sind generell die angemessene Reaktion auf eine veränderte gesellschaftliche Form und die Art und Weise, wie die Familien in ökonomische und soziale Strukturen eingebunden sind.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Dies ist ein ganz heißes Thema, und es zeigt, dass es nicht so einfach ist, das System zu ändern, weil man dann solche Fragen regeln muss. Die Frage ist, ob man überhaupt regeln kann oder ob man es sich anders entwickeln lässt.
 Dr. Michael Hüttenberger
Dr. Michael Hüttenberger
Wir haben dieses Problem auch. Die Frage des Images in einem belasteten Stadtteil ist ganz, ganz wichtig. Herr Radtke hat es beschrieben als das Phänomen der sozialen Rücksortierung. Natürlich achten Eltern darauf, ob sie ihre Kinder in ein Schulsystem stecken, das mit "problematischen" Kindern belasteter ist als ein anderes. Und ein Zeichen fortgeschrittener Integration von Migranten ist, dass diese sich im Bildungsverhalten genauso abzugrenzen beginnen wie die bürgerlichen deutschen Eltern. Auch Migranteneltern, bildungsorientierte iranische Migranten zum Beispiel, sagen: Ich schicke mein Kind nicht an Ihre Schule, weil mir die fundamentalistischen, islamistischen Keime gerade in der Grundschule schon zu viel waren. Damit müssen wir uns schlichtweg auseinander setzen.
Das ist die Systemfrage, die heute Morgen auch nicht gelöst wurde. Solange die Schulen so behandelt werden, als ob alle, die in ihnen sind, gleich seien, werden sich beide, Eltern wie Schulen, logisch im Sinne des Systems verhalten und sich entlasten, wenn sie es denn können. Schulen werden "schwierige" Kinder abweisen, Eltern werden belastete Schulen meiden. Wir brauchen also eine andere Form von Ressourcenzuweisung. Wie man das machen kann, habe ich kürzlich in Darmstadts Partnerstadt Alkmaar in Holland erfahren. Wir waren dort in einer Schule in einem Stadtquartier, die von 90 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund besucht wird und fanden hervorragende Lernbedingungen vor. Diese Schulen in Alkmaar sind bestens ausgestattet, weil man dort eine ganz einfache Faustformel umgesetzt hat: Jedes Kind mit Migrationshintergrund zählt doppelt. So einfach könnte man das machen. Es gibt bei uns sicherlich viel differenziertere Möglichkeiten, das zu tun. Wenn wir aber nichts Dergleichen tun, dann werden wir noch ewig über Kompensationsmöglichkeiten im Rahmen von Soziale Stadt reden, ohne dass sich strukturell etwas ändert.
 Dr. Rolf-Peter Löhr
Dr. Rolf-Peter Löhr
Das war jetzt, meine ich, doch ein ganz wesentliches Schlusswort. Für mich hat die Diskussion heute Nachmittag gezeigt, dass sehr viel mit Eigeninitiative möglich ist, es ist sehr viel mit der übergabe von Verantwortung an die Kinder und an die Beteiligten möglich, mit dem Zutrauen zu ihrer Kompetenz und mit ihrer Mitwirkung. Aber letztlich ist es daneben wichtig, dass wir eine Gleichbehandlung der Schulen erreichen. Zurzeit machen wir eine Gleichbehandlung der Schulen, indem wir alle gleich behandeln. Da aber die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, sehr ungleich sind, ist das letztlich eine Ungleichbehandlung. Wenn wir es nicht hinbekommen, dass wir die Schulen, die besondere Leistungen erbringen müssen, auch besonders behandeln, indem wir Finanzmittel und Lehrerstellen und Sonstiges dort konzentrieren, werden wir unser Problem auch nicht wirklich lösen, denn diese "Ungleichbehandlung" ist einfach notwendig. Ich denke, dass das vielleicht eine Art Fazit der Tagung heute sein könnte. Es müssen Netzwerke gebildet werden, ein Erfahrungsaustausch muss etabliert werden, und wir müssen versuchen, dass wir auch auf der politischen Ebene ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dies in Bewegung kommt. Bei alldem gibt es auch noch die Föderalismusproblematik. Der Bund kann nicht an das Bildungsministerium herantreten und hier änderungen vorschlagen; da gehen die Länder dazwischen. Aber gleichwohl müssen wir es versuchen, soweit es möglich ist. Außerdem gibt es Bund-Länder-Kommissionen verschiedenster Art. Und ich denke, wenn wir diese Erfahrung, dieses Wissen, das wir heute hier gesammelt haben, dort einzuspeisen versuchen, können wir vielleicht auch etwas bewegen, egal wie die nächste Wahl ausgeht.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld, für Ihr Ausharrungsvermögen, für Ihr Interesse an diesem sehr komplexen, sehr schwierigen, aber, wie ich finde, auch sehr erfreulichen Thema. Wir haben gesehen, dass konkret vor Ort durchaus einiges passiert und mit Erfolg auf die Beine gestellt wird. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 22.09.2005