soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Strategische Allianzen zur Bildungsförderung in benachteiligten Stadtteilen
Podiumsdiskussion
Moderation:
- Prof. Dr. Hartmut Häußermann, Humboldt-Universität zu Berlin; Mitglied des Bundesjugendkuratoriums
Auf dem Podium:
- Petra Jung, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
- Dr. Josef Faltermeier, Praxisforschungsprojekt "Coole Schule: Lust statt Frust am Lernen", Deutscher Verein, Berlin
- Ingrid Mielenz, Vorsitzende des Bundesjugendkuratoriums; bis Dezember 2004 Stadträtin für Jugend, Familie und Soziales, Nürnberg
- Sybille Volkholz, Leiterin der Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin; Koordinatorin des Projekts Schule - Wirtschaft der IHK Berlin
- Winfried Kneip, Projektleiter mus-e der Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland, Düsseldorf
- Prof. Dr. Peter Paulus, Wissenschaftlicher Leiter von Anschub.de, Allianz für nachhaltige Schulgesundheit, Universität Lüneburg
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
 Das Thema "Strategische Allianzen zur Bildungsförderung in benachteiligten Stadtteilen" lässt viele Interpretationen zu. Es ist klar, dass es um die Rolle von Bildung im Sozialraum, im Stadtteil geht. Und wir wissen - das haben wir gerade auch noch einmal gehört -, dass die Koordination und die Integration von Schulpolitik in Stadtteilpolitik, in Stadtentwicklungspolitik bisher nur wenig entwickelt, dennoch aber ein Schlüsselthema sowohl für die Bildungspolitik als auch für die Quartierspolitik sind. Beide sind aufeinander angewiesen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Bildungspolitik wird wohl die Defizite, die in den vergangenen beiden Jahren deutlich geworden sind, nicht ohne eine Sozialraumorientierung aufholen können, und umgekehrt wird es auch keine erfolgreiche Quartierspolitik ohne eine Koordination und Integration mit der Schulpolitik geben. Wir haben außerdem in den Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf das Thema "Migration", also die Koexistenz von einheimischen bildungsfernen Schichten und Migrantenfamilien, die dieses Schul- und das Entwicklungsproblem noch einmal verstärkt.
Das Thema "Strategische Allianzen zur Bildungsförderung in benachteiligten Stadtteilen" lässt viele Interpretationen zu. Es ist klar, dass es um die Rolle von Bildung im Sozialraum, im Stadtteil geht. Und wir wissen - das haben wir gerade auch noch einmal gehört -, dass die Koordination und die Integration von Schulpolitik in Stadtteilpolitik, in Stadtentwicklungspolitik bisher nur wenig entwickelt, dennoch aber ein Schlüsselthema sowohl für die Bildungspolitik als auch für die Quartierspolitik sind. Beide sind aufeinander angewiesen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Bildungspolitik wird wohl die Defizite, die in den vergangenen beiden Jahren deutlich geworden sind, nicht ohne eine Sozialraumorientierung aufholen können, und umgekehrt wird es auch keine erfolgreiche Quartierspolitik ohne eine Koordination und Integration mit der Schulpolitik geben. Wir haben außerdem in den Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf das Thema "Migration", also die Koexistenz von einheimischen bildungsfernen Schichten und Migrantenfamilien, die dieses Schul- und das Entwicklungsproblem noch einmal verstärkt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Podiums sind im Programm aufgeführt. Ich habe mir zur Organisation überlegt, dass wir jedem von ihnen Zeit geben müssen, seine Position darzustellen zur Frage: Was heißt strategische Allianzen in benachteiligten Stadtteilen? Dafür sind etwa zehn Minuten vorgesehen, so dass wir dann noch etwa eine Stunde Zeit haben zu diskutieren. Als Erstes bitte ich Sie, kurz zu sagen, welche Probleme Sie aus Ihrer institutionellen Sicht oder Ihrer Funktion heraus für die zentralen Probleme bei der Bildungsförderung in benachteiligten Stadtteilen halten und zu berichten, welche Lösungen Ihre Institution oder Ihre Initiative dazu beizutragen hat.
 Petra Jung
Petra Jung
Ich arbeite im Bundesministerium für Bildung und Forschung und bin dort Referatsleiterin für den Arbeitsbereich Zukunft Bildung, der natürlich mehr umfasst als nur das Ganztagsschulprogramm, was Ihnen vielleicht auch als Vier-Milliarden-Investitionsprogramm der Bundesregierung bekannt ist. Wir möchten natürlich den dramatischen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungschancen auch mit Ganztagsschulen und den lokalen Bezügen von Ganztagsschule in der Kommune abbauen helfen und wollen möglichst alle Schülerinnen und Schülern - nicht nur die, die sich in sozial benachteiligten Stadtteilen befinden, sondern auch die in Vororten, Kleinstädten, Großstädten - individueller und früher fördern. Das ist unser Ziel mit dem Thema Ganztagsschulen.
 Dr. Josef Faltermeier
Dr. Josef Faltermeier
Vor dem Hintergrund unseres Projektes "Coole Schule", das zwischenzeitlich abgeschlossen ist und für das der Auswertungsbericht vorliegt, denken wir, dass es sehr wichtig ist, zu einer neuen verbindlichen und verpflichtenden Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zu kommen. Das ist das Eine. Das Zweite ist, dass wir auch zu einer neuen verbindlichen und verpflichtenden Zusammenarbeit mit den Eltern kommen. Wir haben dies teilweise auf der Grundlage schriftlicher Verträge gemacht. Und das Dritte ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass es notwendig ist, dass sich alle Bildungsakteure im Stadtteil zusammen in einem Netzwerk verschränken: von der Industrie- und Handelskammer über die Arbeitsverwaltung bis zur Schule und Jugendhilfe, und dass durch diesen regelmäßig institutionalisierten Erfahrungsaustausch sehr viel Bewegung in die Bildungspolitik vor Ort hinein kommt.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
Vor meinem Nürnberger Leben hatte ich schon ein Berliner Berufsleben, in dem ich hauptsächlich Kindertagesstättenentwicklungsplanung gemacht habe und bereits 1978 meinte, mit dem Thema fertig zu sein. Denn selbstverständlich spielte in dieser Kindertagestättenentwicklungsplanung das Thema Bildung eine ganz große Rolle. Und da ich weiß, dass sich noch einige erinnern, möchte ich auch auf das Berliner Planungsleitsystem verweisen, in dem wir so genannte Kinderzentren geschaffen haben, um die Kindertagesstätten und die Grundschule unter einem Dach zu verankern mit der Hoffnung, dass dieses nun eine bessere Bildung - wenigstens für ganz kleine Kinder - ergeben würde. Dann habe ich 15 von den 18 Jahren, die ich in Nürnberg war, mit dem Schulbereich, dem staatlichen wohlgemerkt - das ist für eine Kommune gar nicht so einfach - zusammen gesessen. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich zum Schluss stolz darauf war, dass eine der leitenden Fachbeamtinnen wusste, was eine Hilfe zur Erziehung ist. Also es ist schwer und zeitaufwändig. Alles, was wir hier diskutieren, geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Ich bin einerseits hier eingeladen, weil ich fünf Jahre lang die Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet habe, die sechs Empfehlungen "Selbstständig lernen - Bildung stärkt Zivilgesellschaft" (1) erarbeitet hat. Wir haben in diesen Empfehlungen versucht, die Leitfrage zu beantworten, wie man die Verantwortlichkeit zwischen Individuen, gesellschaftlichen Institutionen wie der Schule und dem Staat so neu verteilen kann, dass auf der einen Seite die Effekte größer werden, auf der anderen Seite - das war die zweite Leitfrage - aber auch die Gerechtigkeit größer wird und die Ungleichheiten im System verringert werden. Was konkret zu unserem Thema herausgekommen ist und über meine beiden anderen Projekte werde ich dann im zweiten Durchgang berichten.
 Winfried Kneip
Winfried Kneip
Ich bin Geschäftsführer der Yehudi Menuhin Stiftung in Deutschland. Die Stiftung bringt das Element Kunst und Kultur in die benachteiligten Stadtteile. Unser Zugang ist, dass wir auf der ersten Ebene unserer Arbeit mit Künstlern in Schule versuchen, Lehrer zum Mitmachen zu gewinnen, dabei Schule zu verändern und Unterricht anders zu gestalten. Darüber hinaus gibt es als zweites Thema die Fragestellung, wie es gelingen kann, die Schule dazu zu bewegen, eine Art Schulkultur zu entwickeln, um eine Atmosphäre des Förderns und Forderns bei Kindern zu bewirken. Und der dritte Aspekt, auf den wir nach sechs Jahren erfolgreichen Programms in NRW zurückblicken können: Wir haben festgestellt, dass es sehr wichtig ist, die Wirkung von Schule in den Stadtteil zu befördern. Dafür haben wir aus dem mus-e-Programm, das wir in NRW verwirklichen, über einige sehr ermutigende Beispiele zu berichten.
 Prof. Dr. Peter Paulus
Prof. Dr. Peter Paulus
Ich bin eingeladen worden, weil Gesundheit in dem hier zu diskutierenden Zusammenhang ein zentrales Thema ist. Gesundheit hängt zusammen mit Bildung und mit der sozialen Lage von Menschen. Wenn wir da in Gesundheit investieren und etwas unternehmen können, dann sind wir auf einem guten Weg. Ich werde über ein Projekt der Bertelsmann Stiftung berichten können, das diesen Zusammenhang thematisiert.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Vielen Dank. Es ist jetzt, nachdem Herr Hübner gegangen ist, kein Vertreter eines Kultusministeriums mehr anwesend, was mir symptomatisch für einen Kongress erscheint, der sich diesem Thema für die Problematik des Programms Soziale Stadt gewidmet hat. Das war eines der Ergebnisse der Zwischenevaluation (2) und ist durch das, was Herr Radtke sagte, bestätigt worden: Kaum Kooperation zwischen den Schulen, die den Kultusministerien unterstehen, und den Städten mit den Schulämtern, die für die Gebäude und den Service zuständig sind - eine integrierte Politik, bei der Schule und Stadtentwicklung zusammenkommen, gibt es nicht. Wer daran schuld ist, ist jetzt egal. Aber es gibt, das haben Sie auch deutlich gemacht, Herr Radtke, kein großes Interesse seitens der Schulämter und seitens der Kultusbehörden daran, die sozialen Probleme in den Stadtteilen zu lösen. Ich denke, das ist falsch und kurzsichtig, weil die Bildungsdefizite nicht behoben werden können, ohne auf die sozialen Probleme in den Stadtteilen einzugehen. Das ist also ein Thema, dem wir uns nachher widmen müssen. Sie haben auf die Problematik der Zuschneidung von Schuleinzugsbereichen hingewiesen. Wir könnten am Ende auch überlegen, ob es ein Instrument der Schul- oder der Stadtentwicklungspolitik sein könnte, die Schuleinzugsbezirke vor dem Hintergrund unserer heutigen Integrationsprobleme neu zuzuschneiden. Dies hat natürlich nur Sinn, wenn die Schulen in ihrer Programmatik und in ihrer Ausstattung entsprechend orientiert sind. Und ein drittes Thema, was angeklungen ist in dem, was Herr Hübner gesagt hat, was aber auch Herr Radtke deutlich herausgestellt hat, wäre: Müssen wir eigentlich die Freiheit der Eltern einschränken? Jetzt als erster Beitrag der von Frau Jung.
 Petra Jung
Petra Jung
 Ich kann Ihnen nur kurz darüber berichten, wie wir die institutionellen Rahmenbedingungen mit dem Ganztagsschulprogramm ändern. Unser Ziel war natürlich, einen Beitrag für eine nachhaltige Bildungsreform in Deutschland, also Bund und Länder gemeinsam, zu leisten. Sie haben eben darauf hingewiesen, dass kein kultusministerieller Vertreter mehr da ist. Wir arbeiten mit allen 16 Ländern im Bereich Schule zusammen, indem wir die Infrastruktur von Schulen verbessern wollen, indem wir den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulen mit dem Investitionsprogramm fördern.
Ich kann Ihnen nur kurz darüber berichten, wie wir die institutionellen Rahmenbedingungen mit dem Ganztagsschulprogramm ändern. Unser Ziel war natürlich, einen Beitrag für eine nachhaltige Bildungsreform in Deutschland, also Bund und Länder gemeinsam, zu leisten. Sie haben eben darauf hingewiesen, dass kein kultusministerieller Vertreter mehr da ist. Wir arbeiten mit allen 16 Ländern im Bereich Schule zusammen, indem wir die Infrastruktur von Schulen verbessern wollen, indem wir den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulen mit dem Investitionsprogramm fördern.
Vier Milliarden Euro bis 2007 bedeutet mehr als eine kleine Schwester des Programms Soziale Stadt. Wir haben 2003 gestartet und werden das Programm etwa bis 2008 führen. Es gibt einige Länder, die möchten eine Verlängerung bis 2009. Das ist uns jetzt schon angekündigt worden, natürlich möglichst unter Bereitstellung von mehr Geld. Das gibt es jetzt erst einmal nicht. Jetzt kommen erst einmal Neuwahlen, und dann sehen wir weiter. Dieses Programm ist in dem Artikel 104a des Grundgesetzes begründet, der da sagt, dass der Bund den Ländern eine Anschubfinanzierung zum Ausbau von Schulen oder anderen Einrichtungen gibt. Wir wollen natürlich mit diesem Programm die Qualität von Schule verbessern. Wir wollen eine neue Lern- und Lehrkultur und auch neue pädagogische Konzepte in den Ländern haben. Das haben wir immer gesagt, das steht auch in der Präambel des Programms. Und wir sehen dieses Programm als einen Teil einer gemeinsamen Bildungsreform von Bund und Ländern. Wenn auch einige Länder das mehr auf ihre Seite ziehen wollen, ist es ein Anschub des Bundes gewesen, der den Ländern diesen Vorschlag gemacht hat. Wir haben inzwischen mit allen Ländern intensiven Kontakt. Wir haben in Bremen - die Ministerin hat es erst vorgestern verkündet - die zweitausendste Ganztagsschule eingeweiht, die mit Bundesgeldern gefördert wurde. Und wir haben in den Planungen bis jetzt schon mehr als 5 000 Schulen aus allen 16 Ländern, die mit Hilfe des IZBB-Geldes - so kürzen wir das ab (3) - neue Ganztagsangebote bereit stellen. Mehr als jede achte allgemein bildende Schule wird inzwischen mit Bundesgeldern zu einer Ganztagsschule oder zu einem Ganztagsangebot ausgebaut.
Die Gelder sind für Neubau, Ausbau, Umbau und auch Ausstattung, also Schulbibliotheken oder Computerräume, einsetzbar. Die meisten Länder verwenden sie für Anbau und Umbau, das heißt, ihre Schule wird zu einer Ganztagsschule umgebaut. Sie bekommt einen Ruheraum, eine Kantine, mehr Spielräume und auch andere Möglichkeiten. Die Voraussetzung ist die Vorlage eines pädagogischen Konzeptes, das von den Ländern geprüft wird. Wir entledigen mit diesem Programm nicht die Länder ihrer Schulpolitik, sondern sagen: Ihr müsst nach einem pädagogischen Konzept vorgehen, das in Eurem Land Wertigkeit hat, das in Eurem Land bedarfsgerecht ist.
Da gibt es einige Länder, die mehr die gebundene Form des rhythmisierten Ganztagsschulunterrichts gewählt haben. Das ist zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, die gesagt haben: Unsere Infrastruktur ist inzwischen sehr schlecht geworden, weil wir hohe Abwanderungsbewegungen und eine geringere Schülerdemographie haben; da können wir es uns nicht leisten, die Schüler - beliebig - mal nachmittags, mal nicht nachmittags auf der Straße sitzen zu lassen; wir wollen die gebundene Form. Die meisten Bundesländer haben aber die offene Ganztagsschule gewählt, auch aus Kostengesichtspunkten, nehme ich an. Da ist dann das Nachmittagsangebot freiwillig, und man verpflichtet sich als Eltern bzw. Schüler erst einmal für ein Jahr, an diesem Angebot teilzunehmen. Wir haben Bewegungen wie in Bremen oder auch in Rheinland-Pfalz zu verzeichnen, wo aus dem offenem Angebot nach und nach gebundene Angebote entstehen.
Wir möchten natürlich dieses große Programm nicht einfach nur mit Beton, wir wollen es auch inhaltlich füllen. Wir haben den Ländern angeboten, ein Begleitprogramm inhaltlicher Art zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zu entwickeln. Das Programm läuft seit letztem Jahr. Wir möchten regionale Serviceagenturen in den Ländern einrichten. Wir haben bereits neun Serviceagenturen unter Beteiligung der Länder eingerichtet. Wir kofinanzieren dort dann eine Stelle, und die Länder kofinanzieren den anderen Teil der Stelle und die Räumlichkeit. Das heißt, sie definieren selbst, wo ihr Bedarf ist und welche Serviceagentur welche Arbeit und welchen Schwerpunkt leisten soll. Mit diesem Begleitprogramm möchten wir außerdem Beratung und Coaching von Schulen. Wir haben eine umfassende Datenbank mit einem Expertenangebot bereitgestellt: Unter www.ganztaegig-lernen.de finden Sie eine riesige Datenbank mit Schulbeispielen, praktischen Beispielen vor Ort und auch Einbeziehung von Erfahrung bereits existierender Ganztagsschulen, wie man im sozialen Umfeld auch mit anderen Partnern zusammenarbeiten kann. Man kann dort auch sehen, was bisher in den Kommunen schon passiert ist.
Wir wollen diese Serviceagenturen mit ihrer Beratung nicht alleine stehen lassen, wir brauchen Werkstätten, die ihnen auch wissenschaftliche Expertisen zuführen. Wir haben zu vier Themen, z.B. Organisation von Ganztagsschule und individuelle Förderung, vier Werkstätten in der Bundesrepublik eingerichtet, die unabhängig voneinander, aber trotzdem auch thematisch miteinander arbeiten und die diesen Serviceagenturen Material zuliefern und sie auch beraten. Wir können es natürlich nicht nur bei dieser Beratung belassen, wir brauchen auch Fortbildung. Deshalb gibt es jetzt einen BLK (4) - Modellversuch, der Fortbildungsmodule für das Personal an Ganztagsschulen entwickelt; sowohl die pädagogischen Fachkräfte als auch die Erzieher werden mit dieser Fortbildung geschult. Es gibt fünf Bundesländer, die sich an diesem Fortbildungsprogramm der BLK beteiligen.
Bisher gibt es wenig Ganztagsschulforschung in der Bundesrepublik. Wir haben bisher rund 10,9 Prozent Schüler, die an ganztägigen Angeboten teilnehmen. Da müssen wir erst einmal untersuchen, was es eigentlich für Gelingens- und für Misslingensbedingungen gibt, die die Ganztagsschule gut oder auch schlecht machen in der jeweiligen Kommune. Wir haben deshalb eine umfassende Forschung initiiert: Es hat bereits in 14 Ländern Schulstichprobenziehungen gegeben, wo - sozusagen im Panelverfahren 3., 5., 7. und 9. Klasse - geschaut wird, was aus den Schülern geworden ist und wie das die Ganztagsschüler empfinden. Das machen wir nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Lehrern, Schulleitern und Eltern. Es soll untersucht werden, was Ganztagsschule jeweils vor Ort gebracht hat. Diese Forschung wird vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt, vom Deutschen Jugendinstitut in München sowie vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der Uni Dortmund durchgeführt und läuft etwa bis 2009.
Ziel des Ganzen ist es, Kinder und Jugendliche mit Ganztagsschule stark zu machen und ihnen umfassende Möglichkeiten auch in ihrer Kommune zu bieten, die ihnen mit einem Mehr an Zeit auch mehr an Förderung bieten. Wir wollen nicht einfach nur irgendwelche Betonbauten dorthin setzen, sondern auch diese inhaltliche Begleitung weiter nachvollziehen und voranbringen. Das haben wir mit den Ländern eingeleitet. Wenn Sie hören, nur 14, 13, 15 Länder machen mit, dann ist das meistens unter Ausschluss eines Landes. Dieses befindet sich im Süden Deutschlands, es ist Baden-Württemberg. Die machen bei allen Programmen sowohl in der Forschung als auch bei der inhaltlichen Begleitung nicht mit. Alle anderen Länder sind beteiligt und werden hoffentlich auch ihren Teil zum Erfolg dieses Programms beitragen.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Vielen Dank, sehe ich es richtig, dass es - bisher jedenfalls - noch keinen Bezug zur Sozialen Stadt gibt?
 Petra Jung
Petra Jung
Es gibt bisher nur den Bezug, dass ich im Verkehrsministerium von unseren Aktivität berichtet habe und vom Deutschen Institut für Urbanistik dies interessant gefunden wurde. Wir haben vorgeschlagen, sich auf unserer Homepage "Ganztagsschulen" zu präsentieren. Das ist aber bisher nicht erfolgt.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Das ist ja interessant; das soll besser werden. Sie haben also jetzt noch keine Informationen darüber, ob es eine regionale Schwerpunktbildung gibt - Sie sagten, etwa jede achte Schule wird eine Ganztagsschule.
 Petra Jung
Petra Jung
Doch, wir haben natürlich die Möglichkeit, in den Zielen der einzelnen Länder zu gucken, wo setzen wir die Mittel ein. Berlin hat gesagt, es möchte soziale Brennpunkte fördern. Allerdings, wenn ich mir manche Schulen, die dort drin stehen, angucke, habe ich so meine Zweifel. Wenn ich Lichterfelde-West sehe, das ist für mich kein sozialer Brennpunkt. Aber es gibt natürlich durchaus die Tendenz, in Kreuzberg, im Wedding oder in Neukölln Schulen zu fördern, da hat Berlin schon Schwerpunkte gesetzt. Es gibt in Baden-Württemberg die Absicht, soziale Brennpunkte an Hauptschulen in größeren Städten zu fördern. Das sind aber die einzigen Länder, die diesen Schwerpunkt gesetzt haben. Das wird vielfach vom Bedarf vor Ort abhängig gemacht. Zum Beispiel bezieht sich Hamburg beim Ausbau von Ganztagsschulen nur auf Gymnasien.
 Dr. Josef Faltermeier
Dr. Josef Faltermeier
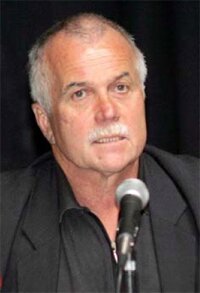 Der Deutsche Verein hat 2002 gemeinsam mit der Deutschen Bank Stiftung das Projekt "Coole Schule: Lust statt Frust am Lernen" ins Leben gerufen, ein Titel, den wir in einer ersten Aktion an einer Schule in Kassel gefunden haben, den uns die Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen haben, nachdem wir ihnen die Philosophie des Projektes vermitteln konnten. Wir haben an fünf Standorten in fünf Bundesländern an fünf Schulen jeweils zehn Schülerinnen und Schüler mit schulverweigernder Haltung in das Projekt einbezogen. Diese schulverweigernden Haltungen waren unterschiedlich ausgeprägt: von 40 Tagen im vorausgegangenen Schuljahr bis hin zu eineinhalb Jahren. Wir wollten mit diesem Lernprogramm, das wir eigens hierfür entwickelt haben, Folgendes vor allem erreichen: erstens, dass wir diese Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulalltag zurückholen. Wir haben uns gefragt, was sind vor dem Hintergrund verschiedener Forschungsstudien und Diskussionsergebnisse im Zusammenhang mit Schulentwicklung die Eckpunkte für ein sinnvolles Konzept, das geeignet sein könnte, diese Schüler wieder in die Alltagsschule zurückzuholen. Wir sind dabei insbesondere davon ausgegangen, dass diese Schülerinnen und Schüler, die zumeist aus sozialen Brennpunkten kamen - ich sage zur Zusammensetzung nachher noch etwas mehr -, in erster Linie kein intellektuelles Problem haben, sondern in der Tat soziale Probleme. Diesen Zusammenhang haben wir auch sehr schnell - vor allem im ersten Jahr - bestätigt gefunden.
Der Deutsche Verein hat 2002 gemeinsam mit der Deutschen Bank Stiftung das Projekt "Coole Schule: Lust statt Frust am Lernen" ins Leben gerufen, ein Titel, den wir in einer ersten Aktion an einer Schule in Kassel gefunden haben, den uns die Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen haben, nachdem wir ihnen die Philosophie des Projektes vermitteln konnten. Wir haben an fünf Standorten in fünf Bundesländern an fünf Schulen jeweils zehn Schülerinnen und Schüler mit schulverweigernder Haltung in das Projekt einbezogen. Diese schulverweigernden Haltungen waren unterschiedlich ausgeprägt: von 40 Tagen im vorausgegangenen Schuljahr bis hin zu eineinhalb Jahren. Wir wollten mit diesem Lernprogramm, das wir eigens hierfür entwickelt haben, Folgendes vor allem erreichen: erstens, dass wir diese Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulalltag zurückholen. Wir haben uns gefragt, was sind vor dem Hintergrund verschiedener Forschungsstudien und Diskussionsergebnisse im Zusammenhang mit Schulentwicklung die Eckpunkte für ein sinnvolles Konzept, das geeignet sein könnte, diese Schüler wieder in die Alltagsschule zurückzuholen. Wir sind dabei insbesondere davon ausgegangen, dass diese Schülerinnen und Schüler, die zumeist aus sozialen Brennpunkten kamen - ich sage zur Zusammensetzung nachher noch etwas mehr -, in erster Linie kein intellektuelles Problem haben, sondern in der Tat soziale Probleme. Diesen Zusammenhang haben wir auch sehr schnell - vor allem im ersten Jahr - bestätigt gefunden.
Wir sind zweitens davon ausgegangen, dass jeder Mensch Stärken hat. Und wir haben in unseren Recherchen festgestellt, dass die traditionelle Schule eigentlich nicht so sehr an den Stärken der Schülerinnen und Schüler interessiert ist, vor allem dann nicht, wenn diese Stärken und Ressourcen nicht in die traditionellen Bildungsmuster hineinpassen, was auf der einen Seite verständlich und nachvollziehbar ist, was aber für uns und für die Vorbereitung unserer Lehrerinnen und Lehrer sowie Sozialpädagogen, die wir in das Projekt einbezogen hatten, und auch für die Qualifizierung dieser Fachkräfte natürlich sehr wichtig war.
Drittens haben wir festgestellt, dass Schulerfolg im Grunde genommen unmöglich herzustellen ist, wenn nicht als Voraussetzungen soziale Schlüsselkompetenzen vorhanden sind, wenn nicht ein Sozialverhalten entwickelt werden konnte, das diese Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, einigermaßen konzentriert zuzuhören, sich in Diskussionen einzubringen, in Konflikten nicht über den Tisch zu springen, sondern zu lernen, dass es neben diesen körperlichen Attacken andere Instrumente und Möglichkeiten gibt, sich auseinander zu setzen.
An der Jean Piaget-Schule in Berlin-Hellersdorf haben wir auch einen Standort gehabt, und dieses Projekt wird fortgeführt. Wir haben deshalb gesagt: Wenn soziale Probleme und Schulerfolg so eng miteinander zusammenhängen, dann bietet es sich an, die zuständigen Bildungsteams, Pädagogenteams aus der Jugendhilfe und natürlich aus den Schulen zu holen und sie zu einem Team zu vernetzen, das gemeinsam - gleichermaßen ohne Rangunterschiede - verantwortlich für die Entwicklungsschritte ihrer Lerngruppe ist. Sie können sich vorstellen, dass das am Anfang manchmal erhebliche Reibungsverluste bedeutet hat, weil nicht so sehr das "Nicht-Wollen" der Akteure im Vordergrund stand, sondern das "Nicht-Verstehen-Können" der jeweils anderen Profession. Lehrerinnen und Lehrer haben zunächst einmal Probleme, eine Schülergruppe zu individualisieren und einzelne Schüler, außer in Negativzuschreibungen, zu entdecken und zu erkennen. Bei den Sozialpädagogen ist es genau umgekehrt, ihre hilfestrategischen Ansätze zielen in erster Linie auf die Fokussierung des Einzelnen und die Entwicklung eines persönlich zugeschnittenen Hilfekonzeptes.
Das ist nur eine von vielen unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen, die zusammen natürlich zunächst in einem gemeinsam verantwortlichen Team zu großen Friktionen geführt haben. Deshalb haben wir in der Anfangsphase vormittags die so genannte Schulwerkstatt und nachmittags die Erfahrungswerkstatt durchgeführt. In der Schulwerkstatt haben wir auf einen anderen Unterricht gesetzt, das heißt, wir wollten ihn lebensweltbezogen machen, wir wollten die Lernorte in den Stadtteil verlegen und umgekehrt den Stadtteil über die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht holen. Also haben wir z.B. in Frankfurt im Gallus-Viertel - auch ein so genannter sozialer Brennpunkt - mit der Schülergruppe einen Spielplatz in Kooperation mit den zuständigen Technikern vom Bauamt saniert und haben - vor dem Hintergrund dieser Aktion - die Erfahrungen gemeinsam im Unterricht ausgewertet oder den Unterricht in Mathematik beim Berechnen von Flächen auf den Spielplatz geholt. Hier haben wir gemerkt, dass wir auf sehr großes Interesse und auf sehr große Bereitschaft bei den Schülern gestoßen sind, wenn es uns gelungen ist, den Unterrichtsstoff nachvollziehbar mit der Bewältigung oder der Gestaltung von Lebenswelt zu verknüpfen.
Und wir haben gesagt: Wir brauchen eine verbindliche und partnerschaftliche Elternarbeit. Etwa 65 Prozent der einbezogenen Schülerinnen und Schüler standen in engem Kontakt zur Jugendhilfe, das heißt, sie wurden von der Jugendhilfe - teilweise auch im Rahmen der Hilfe zur Erziehung - betreut. Etwa 35 Prozent hatten bislang noch keinen Kontakt zur Jugendhilfe, was nicht darauf schließen lässt, dass sie bislang keine Probleme gehabt hätten, sondern sie haben sich so mehr oder weniger durch das System von Schule und Jugendhilfe durchlaviert. Und auch hier haben wir sehr deutlich gesehen, wie wichtig es ist, wenn es zu einer engen Kooperation und Verständigung von Schule und Jugendhilfe kommt. Dann kann nämlich Kindern und Jugendlichen, die Probleme in ihrem Alltag haben und damit auch gleichzeitig häufig Entwicklungskurven für problematische Schulkarrieren begründen, frühzeitig geholfen werden.
Wir haben weiter festgestellt, dass es wichtig ist, den Lernort Schule mit zu verändern. Deswegen sind wir in die Schule hinein gegangen, haben Räumlichkeiten in der Schule genutzt, um - auch im Diskurs mit den Lehrerinnen und Lehrern der Schule - hier Veränderungen im Sinne einer positiven Schulentwicklung einzuleiten. Das ist sehr selten und nur teilweise gelungen. Wir denken aber, dass wir wirklich eine verbindliche Neuordnung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe brauchen, dass wir neue Ideen der Kooperation entwickeln müssen, beispielsweise, dass jeder Lehrer oder jede Lehrerin im ersten halben Jahr zweimal eine Einrichtung im Stadtteil besucht, um überhaupt kennen zu lernen, was in diesen Einrichtungen vor sich geht und was dort alles gemacht wird. Und wir denken, dass es auf der anderen Seite auch sehr wichtig ist, kontinuierliche gemeinsame Qualifizierungsveranstaltungen durchzuführen.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Vielen Dank. Können Sie einen Eindruck davon geben, wie viele Schüler von Ihren Projekten angesprochen worden sind?
 Dr. Josef Faltermeier
Dr. Josef Faltermeier
Ich hatte es am Anfang gesagt: Wir haben insgesamt bis zum Schluss 58 Schülerinnen und Schüler im Projekt gehabt.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Ich hatte gedacht, ich hätte das missverstanden. Das zeigt, welcher Aufwand nötig ist, um in diesen komplexen Feldern etwas zu erreichen. Wir kommen jetzt zu Frau Mielenz, Vorsitzende des Bundesjugendkuratoriums.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
 Ich habe so den Eindruck, als sei ich hier im Podium die Einzige, die einen sozialen Zugang zum Thema Bildung hat, und die Einzige, die auch kommunale Aspekte mit einbringt. Von Kommunen ist ja viel die Rede. Aber alles das, was hier gesagt und heute Vormittag vorgetragen wurde, muss irgendjemand auch tun. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass - Entschuldigung - ministerielle Politik nicht immer und unbedingt vor Ort ankommt. Da sind besonders beim Thema Bildung ganz viele Hürden dazwischen. Als Vorsitzende des Bundesjugendkuratoriums möchte ich aber zunächst auf die letzte Broschüre, die wir veröffentlicht haben, hinweisen: "Neue Bildungsorte für Kinder und Jugendliche" (ist über die Geschäftsstelle in Bonn abzurufen).
Ich habe so den Eindruck, als sei ich hier im Podium die Einzige, die einen sozialen Zugang zum Thema Bildung hat, und die Einzige, die auch kommunale Aspekte mit einbringt. Von Kommunen ist ja viel die Rede. Aber alles das, was hier gesagt und heute Vormittag vorgetragen wurde, muss irgendjemand auch tun. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass - Entschuldigung - ministerielle Politik nicht immer und unbedingt vor Ort ankommt. Da sind besonders beim Thema Bildung ganz viele Hürden dazwischen. Als Vorsitzende des Bundesjugendkuratoriums möchte ich aber zunächst auf die letzte Broschüre, die wir veröffentlicht haben, hinweisen: "Neue Bildungsorte für Kinder und Jugendliche" (ist über die Geschäftsstelle in Bonn abzurufen).
Ansonsten probiere ich es jetzt in genau zehn Minuten mit einigen Thesen. Die erste These ist die, dass wir uns nichts vormachen sollten, wenn es um benachteiligte Stadtteile geht (das sind ja die Programmgebiete der Sozialen Stadt), dann geht es auch um benachteiligte Menschen, die in diesen Stadtteilen wohnen, also um Kinder und Jugendliche, Familien, Ältere, Nicht-Deutsche usw. usw., also um Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen leben. Bildungsförderung heißt hier: Integration trotz Segregation. Ich kenne die alten Modelle, mit denen man versucht hat, diesem Segregationseffekt entgegenzuwirken. Das ist alles schlecht gelungen. Wir müssen integrieren, über Bildung fördern - trotz Segregation. Das ist, glaube ich, schon mal der erste ehrliche Grundsatz. Wir haben es mit armen Menschen zu tun, wir haben es mit armen Stadtteilen zu tun, und meistens haben wir es auch mit armen Städten zu tun. Also auch dieses Szenario muss uns bewusst sein.
Ich glaube, dass wir zweitens der Bildungsförderung vorausgehend eine sehr intensive Stadtteilanalyse brauchen, eine qualitative, nicht nur eine quantitative Bestandsaufnahme zur sozialen Lage, um den "besonderen Förderbedarf" zu definieren. Jetzt irgendetwas ganz schnell zu organisieren, diesen Weg halte ich nicht für richtig. Und wir brauchen die potenziellen Bündnispartner. Wen haben wir denn überhaupt vor Ort, welche sind die Akteure, welche lassen sich motivieren, welche wollen sich engagieren? Erst dann kann ich Allianzen schließen. Allianzen ergeben sich nicht von alleine. Ich brauche eine Initiative, einen Input und eine Strategie.
Das mit der Schichtzugehörigkeit, der sozialen Herkunft, ist schon hervorgehoben worden. Wir wissen um die Schulprobleme in benachteiligten Stadtteilen; Sie alle kennen diese Probleme, hoher Ausländeranteil etc. pp. Es ist nicht überall so, dass das Bildungsbürgertum genau diese Schulen entdeckt, weil nämlich ihre Kinder - Niveau ist niedrig - es in diesen Schulen durchaus schaffen, einen Zugang zum Gymnasium zu erreichen. Das ist eine Gegenstrategie, aber sehr interessant. Die integrierte Familien-, Sozial- und Bildungspolitik vor Ort, das ist eigentlich so etwas wie Gesellschaftspolitik vor Ort, wobei selbstverständlich der Gesundheitsbereich auch dazu gehört usw. Eigentlich müssen alle Politikbereiche einbezogen werden.
Es gibt drittens vor Ort die meisten Chancen, nicht nur quer zu denken, das fällt ja noch relativ leicht. Wir alle können uns in Fantasie erproben, was alles sein müsste und sein könnte, aber das Quer-Handeln, das fällt so schwer, weil man tatsächlich immerzu in diesen Zuständigkeitskästchen landet: wer was mit wem warum tut oder tun darf. Und über diese Kästchen sich hinaus zu entwickeln, das fällt wirklich schwer. Das heißt konkret: Jugendhilfe muss sich natürlich um Schule kümmern und auch etwas vom Schulalltag verstehen. Ich kann nicht an die Tür klopfen und sagen, hier bin ich und jetzt will ich was von euch, aber was genau, weiß ich nicht. Das geht nicht. Umgekehrt geht es auch nicht, dass Schule zum Beispiel über Schulsozialarbeit nachdenkt und überhaupt nichts von Jugendhilfe weiß. Wir haben diesen Sozialraum, und wir haben eine Reduzierung der Komplexität durch die Begrenzung des Sozialraums. Wir haben im Sozialraum die meisten Chancen, die Menschen zu beteiligen - sei es in Bürgerversammlungen, Kinderversammlungen, Bürgervereinen usw., nämlich so etwas wie Selbstorganisation und Ehrenamt zu verknüpfen. Man könnte sich auch Familienpaten und Ähnliches vorstellen.
Darüber hinaus sind viertens natürlich fördernde Rahmenbedingungen von Bund und Ländern erforderlich, wenn wir, die Kommunen, handeln sollen. Unglaublich wichtig ist: Wir brauchen die Akzeptanz für einen erweiterten Bildungsbegriff. Mir ist heute auch wieder sehr deutlich geworden, dass Bildung, was alle sagen, nicht nur Schule heißt; aber es wird hier doch vor allem von Schule geredet. Davon müssen wir uns lösen. Wenn wir wissen, dass etwa 70 Prozent unseres gesamten Wissens informell erworben ist, dann - glaube ich - haben benachteiligte Stadtteile bei der Bildungsförderung ganz besonders da die allermeisten Chancen: Also nicht das Vollstopfen mit Wissen, das hat man schnell wieder vergessen. Mir ist es wirklich wichtig, dass diese informellen Prozesse bis hin zur Nachbarschaft, Familie usw. gut organisiert werden. Dieser umfassende Bildungsbegriff möge bitte in die Welt kommen, damit wir formal, nonformal und informell Bildung diskutieren und nicht nur formal!
Die konsequente Einführung der Ganztagsschule sollte fünftens vor allem in den benachteiligten Stadtteilen stattfinden, denn benachteiligte Kinder und Jugendliche, solche in schwierigen Lebenssituationen aus schwierigen Familien haben nur über eine richtige Ganztagsschule die Chance, zum Bildungserfolg zu kommen. Diese Mittags- und Nachmittagsbetreuungen, die es auch in Nürnberg gibt, erzeugen für Kinder und Jugendliche sowie für Eltern ein furchtbares Durcheinander, und sie haben vor allem keine pädagogische und keine sozialpädagogische Qualität. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja für viele Eltern von Kindern ab sechs Jahren, wenn das Kind in die Schule geht, ein wahrer Stress. Das muss aufhören. Eltern sollten bitte von diesen Betreuungssorgen entlastet werden.
Über die Integration des Hortes in die Schule, als ersten Schritt zu einer vertieften Kooperation, so wie es beispielsweise in Berlin und Nordrhein-Westfalen der Fall ist, kann und sollte man nachdenken - qualitativ, nicht quantitativ. Zu einer sozialpädagogisch orientierten Ganztagsschule zu kommen, als ein Zeichen der Jugendhilfe, da können wir etwas dazu geben - mindestens in der Grundschule, für Hauptschulen müsste es ein bisschen anders aussehen -, ein Schülertreff oder Sonstiges. Auch da könnten Land und Bund einiges tun mit Modellversuchen, z.B. mit Modellversuchen, die wirklich Mut machen. Ich habe es mit dem IZBB vor Ort erlebt, das ist ein Bauprogramm, aber ich habe immer gehofft, die Konzepte, die dahinter stehen und nötig sind, die sind eine gute Chance. Nein, die Konzeptentwicklung wird zerredet, und jeder geht dann doch in sein "Hasengärtchen". Ich bin nicht sehr zufrieden damit. Ich möchte Modellversuche haben, die Mut machen, die die Komplexität des Ganzen in einen Modellversuch zu bringen versuchen und dieses Hin und Her von Schule und Sozialraum, Öffnung der Schule in das Gemeinwesen usw. auch tatsächlich mitmachen.
Wenn es um Vor-Ort-Allianzen geht, geht es eben auch um die Kommune. Die muss natürlich auch etwas tun. Sie braucht zunächst einmal Mut, sich tatsächlich mit dem Bildungsbereich zusammenzusetzen und auch tatsächlich qualitativ miteinander umzugehen. Wir brauchen Projekte, bei denen die Schule merkt, dass sie von ihnen profitiert, so zum Beispiel von "Hippy" - ich weiß nicht, ob das jemand kennt - oder "Familienpaten". Wir müssen auf jeden Fall diese Bündnisse vor Ort in benachteiligten Stadtteilen schaffen.
Zum Schluss noch - darauf hat das Bundesjugendkuratorium hingewiesen: Wir müssen den Bildungsbedarf definieren und wir brauchen die Bildungsberatung und individuelle Bildungspläne und vor allem: überhaupt mehr Mut zum Handeln.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Vielen Dank. Es sind einige Themen angesprochen, auf die wir nachher zurückkommen müssen.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
 Mich hat gerade in tiefes Grübeln versetzt - das möchte ich später noch wissen -, was ein "Hasengarten" ist. Ich möchte zwei Aspekte besonders betonen, auch wenn sie schon genannt worden sind. Ich will auf unsere Empfehlungen der Bildungskommission der Böll-Stiftung zum Thementeil "Bildung im Stadtteil" und soziale Benachteiligung eingehen und dann kurz zwei Projekte nennen, die sehr konkret auf dieser Ebene agieren.
Mich hat gerade in tiefes Grübeln versetzt - das möchte ich später noch wissen -, was ein "Hasengarten" ist. Ich möchte zwei Aspekte besonders betonen, auch wenn sie schon genannt worden sind. Ich will auf unsere Empfehlungen der Bildungskommission der Böll-Stiftung zum Thementeil "Bildung im Stadtteil" und soziale Benachteiligung eingehen und dann kurz zwei Projekte nennen, die sehr konkret auf dieser Ebene agieren.
Es gibt zwei wesentliche Aspekte. Wir haben den ersten Aspekt insbesondere in unserer zweiten Empfehlung "Chancengleichheit" oder "Umgang mit Gleichheit und Differenz", der dritten "Autonomie von Schulen", und in der fünften, "Lernkonzepte für eine zukunftsfähige Schule" bearbeitet. Wir haben vor allem bei der Frage "Erhöhung der Chancengleichheit" sehr stark darauf gesetzt, dass eine der zentralen Strategien darin bestehen muss, die Attraktivität der Schulen in benachteiligten Gebieten zu erhöhen, das heißt, die Attraktivität dadurch zu erhöhen, dass diese Schulen ganz besonders darin gestärkt werden, besondere Profile zu erarbeiten. Es hat sich erwiesen, dass zum Beispiel künstlerisch-musische Profile sehr attraktiv sind, Profile, die auch die Mittelschicht aus dem ausgebauten Dachgeschoss in Kreuzberg hält (in Neukölln gibt's die weniger), aber auch, dass sehr stark darauf gesetzt werden muss, mit Eltern zu kooperieren - gerade in benachteiligten Regionen. Wir haben uns in der Kita an den angelsächsischen Beispielen Center of early Excellence orientiert. Wahrscheinlich sind die Ihnen schon alle geläufig. Diese Beispiele zielen sehr stark darauf ab, dass die Einrichtungen von unterschiedlichen Administrationen kooperativ getragen werden - das unterscheidet sie deutlich von deutschen -, die sehr stark auf die Kooperation mit Eltern in ihrer Eigenschaft als Erziehungspartner setzen. Diese Einrichtungen werden fortgesetzt in den "Leuchtturm-Schulen", die, anders als der Name sagt, nicht irgendwelche Eliteförderungen darstellen, sondern durch die Vielfalt von Kompetenzen, auch im pädagogischen Personal, gekennzeichnet sind; neben Lehrkräften, Sozialpädagogen, Sozialpsychologen, Künstlern (auch in Berlin, zum Beispiel in der Ferdinand-Freiligrath-Schule wird damit gearbeitet und auch in Grundschulen mit künstlerisch-ästhetischem Profil) ist die Kooperation mit Eltern einbezogen, und es wird auch zum Beispiel mit Verträgen gearbeitet.
Wir haben ausdrücklich zum Thema "Schuleinzugsbereich" eine Position bezogen. Wir haben uns für die Aufhebung von Einzugsbereichen ausgesprochen und haben umgekehrt gesagt: Eltern sollten vor allem in der Grundschule ein Recht auf den Besuch der wohnortnahen Schule haben, darin gestärkt, aber nicht verpflichtet werden. Ich kann aus meiner Berliner Erfahrung - ich habe hier lange Jahre Politik gemacht - sagen: Auch in den Zeiten, als der Einzugsbereich galt, hat nahezu kein Elternteil sein Kind in die Schule gegen den eigenen Willen geschickt. Es gibt so viele Umgehungsmöglichkeiten. Eine Politik, die darauf setzt, dass die Leute nur die Fantasie entwickeln, Umgehungsmöglichkeiten zu finden, ist nicht gut beraten. Sie hat den anderen Effekt: Die Familien ziehen weg, wenn die Kinder fünf Jahre alt sind. Das kann Ihnen das Statistische Landesamt belegen. Dann ist der Entmischungseffekt noch größer, dann wohnt nur noch das Ghetto zusammen.
Wir haben in den Empfehlungen sehr stark darauf gesetzt, Eltern als Kooperationspartner ernst zu nehmen; das heißt, nicht sie per Verordnung zu etwas zwingen zu wollen, was sie partout nicht wollen. Und ich behaupte in meiner These - vielleicht können wir das nachher noch einmal debattieren -, es sollte einfacher sein, Verwaltung zur Zusammenarbeit zu bringen, als die Bevölkerung dazu zu bringen, wohnen zu bleiben, wo sie nicht will, oder in die Schule zu gehen, wo sie nicht will. Wenn man schon bei der Verwaltung scheitert, wird ein solches Steuerungskonzept gegenüber der Bevölkerung und Bildung noch weniger wirken.
Das Zweite: Unsere Konzepte in der Empfehlung setzen auch pädagogisch auf Konzepte der Öffnung von Schulen insbesondere in benachteiligten Gebieten, aber nicht nur dort. Öffnung von Schulen als pädagogisches Konzept, bei dem Schulen als kulturelles Zentrum im Kiez etabliert und darin gestärkt werden, Kooperation mit Kultureinrichtungen aufzubauen und zum Beispiel über Konzepte von Service Learning kommunale Bindungen zu stiften. Service Learning sind Konzepte, wo Schüler selber Verantwortung für bestimmte Projekte - sei es in Jugendbibliotheken, sei es in Kindertagesstätten, sei es als Bringedienste für Ältere und sonst etwas - übernehmen und damit auch lokale Bindungen stiften. Dieses scheint mir als Konzept, auch weil es sehr handlungsorientiert ist, pädagogisch außerordentlich wertvoll.
Zwei praktische Projekte, an denen ich selbst beteiligt bin, die ich leite: Es gibt seit fünf Jahren von der Industrie- und Handelskammer Berlin das Projekt "Partnerschaft Schule - Betrieb". Wir haben da sehr konkret (nicht auf der Ebene "Man könnte mal, man müsste mal") Schulen und Partnerbetriebe zusammengebracht. Schwerpunktmäßig geht es um die Berufsvorbereitung in der Sekundarstufe. Wie können wir die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen verbessern? In der Regel arbeiten Schulen mit einem, zwei, manchmal drei Partnern, wir haben auch Schulen mit vier Partnern. Wir haben mittlerweile insgesamt 76 Schulen, davon 23 Hauptschulen im Projekt. Bei der Auswahl der Partnerschaften haben wir darauf geachtet - und das ist uns, glaube ich, auch zu 90 Prozent gelungen -, dass sich diese Bündnisse im regionalen Verbund herstellen. Dieses sind Versuche, regionale Bindungen zu stützen. Zum Beispiel gibt es zahlreiche Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften, die Partnerschaften auch mit Schulen unterhalten. Die haben auf der einen Seite die Berufsvorbereitung im Blick, auf der anderen Seite machen sie gemeinsam soziale Projekte "Jugendliche und Mieter". Die Wohnungsgesellschaften haben ein konkretes Interesse, mit möglichst vielen Mieterkindern über Schulen Kontakt zu haben, schon damit sie gegen Graffiti-Malereien in Treppenhäusern ein bisschen Einfluss nehmen können. Wir haben im Märkischen Viertel beispielgebende Projekte für gemeinsame Konzepte mit Kindern, mit Jugendlichen der Hauptschule mit älteren Mietern. Es gibt Wohnungsbaugesellschaften, die z.B. Jugendliche Wohnungen entwerfen und sie renovieren lassen. Das sind Kooperationen, die immer auf Dauer angelegt sind, nicht als einzelne Projekte. Da gibt es neben einigen Scheiternserfahrungen zahlreiche Projekte, die verhältnismäßig einfach nachzumachen sind. Infos dazu kann man auch auf der Homepage der Berliner IHK finden.
Das zweite Projekt - und da komme ich auch mit einer Minute aus - ist jetzt das jüngste Kind. Seit Januar schaffe ich mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller ein Bürgernetzwerk Bildung. Wir organisieren für Grundschulen in schwieriger Lage ehrenamtliche freiwillige Lesehelfer. Nachdem wir eigentlich sehr langsam mit fünf Schulen anlaufen wollten, sind wir aufgrund der positiven Berichterstattung geradezu explodiert. Und das ist wirklich erfreulich. Wir haben mittlerweile 34 Schulen, die vermittelt werden wollen. 17 Schulen arbeiten bereits. Voraussetzung ist - damit bewerben sich die Schulen - ein möglichst hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund oder von Sozialhilfeempfängern. Der Verein trägt das Projekt sehr initiativ mit. Es ist richtig, außerschulische Partner in die Bildung einzubeziehen. Wir haben bisher die Schulen - am Anfang waren wir großzügig - mit 20 Freiwilligen versorgt, jetzt werden wir sparsamer: mit zehn bis 15. Wir haben schon 390 Freiwillige den Schulen zugeordnet, knapp 180 sind schon tätig. Und das in einem Zeitraum von fünf Monaten.
Die Zeit ist reif, um sowohl die Schulen dazu zu bewegen, außerschulische Unterstützung anzunehmen, als auch die Menschen in einer Stadt, die qualifiziert sind und die Zeit haben, die etwas tun wollen, zueinander zu bringen. Auch Lichterfelder, die Patenschaften in Kreuzberg übernehmen, leisten Integrationsarbeit. Ich habe gerade einen Leitfaden "Wie basteln wir uns ein Bürgernetzwerk" geschrieben. Den finden Sie unter www.vbki.de. Die Deutsche Kinder- und Jugend-Stiftung hat uns erfreulicherweise zum Projekt des Monats Juni ernannt, und dort werden Sie diesen Leitfaden auch auf der Homepage finden. Wir haben kein Patentrecht, kein Copyright, wir sind froh, wenn es alle nachmachen.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Vielen Dank, das finde ich wichtig. Es ist ja schon das Stichwort "Familienpaten" von Frau Mielenz genannt worden, damit ist die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen angesprochen worden. Das müssen wir nachher noch vertiefen. Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagst Du, das Konzept der Volksschule ist nicht mehr Realität, also geben wir es auf. Wie ist das eigentlich in Umlandgemeinden oder in kleineren Gemeinden? Das Programm Soziale Stadt findet ja überwiegend in kleineren Gemeinden statt. Und dort gibt es ja häufig keine Möglichkeit zum Ausweichen für die Eltern, also für diejenigen, die diese Tricks anwenden und sagen, meine Kinder sollen nicht mit diesen, sondern mit jenen zur Schule gehen. Herr Radtke, haben Sie auch kleinere Städte oder nur Darmstadt und Wiesbaden verglichen?
Frank-Olaf Radtke aus dem Publikum
 Das gibt es auch. Es gibt, was Frau Volkholz beschrieben hat, das Wahlverhalten der Eltern und das Ausweichverhalten der Eltern und den Erfindungsreichtum, den man mit seinem kulturellen und sozialen Kapital zum Einsatz bringt; den gibt es überall, auch in den kleinen Kommunen. Da ist es natürlich zum Teil mit erheblichen Wegen verbunden, das ist dann ein Organisationsproblem. Aber auch das wird realisiert. Ich will, weil ich gerade dran bin, eines noch sagen: Ich habe nicht dafür plädiert, um Gotteswillen, jetzt irgendwelche Zwangsmaßnahmen einzuführen. Nur: Wenn wir uns mit solchen Phänomenen beschäftigen, müssen wir wissen, dass diese Initiative zur Entmischung aus der Mittelschicht hervorgeht.
Das gibt es auch. Es gibt, was Frau Volkholz beschrieben hat, das Wahlverhalten der Eltern und das Ausweichverhalten der Eltern und den Erfindungsreichtum, den man mit seinem kulturellen und sozialen Kapital zum Einsatz bringt; den gibt es überall, auch in den kleinen Kommunen. Da ist es natürlich zum Teil mit erheblichen Wegen verbunden, das ist dann ein Organisationsproblem. Aber auch das wird realisiert. Ich will, weil ich gerade dran bin, eines noch sagen: Ich habe nicht dafür plädiert, um Gotteswillen, jetzt irgendwelche Zwangsmaßnahmen einzuführen. Nur: Wenn wir uns mit solchen Phänomenen beschäftigen, müssen wir wissen, dass diese Initiative zur Entmischung aus der Mittelschicht hervorgeht.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Schon klar. Die Idee, dass die Großstadt kulturell besonders produktiv sei, beruht darauf, dass heterogene soziale Gruppen in räumlicher Nähe und Dichte miteinander interagieren - und dass sie's müssen. Aber das scheint offensichtlich für die Schule schon nicht mehr zu gelten, also haben wir nur noch Provinzschulen - auch in Großstädten.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
Nein, in guten Schulen kriegt man's ja hin. Es gibt Magnetschulen - auch in Berlin. Sie haben ja oft zwei Grundschulen in Neukölln direkt nebeneinander. Die eine kann sich vor Anmeldungen nicht retten, die andere hat Fluchttendenzen.
 Winfried Kneip
Winfried Kneip
Ich kann das mit diesen Magnetschulen bestätigen, das haben wir in unserem Programm auch häufig. Vorab möchte ich Ihnen aber einmal ein Kompliment machen. Sie sitzen jetzt hier schon zweieinhalb Stunden brav und hören zu. Ich hoffe, Sie schaffen das noch die nächsten 30 Minuten und bleiben einigermaßen wach auch bei meinem Vortrag.
 Winfried Kneip
Winfried Kneip
 Dessen bin ich mir bewusst. Ich muss eine Ergänzung zu dem machen, was Frau Milenz eben gesagt hat. Sie sagte, das, was in ministeriellen Gefilden beschlossen wird, kommt selten in Schule an. Wir haben ein wunderbares Beispiel zu zeigen, wo es angekommen ist. Wir werden mit unserem mus-e-Programm im Wesentlichen vom Städtebau- Ministerium NRW gefördert - interessanterweise also nicht vom Kultusministerium, obwohl dieses im gleichen Haus beheimatet ist, sondern aus einem Ministerium, das einen "Sammeltopf" verwaltet, aus dem die "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" finanziert werden. Wir waren eins der wenigen nicht investiven Programme, die aufgelegt wurden. Es wurde intendiert, neben dem Schaffen einer Infrastruktur, die Bedingungen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen durch eine operative Maßnahme zu verbessern.
Dessen bin ich mir bewusst. Ich muss eine Ergänzung zu dem machen, was Frau Milenz eben gesagt hat. Sie sagte, das, was in ministeriellen Gefilden beschlossen wird, kommt selten in Schule an. Wir haben ein wunderbares Beispiel zu zeigen, wo es angekommen ist. Wir werden mit unserem mus-e-Programm im Wesentlichen vom Städtebau- Ministerium NRW gefördert - interessanterweise also nicht vom Kultusministerium, obwohl dieses im gleichen Haus beheimatet ist, sondern aus einem Ministerium, das einen "Sammeltopf" verwaltet, aus dem die "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" finanziert werden. Wir waren eins der wenigen nicht investiven Programme, die aufgelegt wurden. Es wurde intendiert, neben dem Schaffen einer Infrastruktur, die Bedingungen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen durch eine operative Maßnahme zu verbessern.
So ist mus-e, das schon seit 1992 in der Welt ist, gegründet und ins Leben gerufen von Lord Menuhin, ein Programm geworden, das auf einen Schlag in Deutschland groß wurde. Wir haben inzwischen 11 000 Kinder im mus-e-Programm. Wir bedienen mehr als 100 Schulen, haben 460 mus-e-Klassen in drei Regionen Deutschlands (im Saarland, in Bremen und in Nordrhein-Westfalen). Für uns ist wichtig, dass wir mit mus-e einen sympathischen Einstieg in Schule gefunden haben, den eigentlich alle gut finden. So konnten wir eine Veränderung von Schule bzw. eine Veränderung von Schulkultur - was ich vorhin schon einmal kurz angerissen hatte - bewirken, ohne dass es, wie viele andere Programme, in Schule eingreift. Wir kommen von außen, als Partner von Schule, und wir bringen etwas ein, nämlich Künstler, die in den normalen Unterricht gehen. Unsere Künstler aller Sparten - bildende Künstler, Tänzer, Musiker und Theaterleute - gehen zwei Stunden in der Woche in den normalen Unterricht und übernehmen während dieser Zeit sozusagen die Regie; die Lehrer sind mit dabei. Es ist uns gelungen, das Programm innerhalb der letzten sechs Jahre so auszubauen, dass die Lehrer begriffen haben: Es ist auch ein Gewinn für sie. Sie können sich aktiv in einer anderen Rolle beteiligen. Dies ist ein ganz wesentlicher Aspekt.
Wir haben festgestellt: Eine Veränderung von Schule kann nur gelingen, wenn die Lehrer ihre Rolle verändern. Eine Rollenänderung der Lehrer auf dem pädagogischen Wege zu erreichen oder mit dem Angebot von Trainings, wie sie ihre Rolle anders wahrnehmen können, ist sehr schwierig. Wenn man allerdings einen Künstler in der Klasse hat, der von sich aus einen anderen Impetus verfolgt, nämlich nicht ergebnisorientiert, sondern prozessorientiert zu arbeiten und das Scheitern sozusagen als pädagogisches Prinzip in die Schule einzuführen, und daraus lernt, dann entdecken die Lehrer im Prozess, dass Lernen auch anders funktionieren kann. Das ist unsere Erfahrung.
Wichtig war dabei vor allem, dass wir die Lehrer dabei begleitet haben. Wir haben sie nicht einfach mit einem Künstler zusammengebracht und bei entstehenden Konflikten gehofft, dass sie sich irgendwie zusammenraufen, sondern wir haben diese Konflikte begleitet. Wir haben sie als einen Impuls für Veränderung verstanden und entsprechende Programme aufgelegt. Wir haben Künstler und Lehrer trainiert, wir haben beide Parteien zusammengebracht und versucht, daraus gemeinsam zu lernen. Das ist uns gelungen. Denn was wir gespiegelt bekommen, ist, dass die Schulen, die einmal mit mus-e begonnen haben, damit gar nicht mehr aufhören wollen. Unser Vorteil ist, dass wir kein kurzfristiges Projekt sind, was in die Schule geht und dann nach einer bestimmten Zeit - wie viele andere Kunstprojekte - wieder verschwindet. Unser Vorteil ist zudem, dass wir über mindestens drei Jahre in einer Klasse bleiben. Die Kinder in den Grundschulen haben Künstler, die für sie da sind, die sie über die Zeit kennen lernen - und von denen sie einen anderen Lebensentwurf geboten bekommen. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
Das Projekt hat verschiedene Implikationen, die für uns sehr wichtig sind. Zum einen ist es uns gelungen, darüber wirklich eine Art Schulkultur in der Schule zu etablieren, denn das, was die Kinder erleben - wenn sie tanzen, wenn sie Theaterstücke aufführen, wenn sie singen oder wenn sie trommeln -, hat natürlich auch etwas "Anarchisches", das über die Klassengrenzen hinaus dringt. Die ganze Schule, auch wenn es in einer Schule nur vier oder fünf Klassen sein mögen, die mus-e haben, nimmt mehr oder weniger an diesem Programm teil. Denn das, was erarbeitet wird, wird immer wieder in der Schule und ihrem Umfeld gezeigt. Da kommt oft etwas ins Spiel - wir bewegen uns im Bereich der Sozialen Stadt -, das eine Identifikation der Eltern ermöglicht: Sie sehen ihre Kinder, die auf der Bühne stehen und auf dem Schulfest tanzen, singen und sich einbringen in einer Art und Weise, die sie bis jetzt nicht gewohnt waren.
Wir erfahren immer wieder, dass Eltern und Lehrer erzählen: Kinder, die bis dato keine "Sprache" hatten, die sich schlecht einbringen konnten, entdeckten über das Tanzen oder über das Trommeln eine Begabung bei sich, die ihnen half, in den Unterricht integriert zu werden und vor allem eine Akzeptanz bei ihren Mitschülern zu bekommen, die sie vorher nicht hatten. Da erfolgt über die Kunst, die Menuhin als Universalsprache der Menschen bezeichnet hat, so etwas wie Integration auf sanftem Weg, in kreativer Weise. Darüber hinaus entsteht der Effekt, dass eine Schule durch mus-e auch eine gewisse Strahlkraft erlangt: Wenn Feste und Ausstellungen stattfinden, wenn Ergebnisse der Arbeit gezeigt werden, dann entsteht so etwas wie ein kreatives Schulprofil. Wir hören immer wieder von mus-e-Schulen, dass bei ihnen die Eltern gegen den Trend dafür sorgen, dass ihre Kinder trotz des hohen Ausländeranteils von teilweise 70 bis 80 Prozent auf der Schule bleiben. Wir sehen auch Vergleichsschulen direkt nebenan, und da haben wir genau das, was Sie vorhin beschrieben haben. Strahlkraft in den Schulen ist ein sehr positiver Aspekt, der mit unserem Programm mus-e verknüpft ist.
Ich möchte noch einen kleinen Exkurs zur offenen Ganztagsgrundschule machen, weil sie heute hier schon oft genannt wurde. Bei der offenen Ganztagsgrundschule erleben wir oftmals das Gegenteil. Das ist eigentlich traurig, denn sehr viele Künstler arbeiten im Nachmittagsbereich. Daneben tummeln sich noch viele andere Professionen. Interessant ist, dass das Ganztagsschulkonzept, das heute Morgen immer wieder so schön beschrieben wurde, gar nicht durchgehalten werden kann, weil tatsächlich in vielen Fällen gar kein Konzept dahinter steht. Im Ganztag treffen sich drei verschiedene Welten, die nur im Idealfall eine Vermischung miteinander haben: Es gibt die Anbieter im Nachmittagsbereich, es gibt die Betreuer, die im Nachmittagsbereich die pädagogische Kompetenz haben, und es gibt die Lehrer. Und zwischen Vormittag und Nachmittag, das ist unsere Erfahrung, passiert viel zu wenig an bindender Kraft. Daran muss noch enorm viel gearbeitet werden.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Aber ich verstehe das doch richtig, dass Ihr Programm nicht speziell gedacht ist als Programm für benachteiligte Stadtteile oder Schulen mit besonderen Problemen, sondern als ein allgemeines Lockerungs- und Verbesserungsprogramm von Schulpädagogik?
 Winfried Kneip
Winfried Kneip
Ja und nein, also jein. Lord Menuhin hatte, als er mus-e ins Leben gerufen hat, betont, dass eigentlich jedes Kind so früh wie möglich die Rahmenbedingungen braucht, um kreativ tätig zu sein. Und im Grunde fängt Schule mit dem falschen Ansatz an - nämlich mit dem kognitiven Aspekt, wo eigentlich Tanzen und Singen zuerst kommen müssten. Andererseits hat Menuhin gesagt, dass wir da beginnen müssen, wo die Kinder es am nötigsten haben, nämlich in den sozialen Brennpunkten. Insofern ist unser Programm explizit zuerst einmal für soziale Brennpunkte bestimmt.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Danke. "Da anfangen, wo es die Kinder am nötigsten haben", das ist wahrscheinlich auch bei der Schulgesundheit das Problem - Bewegung.
 Prof. Dr. Peter Paulus
Prof. Dr. Peter Paulus
 Ja, nicht nur Bewegung, sondern man muss, glaube ich, das Problem viel umfassender angehen. Und ich kann Ihnen über ein Modellprogramm berichten, das ich initiiert habe und jetzt auch wissenschaftlich leite. Es ist von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen worden, wird aber jetzt schon nicht mehr von ihr allein getragen. Das Programm ist im Moment in drei Bundesländern vertreten, unter anderem in Berlin, in Berlin- Mitte, in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald und in Bayern, in Bad Kissingen. Wir sind dabei, das Programm auch noch in andere Bundesländer auszuweiten. Unser Ziel ist es, kommunale Schullandschaften zu entwickeln, also vor Ort in den Regionen tätig zu werden, Schulen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, gute Schulen zu werden, ihre Bildungs- und Erziehungsqualität zu steigern.
Ja, nicht nur Bewegung, sondern man muss, glaube ich, das Problem viel umfassender angehen. Und ich kann Ihnen über ein Modellprogramm berichten, das ich initiiert habe und jetzt auch wissenschaftlich leite. Es ist von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen worden, wird aber jetzt schon nicht mehr von ihr allein getragen. Das Programm ist im Moment in drei Bundesländern vertreten, unter anderem in Berlin, in Berlin- Mitte, in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald und in Bayern, in Bad Kissingen. Wir sind dabei, das Programm auch noch in andere Bundesländer auszuweiten. Unser Ziel ist es, kommunale Schullandschaften zu entwickeln, also vor Ort in den Regionen tätig zu werden, Schulen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, gute Schulen zu werden, ihre Bildungs- und Erziehungsqualität zu steigern.
Das Programm trägt den Namen "Anschub.de" ("Allianz für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung") (2002-2007). Diese Allianz ist ein Versuch, die schulische Gesundheitsförderung neu zu beleben, einen anderen Akzent zu setzen. Ich selbst bin seit 1982 in der schulischen Gesundheitserziehung bzw. -förderung tätig und habe die beiden großen bundesweiten Modellversuche "Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen" (1993-1997) und OPUS ("Offenes Partizipationsnetz und Schulgesundheit") (1997-2000) wissenschaftlich begleitet. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass in dem Feld schulischer Gesundheitsförderung sehr viele Akteure unterwegs sind, die zum Teil mit einem enormen Investment, aber auch zum Teil ganz klein und lokal, bewundernswerte Aktionen starten, die aber häufig auch nach Projektende verpuffen, weil die Ressourcen fehlen. Es fehlt oftmals auch eine Verständigung darüber, was man erreichen möchte, um mehr Schlagkraft zu entwickeln.
Die Bertelsmann Stiftung war nun hier der Auffassung, man müsse anders herangehen. Wir haben dann anderthalb Jahre damit verbracht, bundesweit alle in der schulischen Gesundheitsförderung initiativen Akteure zusammenzubringen, nach Gütersloh einzuladen und mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, was überhaupt Sache ist, was in Schule eigentlich gemacht werden müsse und aus welchen Gründen man da etwas im Bereich der Gesundheit unternehmen müsse. Wir haben etwa 60 nationale Institutionen identifiziert. Und mit ihnen ein Delphi-Verfahren neben drei großen Foren veranstaltet, um ein gemeinsames Positionspapier zu verabschieden. Am Ende sind etwa 40 Partner übrig geblieben, die das Positionspapier unterschrieben und gesagt haben: Ja, wir wollen auf diesem neuen Weg der schulischen Gesundheitsförderung gehen, wir wollen das Programm unterstützen.
Bedauerlicherweise ist es mit den gesetzlichen Krankenkassen, die etwa zeitgleich das große GKV-Projekt "Gesund leben lernen" aufgelegt haben, um schulische Gesundheit nach vorn zu bringen - obwohl sie von uns eingeladen waren, obwohl sie auf unseren Foren dabei waren -, zu keiner Kooperation gekommen. Da sieht man, dass nicht immer, wenn man nach Kooperation ruft, auch Leute folgen, weil auch konkurrierende Organisations- und Einzelinteressen eine Rolle spielen können. Aber wir müssen da vorankommen, denn am Ende kommen relativ ähnliche Dinge heraus. Dann heißt es, lass uns doch kooperieren und zusammenarbeiten, und das ist ein mühseliges Geschäft. Aber wir haben dieses Positionspapier erreicht, wir haben eine Allianz von über 40 Institutionen bundesweit schmieden können, die dabei sind, schulische Gesundheitsförderung neu zu entwickeln.
Was ist nun aber das Neue bei der schulischen Gesundheitsförderung? Meine Erfahrung war, dass wenn wir das Thema Gesundheit in den Vordergrund stellen, Schulen dies häufig als einen Auftrag empfinden, den sie zusätzlich zu dem, was sie alles schon machen müssen, erfüllen sollen, und dass deshalb bei vielen Schulen eine Reserve da ist. Natürlich ist man bei denen, die kooperativ sind, gut aufgehoben; die machen dann auch mit. Aber das hat Grenzen. Nach dem letzten großen OPUS-Modellversuch mit 15 Bundesländern waren es am Ende 500 Schulen, die mitgemacht haben. Das ist nicht so viel, wenn man sich überlegt, wie viele Schulen wir insgesamt haben. Da gibt es für mich eine Gerechtigkeitslücke. Man beschränkt sich dann auf wenige Schulen. Aber was ist mit den anderen, die ja auch die Gesundheitsprobleme haben?
Man muss, glaube ich, anders an das Problem herangehen: Man muss die Sichtweise, die Perspektive verändern, um neu auf das Problem schauen zu können. Die Schulen empfinden, dass Gesundheit von außen an sie herangetragen wird und nicht ihre eigenen zentralen pädagogischen Anliegen trifft. Das stimmt ja auch. Wo kommt die Gesundheitsförderung denn her, woher kommen die Gelder, die dafür bereitgestellt werden? Die kommen alle aus dem Gesundheitssektor. Die zentralen Akteure sind die Krankenkassen der Bundesrepublik. Europaweit ist es das Public Health Programme der EU, aus dem das Geld kommt und durch das versucht wird, das bevölkerungspolitisch wichtige Thema in die Schulen hineinzubringen und Schulen dafür zu gewinnen. Und da kommt man natürlich an Grenzen, wie ich sie gerade schon erwähnt habe.
Der andere Weg ist nun zu sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass die Schulen Gesundheit zum Thema machen, sondern wir wollen Bildung mit Gesundheit fördern. Wir wollen Schulen dabei unterstützen, gute Schulen zu sein. Das tun wir mit Gesundheitsinvestitionen. Wir wollen, dass Schulen gute gesunde Schulen werden. Deshalb nennen wir uns auch gar nicht mehr "gesundheitsfördernde Schulen", sondern, "gute gesunde Schulen".
Das Gesundheitsthema steht nicht mehr im Vordergrund, es geht um Bildungsförderung. Bildungsförderung ist im Interesse von vielen, die in der Schule tätig sind. Ich hoffe: von allen Schulen und Lehrkräften. Ich hoffe, dass wir jetzt auch diejenigen Personen ansprechen können, die Gesundheit nicht als Erstes auf ihrer Agenda haben, sondern die gute Lehrer sein und gute Schulen machen wollen.
Die hohe Attraktivität wird sich, glaube ich, erweisen. Wir haben in dem Modellversuch im Moment noch 50 Schulen. Wir werden das noch stark erweitern. Wir waren bisher damit beschäftigt, Strukturen in den Ländern aufzubauen. Wir waren mit dem Positionspapier beschäftigt. Wir haben die Diskussion angeregt. Wir haben erreicht, dass z.B. die Schweiz ihr nationales Projekt vollständig umgestellt hat auf das Konzept der guten gesunden Schule, dass Nordrhein-Westfalen das größte bundesweite Projekt der schulischen Gesundheitsförderung, das Projekt "Gute gesunde Schule", zentral in sein Landesprogramm aufgenommen hat. Da kommt der Begriff "gesundheitsfördernde Schule" gar nicht mehr vor.
Schulen haben natürlich auch einen Bildungsauftrag, der sich direkt auf Gesundheit bezieht. Aber auch das muss man gut machen, und da sind wir mit Anschub.de auch unterwegs. Wir stellen z.B. gemeinsam mit Lehrkräften entwickelte Module her, die die beteiligten Schulen nutzen können. Wir konzentrieren uns auf das SEIS-Qualitätskonzept der Bertelsmann Stiftung der guten Schule (www.das-macht-schule.de). Wir arbeiten sozusagen in dieses Qualitätskonzept hinein und unterstützen die Schulen, die damit arbeiten wollen. Da passen unsere Module hinein, da passt unsere Beratung hinein, da passt unsere Fort- und Weiterbildung hinein. Wir sind dabei, auf Europaebene auch bei dem European Network und dem Health-Promoting-Schools-Project, das von der Weltgesundheitsorganisation getragen wird, die Idee unterzubringen, dass es darum geht, mit Gesundheit gute Schule zu machen.
 Prof. Dr. Peter Paulus
Prof. Dr. Peter Paulus
Noch nicht direkt. Ich denke aber, dass wir hier in Berlin mit Anschub bald mit dem Programm Soziale Stadt kooperieren werden. In Niedersachsen befindet sich ein größeres Projekt zur "Guten gesunden Schule in der sozialen Stadt" in der Planung. Deshalb unter anderem bin ich auch hier, um Kontakte zu knüpfen, Möglichkeiten zu finden, wie wir die Idee, mit Gesundheit gute Schule zu machen, mit Ihren Anliegen, die auch meine sind, zu verbinden. Wenn wir mit Gesundheit in Bildung investieren, sind wir auf einem guten Weg, dem zentralen Anliegen der Gesundheitsförderung gerecht zu werden: Mit dazu beitragen, dass die soziale Ungleichheit verringert wird.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Vielen Dank. Das ist also ähnlich, wie das mit Kultur und Künstlern in der Schule zu sehen ist. Es sind Angebote oder Initiativen, die das Schulklima, das Lernklima, das Erleben von Schule bei Kindern verändern sollen. Das ist sicher sehr wichtig, insbesondere in den Gebieten, die zu den Soziale-Stadt-Gebieten gehören. Da gibt es Akteure, die von außerhalb kommen, Stiftungen, die etwas anstoßen, was dann Bewegung wird, die in verschiedene Schulen hineinwirkt. Aber insgesamt ist mir aus allen Beiträgen das Thema dieses Podiums "Strategische Allianzen ...", noch nicht ganz klar geworden. Wer sind eigentlich die wichtigsten Partner für strategische Allianzen, um in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf die Schulen zu entwickeln - und umgekehrt, durch die Entwicklung der Schulen auch die Quartiere zu stabilisieren? Was sind strategische Ziele oder strategische Bündnisse, und wer sind die wichtigsten Partner?
Wir haben einiges über Stiftungen gehört, über Eltern, über zivilgesellschaftliches Engagement. Die Kooperation zwischen den Verwaltungen ist allgemein als schwierig - wir wollen nicht so viel darüber reden, weil es sowieso nicht geht, das ist mein Eindruck - behandelt worden. Wenn das so wäre, wäre mit den strategischen Allianzen eine ganz andere Dimension aufgemacht: strategische Allianzen zur Verbesserung des Zusammenhangs von Bildung und Stadtteil sind eigentlich nur möglich zwischen Akteuren, die traditionell mit Bildung nichts zu tun haben. Also: Die professionelle Bildungsverwaltung, das Bildungssystem, wie es Herr Radtke genannt hat, ist eigentlich dafür nicht geeignet. Ist das richtig?
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
 Ich denke, strategische Allianzen kann man - mindestens zunächst - nur mit denjenigen bilden, die tatsächlich vor Ort sind. Natürlich nützt mir die positive Rahmenbedingung. Wenn sich die Hierarchen gut verstehen, ist das sehr wichtig, aber vor Ort ist es noch viel wichtiger. Und da sind Jugendhilfe und Schule sehr stark regionalisiert. Beide Einrichtungen fungieren sozialräumlich, also sollten sie so etwas wie eine federführende Kooperation vor Ort übernehmen, um dann alle anderen mit einzubeziehen. Schule heißt natürlich: die Schulleitung, die Lehrer, die Sozialpädagogen, das sind die Kindergärten und die Jugendarbeit. Dann muss man sehen, wie man Eltern und Kinder mit auf den Weg nimmt unter Einbeziehung sämtlicher Aspekte, also auch Ehrenamtliche usw.
Ich denke, strategische Allianzen kann man - mindestens zunächst - nur mit denjenigen bilden, die tatsächlich vor Ort sind. Natürlich nützt mir die positive Rahmenbedingung. Wenn sich die Hierarchen gut verstehen, ist das sehr wichtig, aber vor Ort ist es noch viel wichtiger. Und da sind Jugendhilfe und Schule sehr stark regionalisiert. Beide Einrichtungen fungieren sozialräumlich, also sollten sie so etwas wie eine federführende Kooperation vor Ort übernehmen, um dann alle anderen mit einzubeziehen. Schule heißt natürlich: die Schulleitung, die Lehrer, die Sozialpädagogen, das sind die Kindergärten und die Jugendarbeit. Dann muss man sehen, wie man Eltern und Kinder mit auf den Weg nimmt unter Einbeziehung sämtlicher Aspekte, also auch Ehrenamtliche usw.
Ich möchte noch einen Satz zur Gesundheit sagen. Gerade in benachteiligten Stadtteilen gibt es ein Ernährungsproblem. Und es gibt sehr viele Ehrenamtliche, die z.B. ein Schulfrühstück liefern. Schon das ist ein Problem. Nicht nur die gesunde Schule, sondern auch die Gesundheit in der Schule spielen bei den Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Also: Hauptakteure Kinder-, Jugendhilfe sowie die Schule, und wenn wir ein sozialpädagogisches Konzept brauchen, muss der Sozialbereich auch kräftig mit einbezogen werden.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Du betrachtest es doch mehr aus Deinen Erfahrungen als Kommunalpolitikerin und sagst: Die Instanzen, die gibt es, die sind dafür verantwortlich, die sollen jetzt endlich mal das tun, wofür es sie gibt. Aber bei Dir (5) habe ich eher herausgehört, dass es Skepsis gegenüber der Fähigkeit dieser Institution gibt und dass man eher andere Akteure mobilisieren muss.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Meine Skepsis gegenüber den Verwaltungen bedeutet erstens nicht, dass ich die Arbeit grundsätzlich negativ bewerte, und zweitens nicht, dass ich sie herausnehmen würde. Bildungsministerien, auch im Land Berlin - da ist man natürlich gleich sehr eng an den Bezirken dran -, haben ihre Aufgaben und nehmen sie zunehmend auch wahr. Sie nehmen sie nicht immer in der Funktion wahr, wie ich sie gerne hätte, aber sie nehmen sie wahr. Ich würde sie weder aus der Verantwortung herausnehmen noch pauschal sagen, sie täten dies nicht. Das wäre wirklich falsch. Die vielen Konzepte, die vorhin von Herrn Hübner aufgezählt worden sind, sind insgesamt Konzepte, die in eine positive Richtung gehen. Die sind natürlich auch von der Verwaltung initiiert, und zwar sowohl vom Bund wie auch vom Land.
Ich glaube, dass man für eine strategische Allianz allerdings auch immer neue Partner braucht, weil man sonst nicht aus den gewohnten Perspektiven herauskommt. Verwaltungen haben nun mal die Tendenz, in ihrer traditionellen Arbeit hängen zu bleiben. Sie brauchen immer Organisationsentwicklungskonzepte, Projektgruppen, Steuerungsgruppen. Zum Beispiel ist es in Berlin offensichtlich nicht möglich: Die Jugendverwaltung arbeitet nach dem Wohnraumprinzip der Bevölkerung, die Schule natürlich nicht; dass damit eine Schule beispielsweise 20 Ansprechpartner bei der Jugendhilfe hat, ist bisher nicht zu ändern. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf, warum auf Senatsebene eine Steuerungsgruppe diesen Prozess der sozialräumlichen Gestaltung nicht forcieren kann. Die Jugendhilfe konnte z.B. einmal in der Woche ihre Sprechstunde in der Schule abhalten. Natürlich muss das gehen, aber um es zu machen, dafür braucht es ressortübergreifende Steuerungsgruppen, die es für andere Projekte auch gibt.
Ich würde zweitens definitiv dafür plädieren - man nennt das jetzt häufig zivilgesellschaftliche Institutionen -, die Stiftungen einzubeziehen. Die sind sehr wohl in der Lage, privates Geld für öffentliche Aufgaben einzuholen, was ich für außerordentlich wünschenswert halte. Ich mache persönlich überhaupt kein Projekt mehr, das eine öffentliche Haushaltszuwendung benötigt. Damit macht man sich ja fürs Leben unglücklich. Außerdem wecken Stiftungen oft neue Potenziale. Ich meine: Für Bildung von Kindern können sich mehr Leute verantwortlich fühlen als der Staat, die Eltern und die Lehrkräfte. Wenn die Leute weniger Kinder haben - demographischer Faktor -, muss es doch gerade Aufgabe sein, die Leute mit den wenigen oder die ohne Kinder dazu zu bringen, etwas für die Kinder der anderen zu tun, ohne damit die professionelle Arbeit der Lehrkräfte in Frage zu stellen, sondern sie zu unterstützen.
Die Bertelsmann Stiftung wird oft negativ bezeichnet als das 17. Kultusministerium. Ich finde, die machen eine hervorragende Arbeit. Das Netzwerk "Innovative Schulen" war eine neue Form von Lehrerfortbildung, und die haben die logistische Leistung dafür bereitgestellt. Das betrifft auch die Frage Qualitätsentwicklung. Die bringen eine Menge neuer Initiativen, auch mit neuen Akteuren, in dieses Feld. Wenn wir die gesellschaftliche Wertschätzung von Bildung erhöhen wollen, heißt das auch, den Personenkreis derer zu vergrößern, die sich darum kümmern. Als Letztes würde ich in die strategischen Allianzen auch auf einer Landes- oder einer kommunalen Ebene immer Wirtschaftsverbände, IHKs mit einbeziehen. Die sind lange von der Schule auf Distanz gehalten worden. Das ändert sich Gott sei Dank, weil der Handlungsdruck so groß ist. Aber die gehören mit in die strategischen Überlegungen, weil sie einerseits Abnehmer sind und andererseits legitimerweise auch Anforderungen an Schule und an Bildungseinrichtungen stellen.
 Dr. Josef Faltermeier
Dr. Josef Faltermeier
Ich kann das, was die beiden Vorrednerinnen ausgeführt haben, nur bestätigen. Ich kann es deshalb auch kurz machen. Aber ich möchte Sie doch noch einmal fragen: Was sind überhaupt die Ziele solcher strategischen Allianzen? Das unterstellt ja schon ein Stück weit, dass man zwischen verschiedenen Bündnispartnern ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Ziel verhandeln und vereinbaren kann. Wenn ich jetzt aber an die Bündnisebene von Schule und Jugendhilfe denke, da sehe ich noch erhebliche Lücken, was die Verständigung über gemeinsame Ziele angeht.
Wenn wir das auf die sozialen Brennpunkte, also auf Stadtteile mit schwierigen sozialen Infrastrukturen herunter deklinieren, dann müsste sich im Grunde genommen die Verständigung über ein strategisches Ziel darauf beziehen, zu vermeiden, dass sozial benachteiligte Lebensverhältnisse sich in entsprechenden benachteiligenden Bildungskarrieren fortsetzen. Das wäre ein doch sehr schnell nachvollziehbares strategisches Ziel, auf das sich beide Bündnispartner verständigen können. Doch da gibt es große Schwierigkeiten, weil erstens das nicht so zwingend in diesem Dialog unterstellt wird, dass das eine mit dem anderen immer etwas zu tun hat. Da gibt es noch sehr viele, die dem sehr kritisch gegenüberstehen. Und zum anderen ist es wichtig, dass wir von dieser Beliebigkeit und Zufälligkeit der Kooperation von Schule und Jugendhilfe wegkommen.
Ich glaube, es gibt keine Stadt, keine Kommune, in der es nicht irgendwelche Vereinbarungen zwischen Schule und Jugendhilfe gibt. Aber es gibt sehr viele Kommunen, in denen trotz dieser Vereinbarungen eine Kooperation nicht einmal im Ansatz entwickelt ist. Das heißt, wir brauchen hier auch ein neues Verständnis von Bildungskultur, die wie selbstverständlich beinhaltet, dass sozialpädagogische Fachkräfte an Lehrerkonferenzen teilnehmen, um frühzeitig auch über Entwicklungen an den Schulen und über Einzelfallschicksale informiert zu werden, wie umgekehrt natürlich die Lehrkräfte - jetzt nehme ich einmal nur einen Aspekt heraus - an den Hilfeplankonferenzen der Jugendhilfe beteiligt sind. Solche Selbstverständlichkeiten sind ja eher die Ausnahme als die Regel.
Zweitens komme ich noch einmal auf die strategischen Bündnisse mit der Wirtschaft zu sprechen: Das war für uns ein zweiter wichtiger Baustein in unserem Konzept, dass wir versucht haben, neben den Betrieben vor Ort auch insbesondere die Arbeitsverwaltung, Industrie- und Handwerkskammer, Schulen und Jugendhilfevertreter sowie Freie Träger in diesen Ressourcenaustauschprozess einzubinden, damit es zur Verständigung auch über gemeinsame Problemdefinitionen im Stadtteil kommt und über das, was man da tun kann.
 Winfried Kneip
Winfried Kneip
Ganz kurz zwei Aspekte, darunter ein ganz praktischer: Strategische Allianz in Stadtteilen im Programm Soziale Stadt bedeutet - zumindest in NRW, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist - Kontakt zu Stadtteilbüros, die sind in jedem Fall der erste strategische Partner. Über diese Schnittstelle kann man dann wiederum an andere Beteiligte kommen, weil die Stadtteilkoordinatoren über lokale Kontakte verfügen. Zweitens versuchen wir Leute einzubeziehen, die vor Ort sind, das heißt Unternehmen, kleine Geschäfte usw. Wir haben nicht das Glück, als Stiftung mit einem großen Vermögen ausgestattet zu sein, wir sind also eine "arme Stiftung". Wir leben davon, dass wir Spenden einwerben. Das Ministerium gibt z.B. 80 Prozent, die restlichen 20 Prozent müssen wir bei anderen Förderern akquirieren. Wenn wir vor Ort Partner finden, die die Restfördersumme von 20 Prozent, also im Jahr 500 Euro für eine Klasse aufbringen können, dann haben wir es geschafft, auch da eine strategische Allianz zu bilden, indem man Leute direkt an die Schule als Schulpaten gebunden hat, die dann für ihre Klasse zuständig sind.
Ein anderer Punkt: Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Geduld haben, weil insbesondere in der offenen Ganztagsschule Partner aufeinander treffen, die eine unterschiedliche Sicht haben. Aber die müssen zusammenkommen, weil es gar nicht anders geht. Das System entwickelt sich dahin, dass Jugendhilfe und Jugendarbeit sich immer mehr in die Schule verlagern. Dieses Plätzerücken und Positionen-Einnehmen - das wird noch ein bisschen dauern - wird dazu führen, dass wir trotzdem in Bälde eine angemessene Lösung finden. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
 Petra Jung
Petra Jung
Mir fällt da noch die Moderatorenrolle ein. Ich glaube, das entspricht dem, was alle anderen gesagt haben. Wir brauchen vielleicht auch Moderatoren, die Schule und Jugendhilfe vor Ort näher zusammenbringen. Wir haben dies ja mit diesen Serviceagenturen versucht, jetzt erst einmal mit Hilfe der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir haben uns dieser Stiftung bedient, einmal weil sie Kinder- und Jugendstiftung heißt und weil wir natürlich einen Kooperationspartner mit den Ländern brauchen. Wenn wir jedes Mal als Bund an die Länder herangingen, würden wir zu sehr wenig kommen. Und insofern hat die Stiftung für uns eine Multiplikatoren- und auch Moderationsfunktion eingenommen, um die Prozesse etwas zu beschleunigen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil man sich hinter diesen neutralen Stiftungen auch gut Prozesse vorstellen kann, die man selber nicht initiieren kann.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Die Vorteile und das Herausheben von Innovationen, Aktivität, Ausweitung der Akteure, Erschließung unterschiedlicher Ressourcen für neue Schulpolitik, das ist ganz eindeutig ein Impuls, der in den letzten Jahren entstanden ist und von den Stiftungen unterstützt wird. Auf der anderen Seite ist es aber für eine kontinuierliche Politik doch wichtig, dass die staatlichen Institutionen eine wichtige Rolle spielen. Die haben sie automatisch, und es geht darum, dass sie diese in innovativer Weise wahrnehmen. Man kann nicht sagen: Lass die weitermachen wie bisher, wir aber machen lauter innovative Projekte. Insbesondere bei der Umverteilung von Ressourcen versagt natürlich jede durch einzelne Stiftungen gesteuerte Politik. Das kann nur der Staat, das kann nur eine Stadt.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
Die Arbeitszeit von Lehrern bitte nicht vernachlässigen!
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Jetzt einmal meine Frage, bevor ich auch noch dem Publikum Gelegenheit geben will, Fragen zu stellen: Es gibt sowohl in Frankreich in dem Programm Politique de la ville als auch in dem Programm in Großbritannien jeweils bildungspolitische Sonderprogramme wie Éducation prioritaire in Frankreich oder Education priority in England. Bei uns gibt es so etwas nicht. Ich vermute, dass das damit zu tun hat, dass wir kein Bundeskultusministerium haben, also dass wir einfach Löcher dort haben, wo die Kompetenzen und die Institutionen sein müssten, die so etwas zueinander bringen. Ist das auch Ihre Meinung? Oder denken Sie, es ist gut, dass wir das nicht haben, dass wir wenig Staat in diesem Bereich haben? Diesen Eindruck hatte ich jetzt manchmal. Oder müsste man sagen, hier müsste mehr passieren, wenn man strategische Allianzen zur Bildungsförderung in benachteiligten Stadtteilen braucht? Wir haben ja gesehen, wie groß der Aufwand ist, um da überhaupt etwas zu bewegen.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
 Ich würde, ganz ehrlich gesagt, davor warnen, dies im Zusammenhang mit der Föderalismusdebatte zu sehen, weil ich glaube, dass es hierfür völlig egal ist, ob die Kompetenz beim Bund oder beim Land liegt. Kanada hat ähnliche Programme, und die haben einen noch stärkeren Föderalismus als wir. Wir haben ein Problem und deshalb nicht so ein Modell wie Frankreich. In Berlin z.B. gab es ja über Jahrzehnte Strukturprogramme. Es gab Sonderzuwendungen für Bezirke mit einem verhältnismäßig hohen Migrantenoder Sozialhilfeanteil. Besondere Zuwendungen gibt es jetzt immer noch. Nur hat es überhaupt keine inhaltlichen Konzepte gegeben. Da flossen immer mehr Geld und mehr Stellen in die Bereiche mit dem wunderbaren Effekt, ...
Ich würde, ganz ehrlich gesagt, davor warnen, dies im Zusammenhang mit der Föderalismusdebatte zu sehen, weil ich glaube, dass es hierfür völlig egal ist, ob die Kompetenz beim Bund oder beim Land liegt. Kanada hat ähnliche Programme, und die haben einen noch stärkeren Föderalismus als wir. Wir haben ein Problem und deshalb nicht so ein Modell wie Frankreich. In Berlin z.B. gab es ja über Jahrzehnte Strukturprogramme. Es gab Sonderzuwendungen für Bezirke mit einem verhältnismäßig hohen Migrantenoder Sozialhilfeanteil. Besondere Zuwendungen gibt es jetzt immer noch. Nur hat es überhaupt keine inhaltlichen Konzepte gegeben. Da flossen immer mehr Geld und mehr Stellen in die Bereiche mit dem wunderbaren Effekt, ...
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
... nicht mal notwendig in den Bildungsbereich, das kann ja überall verwendet werden.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Die gab es auch als Lehrerstellen zusätzlich in den Gebieten, ohne dass irgendwer darauf geguckt hätte, was da eigentlich inhaltlich passiert. Da können sie jede Menge wie in einen Eimer mit Loch kippen, ohne dass das irgendetwas bewirkt. "Deutsch als Zweitsprache" dagegen, ein Modell, das in so einen Bereich mit einem gezielten Programm eingreift, das gibt es jetzt, ich glaube, in Berlin seit zwei Jahren. Das ist natürlich ein Ansatz: deutscher Spracherwerb für Kinder mit Migrationshintergrund, der genau auf einen richtigen Punkt zielt.
Man könnte so ähnliche kompakte Modelle basteln. Aber ich glaube, es fehlt uns ein bisschen die inhaltliche Kompetenz, weil diese Bereiche wissenschaftlich wenig bearbeitet worden sind. Das heißt, es gab kaum Bereiche, die inhaltlich wirklich sinnvolle Vorschläge machten, und das ist in angelsächsischen Ländern anders. Wenn man sich anguckt, wie lange sich Wissenschaft mit Problemen der Zuwanderung befasst hat, wie lange sie schon ewig second language im Programm haben und wann sich Leute überhaupt inhaltlich damit beschäftigt haben, was braucht es da an spezifischen pädagogischen Erfordernissen, um Kinder mit Benachteiligten zu fördern?! Das entsteht bei uns erst jetzt.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
Dann muss aber auch sehr konsequent die Frage gestellt werden, was diese Republik bereit ist, in Bildung zu investieren. Denn dass wir Unzulänglichkeiten haben, ist relativ deutlich. Es ist richtig, dass sich vor Ort die Leute schlecht engagieren können, wenn sich der Rahmen nicht insgesamt ändert. Das erfordert nicht unbedingt ganz viel Geld.
Eine Schule zum Lokalzentrum, zum neuen Bildungsort zu machen, kann doch gar nicht so kompliziert sein, wenn die Gebäude und Schulhöfe geöffnet werden und z.B. auch Wochenendnutzungen möglich wären.
Hauptakteure - die Frage möchte ich noch beantworten. Hauptakteur, wenn ich so kleinräumig vorgehe, ist immer der Allgemeine Sozialdienst. Der müsste Bescheid wissen, was vor Ort los ist. Es sind die Lehrer, die natürlich die Kinder und die Eltern kennen müssten. Aber es ist auch die Polizei. Ich habe benachteiligte Strukturen, und die Polizei weiß recht gut Bescheid, was alles vor Ort los ist.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Wir haben auch Schulen, die eine Kooperation mit der benachbarten Polizeidirektion haben.
 Petra Jung
Petra Jung
An der Ganztagsschule gibt es jetzt schon mehrere Arbeitszeitmodelle. Wir waren kürzlich in Bremen. 35 Stunden Präsenzzeit beinhaltet natürlich auch, dass die Lehrer einen Arbeitsplatz an der Schule erhalten. Das ist mit den Bundesmitteln aus dem Investitionsprogramm jetzt möglich geworden, und Bremen hat das umfassend genutzt. Dort wurden den Lehrern Arbeitsplätze mit Computerausstattung usw. an der Schule eingerichtet, so dass jetzt jede neue gebundene Ganztagsgrundschule in Bremen von dem Lehrerpräsenzarbeitszeitmodell profitiert: 35 Stunden Präsenzpflicht an der Schule. Das ist abgestimmt mit den Gewerkschaften, und das klappt inzwischen. Die Lehrer machen inzwischen sogar - wir haben mit einigen darüber gesprochen - mit Begeisterung mit, weil sie selbst damit auch entlastet werden. Es gelingt ihnen mit dem mehr an Zeit, intensiver zusammenzuarbeiten, als es die Lehrerin oder der Lehrer als Einzelkämpfer bisher getan hat. Diese Teamarbeit fehlt den Lehrern an den normalen Halbtagsschulen häufig. Jeder ist ja dort für sein Fach oder seine beiden Fächer zuständig und will oftmals mit den anderen Kolleginnen und Kollegen gar nicht so viel zu tun haben. Ein ganztägiges Schulmodell fördert die Teambildung und die Zusammenarbeit der Lehrer auch über Klassen und Fächergrenzen hinweg.
 Prof. Dr. Peter Paulus
Prof. Dr. Peter Paulus
Ich möchte noch etwas sagen, weil Stiftungen mehrfach angesprochen worden sind. Bei der Bertelsmann Stiftung, bei dem Projekt, in dem ich tätig bin, geht es nicht darum, dass die Stiftung irgendetwas dominiert, sondern sie initiiert etwas. Wir wollen eine verlässliche Allianz für Schulen in der Bundesrepublik haben, was es bisher nicht gegeben hat. Schulen sind vor Ort manchmal ganz auf sich allein gestellt und versuchen, Unterstützung, Allianzen aufzubauen. Bottom-up und Top-down müssen natürlich da sein. Schulen müssen das Gefühl haben, dass erwünscht ist, wenn sie sich bewegen, etwas Neues zu entwickeln, dass da Partner und Verlässlichkeiten sind. Wir haben die Ministerien auf Landesebene und auf Bundesebene im Boot. Wir versuchen, eine Allianz herzustellen, so dass wir aus der vorherigen Situation, wo es so etwas noch nicht gab, wo nur auf Schulebene agiert wurde, auf die politische Ebene kommen, um dort Verlässlichkeit und Strukturen hineinzubringen. Das ist das Ziel unseres Projekts.
Wir wollen die Diskussion um Gesundheit in Schulen mit der Bildungsdiskussion verbinden, dass nicht irgendwelche Lehrer an irgendwelchen Schulen schöne Projekte machen, die mit Gesundheit zu tun haben, sondern dass sie evidenzbasiert, das heißt an den Gesundheitsproblemen der Schülerinnen und Schüler orientiert sind. Gerade ist erwähnt worden, dass Schüler auch Gesundheitsprobleme haben. Natürlich haben wir die Themenfelder - wenn ich z.B. Berlin nenne -, Ernährung, Bewegung, Stress, Sucht, Gewalt, Eltern, auch Elternmitarbeit. Über Schüler haben wir noch gar nicht gesprochen, die müssen ja auch mit dabei sein, auch Gebäudemanagement. Wir haben ein eigenes Modul zum so genannten Facility Management entwickelt, weil es ein Riesenproblem in Schulen ist, die Gebäude instand zu halten.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Ist es eigentlich so, wie ich manchmal aus Gesprächen mit Vertretern von Schulämtern erfahren habe, dass die Intensivierung der Mitarbeit von Eltern, auch die Erschließung von Ressourcen über die Eltern, die Unterschiede zwischen den Schulen vergrößert? Weil die Stadtteile, wo Eltern über Mittel oder über Bildung, über genügend Zeit und über Engagement verfügen, eben die Schulen haben, wo auch die Bildungsleistungen der Kinder höher sind als anderswo? Und dort, wo besondere Bildungsanstrengungen und Anstrengungen der Schule notwendig wären, man gerade nicht auf Ressourcen bei den Eltern zurückgreifen kann? Wir hatten vorhin auch als Thema "Einbeziehung der Eltern". Gibt es da Erfahrungen? Ist diese Einbeziehung von Eltern eigentlich eine Verfestigung, eine Verstärkung der sozialen Unterschiede, der Leistungsunterschiede zwischen den Schulen?
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Die Schulen sind sehr unterschiedlich. Jede vernünftige Schule hat einen Förderverein. Natürlich verfügt die Zehlendorfer Schule über erheblich mehr Möglichkeiten. Die hat kaum Probleme, besondere Anschaffungen für ihre Schule zu machen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Kooperation mit Eltern ist mehr ein inhaltliches Problem, je mehr man die Einnahmemöglichkeiten der Schulen transparent macht, desto besser können die Unterschiede ausgeglichen werden. Verhindert werden können die nicht. Außerdem: Warum sollte man auch Eltern daran hindern, für ihre Schule zu stiften. Das wäre ganz fatal angesichts knapper öffentlicher Haushalte. Es geht mehr darum anzuregen: Macht mal alle Einnahmen, Ihr müsst nicht unbedingt einen Förderverein gründen, sondern Ihr könnt als Schule Einnahmen machen und legt dann eine Bilanz vor! Dann kann man gucken, wie man die Schulen, die richtige Schwierigkeiten haben, unterstützen und dafür gezielt auch noch Sponsoren finden kann.
Mit meinem Plädoyer für Stiftungen und privates Engagement entlasse ich nicht den Staat aus der Verantwortung. Ich sage nur, man braucht dieses als zusätzliche Potenziale. Ich würde nur nach wie vor davor warnen, wenn die Verwaltungen sagen, wir sind die alleinigen Macher; dies in der klaren Erkenntnis, dass sie es weder alleine steuern können, noch es sinnvoll ist, alleine Innovationspotenziale von Verwaltungsseite aus anregen zu wollen. Es ist hilfreich, dafür andere Akteure mit ins Boot zu holen, auch die Kommunen, die müssen mit ins Boot.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Es war ja nur eine Frage. Ich meine, dass es große Unterschiede zwischen Quartieren, entsprechend auch zwischen Schulen bei Ressourcenausstattung und Fähigkeiten von Eltern und Fördervereinen gibt, das ist dramatisch. Die Unterschiede kann man sich bereits jetzt gar nicht groß genug vorstellen. Aber wenn man auf "Autonomisierung der Schule" und "stärkeres Engagement der Schule" setzt, dann ist meine Frage: Werden diese Unterschiede nicht noch mehr vergrößert, und wer kümmert sich um die Schulen, in denen diese Ressourcen nicht vorhanden sind?
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Ich weiß, dass dieses Argument sehr häufig mit der Frage "Autonomie von Schulen" verbunden worden ist. Ich habe mich zehn Jahre lang wirklich damit auseinander gesetzt. Ich glaube, man darf eine Sache nicht unterschätzen: Eine Autonomie von Schulen, die Schulen Freiräume gibt, z.B. auch werben zu können, sich Sponsoren zu suchen, die kann gerade den benachteiligten Schulen helfen. Viele Sponsoren denken nicht so begrenzt, z.B. nur in eine Zehlendorfer Schule, wo schon vermögende Eltern sind, noch zusätzliches Geld reinzugeben. Ich kenne eine Reihe von Schulen in schwieriger Umgebung, die finden ihre Sponsoren. Und ein kluger Unternehmer weiß auch, dass nicht nur Zehlendorfer Kinder hinterher etwas kaufen, sondern die anderen auch. Die haben ein Interesse gerade auch daran. Dann hängt es auch davon ab, wie klug Schulleitungen agieren. Wenn es dann immer noch nicht klappt, kann hier zusätzliche Unterstützung gegeben werden. Nur so wird ein Schuh daraus, indem man niemanden an der Entwicklung von Aktivitäten hindert, sondern denjenigen, die es bei allen Bemühungen schwerer haben als die anderen, zusätzliche Potenziale ermöglicht.
 Winfried Kneip
Winfried Kneip
Das kann ich bestätigen. Ich bin an einem anderen Programm beteiligt, das sich das "Buddy-Projekt" nennt und von der Vodafone Stiftung gefördert wird. Die Stiftung arbeitet ganz gezielt in Schulen in sozialen Brennpunkten, weil sie weiß, dass das auch einen Öffentlichkeitsaspekt hat. Unternehmen sind meines Erachtens eher bereit, in benachteiligte Stadtteile zu investieren.
Was ich eigentlich sagen wollte, betraf einen anderen Punkt. Sicher ist der Aspekt Bildung über Elternengagement usw., also dass eine Diskrepanz zwischen Schulen entstanden ist, die ein sehr hohes Elternengagement haben, und solchen, die das eben nicht haben, relevant. Aber ich warne ein bisschen davor, immer nur den Bildungsaspekt zu betonen, weil ich z.B. auch Schulen in besonders bevorzugten Stadtteilen kenne, die ich auch in gewisser Weise als "soziale Brennpunkte" ansehen würde, weil die Kinder alles bekommen - obwohl die Eltern da engagiert sind. Es gibt auch eine Schulkultur, die teilweise sogar in benachteiligten Stadtteilen höher ist, weil die Pädagogen dort viel mehr Engagement haben, z.B. in Hauptschulen, und dort auch ein ganz anderes Schulleben schaffen. Das ist natürlich nur ein relevanter Aspekt, den man aber nicht vernachlässigen darf. Ich möchte nicht immer auf den Bildungsaspekt als Schlüssel zu allem abgehoben wissen.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Das habe ich nicht ganz verstanden. Es geht um die Ressourcen der Eltern; es gibt natürlich auch Eltern, die man aus der Schule lieber draußen halten möchte. Aber in bestimmten Bereichen gibt es viele Eltern, die über Bildungsressourcen, kulturelles Kapital und soziales Kapital verfügen, Beziehung zu allem Möglichen und auch noch Geld dazu haben.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Ich wollte einen Punkt ergänzen. Ich finde, das beste Beispiel ist dieser "Verein Berliner Kaufleute und Industrieller". Das ist ein Traditionsunternehmen, und der Verein wäre auch nicht beleidigt, wenn man ihn eher als konservativ bezeichnen würde. Der hat früher seine bildungspolitischen Projekte eher in dem Bereich Abschöpfung der Creme aus dem Bildungsbereich angesiedelt. Seit Jahren - und das ist auch ein PISA-Effekt - verlagert der zunehmend seine Aktivitäten auf frühere Bildungsphasen und auf benachteiligte Gebiete, unterstützt Lehramtsstudierende beim Förderunterricht für Migranten, jetzt auch dieses Projekt "Benachteiligte Schulen in schwieriger Lage". Es ist doch eine Erkenntnis, dass eine soziale Orientierung für viele zunehmend an Akzeptanz gewinnt.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
Es ist ja fast Schluss, da würde ich gerne doch noch etwas sagen. Ich würde ganz unzufrieden nach Hause fahren, wenn ich noch Dezernentin in Nürnberg wäre und nicht im Januar in meinem Job aufgehört hätte. Es würde mich allein lassen, ich weiß nicht so richtig, was ich tun sollte, weil die großen Rahmenbedingungen ja nicht kommen. Die Ganztagsschule ist - mindestens in Bayern mit Mittags- und Nachmittagsbetreuung - ein ziemliches Gemurkse. Ich habe Jugendhilfeträger, die sich in dem Bereich engagieren. Ich habe Gott sei Dank auch einen Bürgerverein in benachteiligten Stadtgebieten und so etwas wie Stadtteilarbeitskreise. Ich habe ehrenamtliches Engagement in diesen Stadtgebieten. Es fällt nicht schwer, Bürger zu aktivieren.
Aber was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn das Thema "Individuelle Bildungsförderung mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen" heißt, wie verknüpfe ich denn nun die formalen Seiten - mir ist hier ein bisschen zuviel von Schule die Rede gewesen - mit den nicht formalen, also Jugendarbeit, und vor allen Dingen die informellen, wie fülle ich das denn mit Leben, was es informell heißt, mit Bildungsförderung umzugehen? Da würde ich mich schon wieder zu Hause hinsetzen müssen, mir ein paar Leute holen und darüber nachdenken, wie ich denn so ein Setting zusammensetze, damit das eine in das andere greift, damit ein Jugendlicher nicht erlebt, dass der Papa auf der Couch liegt, und dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendetwas zu lernen, weil man ja doch keine Arbeitsstelle kriegt. Wie kriege ich das hin, dass ein Jugendlicher - zwölf Jahre, spricht nur Russisch - tatsächlich die deutsche Sprache lernt und sich aus seinen Cliquen ein Stückchen weiter heraus auch in andere Bereiche hinein bewegt? Wie muss ich diese Angebote strukturieren, damit diese ganze Vielfalt in irgendeiner Form gelebt wird? Ich habe wirklich nichts gegen Stiftungen, aber es kann nicht sein, dass ich vor Ort drei Stiftungen zusammenschnalle, und die machen's dann. Das geht doch nicht. Die sind hilfreich, wenn ich bestimmte Dinge tun will, von der Musik zum Sport. Auch der Sportverein ist hilfreich vor Ort, aber die eigentliche Verantwortung, die Steuerung, da können wir uns doch nicht aus der Verantwortung ziehen, der Bund, das Land und auch die Kommunen nicht!
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
So war das aber auch nicht gemeint. Das sagt ja so keiner.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Darf ich das noch einmal klären. Wir haben über Allianzen gesprochen, aber über strategische Allianzen. Wer setzt die Ziele, wer sind die zentralen Akteure, wen muss man auf jeden Fall an den Tisch kriegen? Ist dieser Leitfaden zum Basteln von Netzwerken dabei hilfreich?
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Der Leitfaden zum Basteln des Bürgernetzwerkes Bildung sagt nur etwas darüber aus, wie ich ehrenamtliche Lesehelfer in die Schule bringe. Das ist nicht die Frage der strategischen Allianz. Die darf ich auch nicht an der großen strategischen Allianz abarbeiten. Das ist eine konkrete Lesehilfe für benachteiligte Kinder, um diese systematisch ans Lernen heranzuführen. Das ist auch etwas wert. Die Verwaltung ist im Boot, die weiß das, die unterstützt das, die gibt uns notfalls, wenn sie will, auch Hilfen für Schulen. Es entlastet die doch keiner. Auf der anderen Seite könnte die Verwaltung - eine ministerielle oder eine kommunale - doch ihrerseits die Initiative dafür übernehmen und die weiteren Akteure einbinden. Von daher finde ich es einen Fehler, dieses als Konkurrenz zu sehen: Wir brauchen doch gerade Kooperationsmodelle auch in einer neuen Form, weil wir mit den bisherigen Lösungen nicht so weit gekommen sind.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Was jetzt deutlich geworden ist und was hier am Tisch auch vorgestellt worden ist, sind hilfreiche Innovativen, aber es ist auch deutlich geworden, dass es keine Institution, Strategie oder Konzeption dafür gibt, systematisch die Bildung im Stadtteil mit der Quartiersentwicklung zu verknüpfen. Das war ja unsere Frage am Anfang dieser Diskussion. Und da würde ich sagen, das Ergebnis ist Zero.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Das fände ich ganz unglücklich, wenn das Ergebnis dieser Debatte als Zero bezeichnet würde. Ich war neulich auf einer Veranstaltung in Kooperation mit dem Bezirksamt Neukölln und der Bürgerstiftung Neukölln - ich weiß nicht, ob noch ein Dritter dabei war -, die unseren Bezirk Neukölln zu einem Open Space-Treffen eingeladen haben. Es waren etwa 300 Beteiligte, es gab 15 Thementische, und man hatte eine unglaubliche Vielfalt von Initiativen, die in diesem Bereich tätig sind, die auflisteten, welche Probleme vorhanden sind und wie wir besser kooperieren können. Das ist doch ein Ansatz, bei dem die Kommune sich mit Unterstützung von der Stiftung hinsetzt - noch ein dritter Akteur, ich weiß nicht ob von der Senatsverwaltung -, um die unterschiedlichen Initiativen vor Ort zusammenzubringen und zu fragen: Wie schaffen wir es, dass die Stadtteilbibliothek mit der Schule und dem Quartiersmanagement zusammenarbeitet und die Akteure sich kennen?
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Gut, aber wir haben Hunderttausende von Lehrern, die nach bestimmten Programmen, Curricula in den schulischen Institutionen arbeiten, die nach meiner Ansicht von dieser Thematik der sozialen Stadtentwicklung mehr mitkriegen müssten, als das bisher der Fall ist. Und wir haben gesehen, dass auf der lokalen Ebene - und alle diese Beispiele, die Sie hier genannt haben, sind ja wunderbare Beispiele - eine Zusammenarbeit mit den Lehrern und mit den Schulen in solchen Projekten immer gut funktioniert. Es liegt also nicht daran, dass die Lehrer stur und blöd sind und das nicht wollten. Aber es gibt eine institutionelle Grenze zwischen der Stadtpolitik und der Schulpolitik, der Kulturverwaltung, den Kultusministerien. Und da habe ich heute keine Ansätze gesehen, wie man diese Grenze überwinden könnte, weil es so etwas wie Education priority oder die französischen Programme nicht gibt.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, die sind bei uns aus bestimmten Gründen noch nicht entwickelt. Ich bin da gar nicht skeptisch, dass solche Sachen notwendig wären.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Ja, aber die müssen nicht alleine nur von einer Verwaltung entwickelt werden. Das können die wahrscheinlich nicht.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Dann danke ich jetzt sehr, da haben wir ein Ergebnis. Wir sind jetzt zeitnah bei dem, was im Programm "Imbiss" heißt - aber wenn Sie jetzt noch mehr Fragen als Hunger haben, gibt es noch die Möglichkeit, zu diskutieren.
Michael Hüttenberger, Schulleiter der Erich-Kästner-Schule, Darmstadt, aus dem Publikum
Ich mache Ihnen einmal zum Ende Ihrer theoretischen Diskussion einen Vorschlag. Bleiben Sie heute Nachmittag noch ein bisschen da, da werden Sie mitbekommen, dass es eine ganze Menge Projekte gibt, die funktionieren. Und wenn diese Projekte nicht nur eine Viertelstunde hätten, um zu zeigen, dass sie funktionieren, sondern mehr Zeit hätten, könnten wir vielleicht auch der einen oder anderen Frage nachgehen, wie es denn funktioniert hat, dass es zu einem solchen Projekt geworden ist.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Wir haben gar keinen Zweifel daran, dass es diese wunderbaren Projekte gibt. Die sitzen auch auf dem Podium. Also das ist jetzt nicht der richtige Einwand gegenüber dem, was wir diskutiert haben.
Michael Hüttenberger,
Ich mache den Einwand deswegen, weil mich schon zum Schluss die Ratlosigkeit gestört hat, um diese Zero-Runde zu vermeiden. Wir haben ein riesiges Potenzial an Projekten, die über Ihre theoretischen Überlegungen hinaus sich einer Betrachtung lohnen. Und wenn wir schon eine Institutionsbegleitung bräuchten, schlage ich vor, einfach einmal zu gucken, was die Projekte vor Ort hergeben, um aus ihrer exemplarischen Funktion ein paar Dinge abzuleiten, die in der Tat dann in eine staatliche Steuerungsfunktion münden können.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Ja, es ist schön und gut, und wir hören Ihnen auch nachher zu, aber es ist ein systematisches Problem, ob man meint, diesem Thema durch viele Beispiele allein beikommen zu können oder ob man noch ein zweites Problem sieht. Und das ist das, was wir jetzt am Ende diskutiert haben.
Matthias Frinken, Plancontor GmbH, Hamburg, aus dem Publikum
Einer Bemerkung ganz zum Schluss würde ich gern widersprechen. Ich arbeite in mehreren Bundesländern in solchen Stadtquartieren über das Programm Soziale Stadt. Ich habe häufig den Eindruck, wenn Veranstaltungen in den Schulen gemacht werden, dann sind abends die Lehrer nicht da. Mich würde doch auch sehr interessieren, was in Hauptschulen und in anderen weiterführenden Schulen los ist, wie da Kooperationen möglich sind, weil ich glaube - ich erlaube mir einen Satz zur Begründung dafür -, dass das schlimmste Urteil, was Kindern widerfahren kann, ist, wenn sie nach der vierten oder sechsten Grundschulklasse mitkriegen: Für Dich ist nur die Hauptschule gut. Und dann erst geht der Frust los. Dann treffen sie auf andere und machen untereinander die Erfahrung - wie Sie so sagten: Papa liegt auf dem Sofa und sagt, warum sollst Du überhaupt noch etwas lernen, Du kriegst sowie keinen Arbeitsplatz. Ich glaube, dass diese Erfahrung ganz stark ein Hauptschulthema ist. Und da müssen wir eigentlich raus.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Möchte noch jemand etwas dazu sagen? Grundschule war durch ein Referat, was wir vor der Diskussion hatten, vorgegeben. Die Projekte aber sind, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht begrenzt.
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Das IHK-Projekt betrifft den Sekundarschulbereich. Das Projekt mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller findet in Grundschulen statt.
 Ingrid Mielenz
Ingrid Mielenz
Doch, ich möchte noch einen Satz sagen. Das Ziel des ganzen Nachdenkens ist es ja, dass man in benachteiligten Stadtgebieten für benachteiligte Kinder und Jugendliche einen Bildungserfolg herbeiführt, der Voraussetzung ist, damit sie sich aus dieser Schicht, hoffentlich nicht aus dem Stadtteil, aber aus dieser Schicht herausentwickeln können. Das ist das Begehren, und den Beweis, dass alles, was wir tun und denken, genau zu diesem Erfolg führt, dass sich soziale Schichten nicht im negativen Sinne reproduzieren, den Beweis, denke ich, wer kann ihn schon antreten?
 Sybille Volkholz
Sybille Volkholz
Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie auf die Schulstrukturdebatte hinaus? Ich glaube, dass wir in der Tat mit der Konstruktion der Hauptschule ein Problem haben. Bei unserer Empfehlung der Böll-Stiftung haben wir uns dafür ausgesprochen, die Individualisierung, den Umgang mit Heterogenität zu fördern und alle Schulentwicklungsprozesse hierin zu unterstützen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man die Schulstrukturdebatte als Systemfrage in den Vordergrund rückt, dann erreicht man nur eins, dass sich konkret nichts mehr bewegt. Deswegen gucke ich lieber, wie man Förderungskonzepte für Entwicklungsprozesse kriegt, bei denen in der Tat die Individualisierung von Lernprozessen und die individuelle Förderung im Vordergrund stehen. Vielleicht erreichen wir einmal, dass irgendwann die Schulform nicht mehr so hoch und emotional von verschiedenen Seiten besetzt ist, wie sie das offensichtlich immer noch ist.
 Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Prof. Dr. Hartmut Häußermann
Wir kommen jetzt zum Ende dieses Programmteils. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass es nicht darum geht, die einzelnen Beispiele, die Initiativen und diese Vielfalt von wirklich guten und interessanten Innovationen, die es im Schulbereich gibt, irgendwie in ihrer Bedeutung zu mindern. Nach dem, was die PISA-Untersuchungen uns gezeigt haben und wo die Ursachen für diese Ergebnisse liegen - Herr Radtke hat ja auch darauf hingewiesen -, geht es auch darum, sich klar zu machen, dass doch die Probleme den Rang dessen haben, was man in den 60er-, 70er-Jahren "Bildungskatastrophe" genannt hat, und dass eine große Anstrengung notwendig ist, um diese Bildungskatastrophe zu mindern oder zu beseitigen. Ein großer Teil dieser Anstrengung wird sich in den Stadtteilen vollziehen müssen, die im Programm Soziale Stadt sind. Das ist eigentlich der Kern dessen, worauf ich immer wieder hinaus wollte: dass diese inhaltlichen Anregungen und auch die vielen wunderbaren Beispiele systematisch in die Schulen hineingetragen werden müssen - dass die Schulen transformiert werden müssen.
Die Beispiele, da bin ich völlig einig, werden aus vielen gesellschaftlichen Bereichen kommen und wahrscheinlich zuletzt aus den Amtsstuben. Aber sie müssen irgendwie auch in die Amtsstuben hinein. Und das war meine Frage, weil wir in unserem föderalen System - ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, wie das in Kanada funktioniert - das Programm Soziale Stadt, was ein Bund-Länder-Programm ist, haben und die Länder- Kultusministerien, so weit ich das beurteilen kann, bisher davon weitgehend keine Notiz nehmen. Vielleicht gibt es schöne Beispiele nachher, wo das ausgehebelt wird und wo man Ansatzpunkte sieht, das zu überwinden. Aber das Problem, wo ich sagte "Zero", liegt darin, dass es zwischen den Aktivitäten der Kultusverwaltungen und den Projekten "Soziale Stadt" noch kaum Verbindungen gibt. Die Komplexität dieser Probleme in den Stadtteilen zu begreifen, darin liegt der Wert solcher Projekte, wie wir sie hier gehört haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(1) Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Sechs Empfehlungen der Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung, "Selbstständig lernen - Bildung stärkt Zivilgesellschaft", Weinheim 2004. ![]()
(2) IfS, Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Die Soziale Stadt. Ergebnisse der Zwischenevaluierung, Berlin 2004. ![]()
(3) Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB). ![]()
(4) Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. ![]()
(5) An Sybille Volkholz gerichtet. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 22.09.2005