soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
6.4 Bedeutung nichtstaatlicher Ressourcen
Die größten privaten Investoren in den Gebieten der Sozialen Stadt sind die Wohnungsunternehmen. Sie modernisieren ihren Wohnungsbestand vor allem in den Großsiedlungen und Plattenbauten, verbessern auf eigenem Grund und Boden das Wohnumfeld, stellen Hausmeister oder Concierges ein - nicht selten Langzeitarbeitslose aus dem Gebiet - und beschäftigen zum Teil Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um die Wohngebiete zu stabilisieren (1). Nach einer Befragung des GdW Bundesverbandes Deutscher Wohnungsunternehmen e.V. bei seinen Mitgliedsunternehmen im Jahr 2001 haben 225 Unternehmen - das sind allerdings nur acht Prozent der Mitgliedsunternehmen des GdW -, Wohnungsbestände in Programmgebieten der Sozialen Stadt. Aber nur etwa die Hälfte dieser Unternehmen ist an der Programmgestaltung beteiligt, und nur knapp ein Viertel leistet einen eigenen finanziellen Beitrag zur Programmumsetzung. Diese 60 Unternehmen haben im Jahr 2001 44,9 Mio. Euro Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt erhalten und ihrerseits weitere 43,3 Mio. Euro investiert. Dabei lagen die gesamte Investitionssumme der Wohnungsunternehmen in den neuen Ländern bei 7,6 Mio. Euro und die ihnen zugute gekommene Fördersumme bei 14,9 Mio. Euro, wohingegen in den alten Ländern die gesamte Investitionssumme 35,3 Mio. Euro und die an die Unternehmen geflossene Fördersumme nur 30,0 Mio. Euro betrugen (2).
Wie die Ergebnisse der zweiten Befragung des Difu zeigen, werden in gut der Hälfte der Gebiete Mittel der Wohnungswirtschaft eingesetzt. Insgesamt besteht bei den Wohnungsunternehmen, aber auch bei den privaten Einzeleigentümern, die in den Altbaugebieten eine größere Rolle spielen, ein Konflikt zwischen kurzfristiger Gewinnerwartung und langfristiger Sicherung des Gebäudewerts, zwischen Stabilisierung der vorhandenen Bevölkerungsstruktur und Aufwertung des Gebiets mit der Folge von Verdrängung bisheriger Bewohnerinnen und Bewohner. Mittel von Wirtschaftsunternehmen spielen nur in einem Fünftel der Gebiete eine Rolle. Mittel sonstiger Privater werden in gut einem Drittel der Programmgebiete eingesetzt.
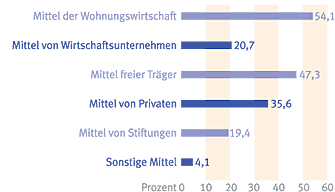 |
Abbildung 73: |
|
Deutsches Institut für Urbanistik |
Das finanzielle Engagement nichtstaatlicher Akteure ist in manchen benachteiligten Stadtteilen höher als die zur Verfügung stehenden Fördermittel aus öffentlicher Hand. So setzten beispielsweise im Modellgebiet Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke- Nord sowohl die Evangelische Kirche als auch private Hauseigentümer finanzielle Ressourcen im Rahmen des Stadtteilprogramms ein. Investiert wurde in den Neubau der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck, in die "Solarsiedlung Bismarck" sowie die "Einfach und Selber Bauen-Siedlung". Darüber hinaus flossen umfangreiche Mittel von zwei Wohnungsunternehmen, der Gemeinnützigen Gelsenkirchener Wohnungsgesellschaft (GGW) und der Treuhandstelle THS, in die Wohnungsmodernisierung und die Wohnumfeldverbesserung im Quartier (3).
Auch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege setzen Eigen- und Fremdfördermittel für soziale Zwecke (z.B. Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsförderung, Ausländerintegration) in den Gebieten ein. Die Höhe der so zum Einsatz kommenden Mittel ist zwar nicht bekannt, sie dürfte aber erheblich sein; wie die zweite Befragung erbrachte, werden in fast der Hälfte aller Programmgebiete Mittel freier Träger eingesetzt.
Gerade in den Gebieten der Sozialen Stadt spielen "social sponsoring" und "corporate citizenship" eine besondere Rolle (4). Unterschiedliche Initiativen wie "startsocial - der Wettbewerb für soziale Ideen" (5) und "Unternehmen: Partner der Jugend (UPJ)" (6) lenken ihr Engagement auch in Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Während "startsocial" thematisch den Wissenstransfer aus der Wirtschaft in den sozialen Bereich unterstützt, vernetzt die Bundesinitiative UPJ Einrichtungen der Jugend- und Sozialarbeit mit überwiegend kleinen und mittelständischen Wirtschaftsunternehmen auf lokaler und regionaler Ebene. Solche freiwilligen Einsätze in Gebieten der Sozialen Stadt von Unternehmen außerhalb der Gebiete können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Kontakte der Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebiet heraus zu fördern und umgekehrt das Verständnis für die besondere Situation der Menschen in diesen Gebieten bei Bewohnerinnen und Bewohnern und vor allem Unternehmen anderer Stadtteile zu erhöhen.
Die Auslobung des Wettbewerbs Soziale Stadt in den Jahren 2000 (7) und 2002 (8) ist ein weiteres gutes Beispiel für das gemeinsame Engagement unterschiedlicher Beteiligter, die Ansätze und Ziele des Programms unterstützen wollen. Bei diesem Wettbewerb, der nicht auf die Programmgebiete beschränkt ist, werden innovative Ansätze der Mittelbündelung und integrative Projekte, die verschiedene Handlungsfelder miteinander verknüpfen, ausgezeichnet. Der Wettbewerb zeigt ebenso wie zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen der Wohnungsunternehmen, der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Einrichtungen, z.B. von Stiftungen wie der Schader-Stiftung oder der ZEIT-Stiftung, dass die Ziele und Ansätze des Programms Soziale Stadt auch außerhalb des Kreises der unmittelbar Beteiligten auf breite Zustimmung treffen und viel Unterstützung erfahren.
(1) Michael Sachs, Wohnungsunternehmen gestalten soziale Stadt, in: Bundes-SGK Sozialdemokratische Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (Hrsg.), Zukunft Stadt. Mit den Menschen für die Menschen, Berlin 2001, S. 133-141 und Jan Kuhnert, Integrierte Sanierung von Stadtteilen in Hannover. Die Großsiedlung der Zukunft als "solidarische Stadt", in: der städtetag, H. 8 (2000), S. 32-36. ![]()
(2) GdW-Statistik 2001 zum Programm Soziale Stadt (unveröffentlicht). An der Befragung beteiligten sich insgesamt 2 832 Wohnungsunternehmen. ![]()
(3) Austermann/Ruiz/Sauter, S. 42 ff. ![]()
(4) Vgl. hierzu: Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements", Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft,Bericht vom 3. Juni 2002, Bundestags-Drucksache, 14/8900. ![]()
(5) Nähere Informationen siehe unter http://www.startsocial.de ![]()
(6) Nähere Informationen siehe unter http://www.upj-online.de. ![]()
(7) GdW Bundesverband Deutscher Wohnungsunternehmen e.V., Berlin (Hrsg.), Dokumentation des Wettbewerbes Preis Soziale Stadt 2000. Preisträger, Anerkennungen, Projekte der engeren Wahl, Teilnehmer, Berlin 2001. ![]()
(8) GdW Bundesverband Deutscher Wohnungsunternehmen e.V., Berlin (Hrsg.), Dokumentation des Wettbewerbes Preis Soziale Stadt 2002. Preisträger, Anerkennungen, Projekte der engeren Wahl, Teilnehmer, Berlin 2002. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005