soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Chancen und Restriktionen für die Arbeit
der Quartiermanagement-Teams –
Visionen für das Programm Soziale Stadt
Podiums- und Plenumsdiskussion
Moderation:Dr. Heidede Becker |
|
|
|
|
Cäcilia Scheffler |
|
|
Veronika Gottmann |
|
|
Stefan Seifert |
|
|
Helene Luig-Arlt |
|
|
Martin Höckmann |
|
|
Rudolf Raabe |
|
 |
Heidede Becker, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
|
Wir sind hier Vertreter und Vertreterinnen aus sechs Arbeitsgruppen und haben mit Herrn Raabe aus Hessen einen Vertreter der Länder mit auf dem Podium. Wir beginnen mit den kurzen Statements als Kommentar zum Thema des Podiums, nämlich "Chancen und Restriktion für die Arbeit der Quartiermanagement-Teams". Und vielleicht gelingt es uns auch noch, Visionen für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt zu entwickeln. Für die Arbeitsgruppe "Aktivierung der Bevölkerung" jetzt Herr Bader von der Fachhochschule Lüneburg; er ist in dem Bereich Psychologie und Gemeinwesenentwicklung tätig. |
 |
Kurt Bader, Fachhochschule Nordostniedersachsen, Lüneburg
|
Ich bin von der Arbeitsgruppe autorisiert worden, auch einige persönliche Einfärbungen vorzunehmen. Zwei Vorbemerkungen, erstens: Der Kollege Klaus Düwal hat heute Geburtstag, und ich möchte ihm von hier alles Gute wünschen. Zweitens habe ich eine Bitte an das Difu: Wir haben festgestellt, dass einige Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten an dem Projekt Soziale Stadt beteiligt sind. Unsere Bitte und Anregung: Vielleicht könnte das Difu mithelfen, ein Zusammentreffen der beteiligten Hochschulen zu organisieren, um herauszubekommen, welchen Beitrag sie für die Entwicklung des Programms leisten können. Die Fragestellung in unserer Arbeitsgruppe war: Was kann Quartiermanagement leisten, um die Bewohnerbeteiligung zu stärken? Wir wollen notwendige Voraussetzungen formulieren. Das heißt, wir nehmen den "Impuls" im Titel "Impulskongress" ernst und hoffen, dass die von uns formulierten Forderungen auch umgesetzt und lauthals in die Lande getragen werden, um nicht in die Situation zu geraten, das Programm schönzureden, sondern es als Plattform zu nutzen, um weitere notwendige Schritte zur Sprache zu bringen. Wir haben acht Forderungen und Statements formuliert. |
|
Punkt 1: Weg mit der Trennung von investiven Mitteln einerseits und sozialen Mitteln andererseits! Es geht um die Verhandlung von im weitesten Sinn sozio-kulturellen Aktivitäten. Das Soziale ist wesentlich. Das ist ganz oft gesagt worden. Hier muss bezüglich der Finanzquellen einiges getan werden. Punkt 2: Nicht auf Abruf eingerichtete Stellen für Quartiermanagement in den Stadtteilen, sondern dauerhafte Einrichtung, weil die Bedürfnisse nach oben hin offen sind und wir nicht sagen wollen und können, wann Bedürfnisse in der Bevölkerung abgedeckt sind und wann nicht! |
|
Punkt 3: Wir haben Schwierigkeiten mit dem Managementbegriff. Das ist schon des Öfteren formuliert worden. Menschen lassen sich bisweilen managen, so sieht unsere Gesellschaft tatsächlich aus. Wir haben den Anspruch, sie nicht zu managen, sondern sie zu unterstützen und zu begleiten. Das heißt, es geht eigentlich um die Aufgabe der Bündelung und Vernetzung von Aktivitäten im Hinblick auf die Stärkung von Gestaltungsmöglichkeiten. Punkt 4: Wir halten es für bedenklich, die Bewohnerinnen und Bewohner zu aktivieren, pädagogisch umzuformen und zurechtzustutzen, damit sie in unserem Sinne aktiv das Programm begleiten. Wir halten es für besser und langfristig tragfähiger, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Bedürfnisse formulieren, entwickeln und auch umsetzen können. Punkt 5: Die derzeitige Verwaltung sieht so aus, dass es bestimmte Verwaltungsstrukturen gibt, Eingangsöffnungen, Türen und Fenster. Was von den Bedürfnissen der Bevölkerung passt, kommt herein, und was nicht passt, bleibt außen vor. Wir wünschen uns das genau andersherum. Wir möchten von den Bedürfnissen ausgehen und die entsprechenden Verwaltungsstrukturen als Dienstleistungen entsprechend den Bedürfnissen strukturieren. Das heißt schlicht und ergreifend, das Programm Soziale Stadt müsste dazu beitragen, die Verwaltungsstrukturen als Dienstleistung nachhaltig zu verändern. |
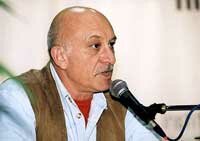 |
|
Punkt 6: Es geht nicht nur darum, den Stadtteil im Auge zu behalten, sondern darauf zu achten, inwieweit das Programm in bestimmten Stadtteilen Katalysatorenfunktion für die Gesamtstadt haben kann – mit dem visionenhaften Ziel, dass das Programm einen Beitrag leistet, um die Gesamtsituation in den Städten nachhaltig im Interesse der Bevölkerung zu verändern, sprich: mehr Mitgestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten zu schaffen. Punkt 7: Arbeit oder im weitesten Sinne Tätigkeit muss einen zentralen Stellenwert in dem Programm haben. Ein Beispiel: Es gibt Möglichkeiten, Beschäftigungen oder Arbeitsplätze im Rahmen von Beteiligungsprozessen zu schaffen, sodass engagierte Bürgerinnen und Bürger für die aktive Gestaltung von Beteiligungsprozessen entlohnt werden. Punkt 8: Wir müssen die Leute dazu bringen, ihre Aufregungen lauthals zu formulieren, also das zu sagen, was sie richtig aufregt, z.B. keinen Arbeitsplatz zu haben, bestimmten Mietinteressen untergeordnet zu sein. Wir finden, das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Aspekt, der uns bei der Ernsthaftigkeit der Diskussion etwas abhanden gekommen ist, ist der Spaß. Lachen und Spaß machen den Kopf auf. Wir wollen uns aufregen und auch viel Spaß im Stadtteil haben. Und wenn wir das z.B. auch in Form von Gremienarbeit erreichen können, haben wir einen wichtigen Schritt nach vorne getan. |
Heidede Becker
|
Der Spaß an der Arbeit, das Unangestrengte, das ist etwas, was alle hier unterstützen wollen und sollen. Einer Ihrer Punkte scheint mir auf eine Gratwanderung hinzuweisen. Sie sagten: dauerhafte Einrichtung von Quartiermanagement. Das wurde auch auf der Starterkonferenz im März dieses Jahres als Forderung aufgeworfen, nämlich eine dauerhafte personelle Infrastruktur zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Herr Jasper davon gesprochen hat, das Quartiermanagement auf fünf Jahre zu installieren, allerdings mit der Möglichkeit zu verlängern, um dann aber – und das ist ein wesentlicher Punkt in diesem Programm – zu den erwünschten und von uns allen immer wieder zitierten langfristig tragfähigen Strukturen zu kommen und sich "überflüssig" zu machen. Diese Gratwanderung finde ich spannend. Der Rollenwandel der Akteure, unter anderem jener in der Verwaltung, betrifft aber nicht nur die Verwaltung. Die Bereitschaft zur Veränderung ist bei allen Akteursgruppen gefragt. Indirekt war mit diesem Beitrag auch der Bereich Kooperation, Bündelung von Personen und Ressourcen angesprochen. Das betrifft die Arbeitsgruppe 5 "Bündelungserfolge und Bündelungsschwierigkeiten"; dazu Frau Scheffler vom Quartiermanagement in Hof. |
Cäcilia Scheffler, Stadterneuerung Hof GmbH
|
Es geht bei der Mittelbündelung um Geld. Das ist die wichtigste Rahmenbedingung für die Arbeit im Quartiermanagement – und deshalb auch: Chancen und Restriktionen. Chance: Über Mittelbündelung schafft man die Einbindung unterschiedlicher Sichtweisen und Fachkompetenzen und erweitert somit auch die räumlich begrenzten Finanzmittel für das Quartier. Restriktionen bedeuten in diesem Zusammenhang, dem politischen Verteilungskampf Tür und Tor zu öffnen. Die Vorbereitung dauert länger und ist weniger spontan. Ein Ausgleich wäre allenfalls über einen Verfügungsrahmen möglich, der aber meistens für die kleineren und unstrittigen Maßnahmen verwendet wird. Wir haben in der Arbeitsgruppe festgestellt, dass gerade am Anfang die Bündelungsschwierigkeiten gegenüber den Bündelungserfolgen logischerweise überwiegen. Bündelungserfolge hängen in besonders starkem Maße von der finanziellen Situation der Kommune und den anderen Ebenen ab. Gerade in jenen Städten und Ländern, wo a) eine Co-Finanzierung durch die EU oder andere erfolgt und b) ein geringerer kommunaler Anteil zugrunde gelegt wird, ist ein wesentlich besseres Arbeiten möglich. In Bayern geht es um 60 Prozent, in anderen Bundesländern vielleicht um 80 Prozent, die die Landesebene dazu beitragen muss. |
|
Hinter jedem Förderprogramm stehen Menschen und politische Entscheidungen. Wenn es um die Fachbereiche geht und darum, wer was dazu beiträgt, dann klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. In den meisten Städten ist eine Steuerungsgruppe installiert, in die sich die einzelnen Verwaltungsebenen einbringen. Da passiert verbal viel, aber wenn es darum geht, wirklich Geld zu verteilen, dann ist es mit der Zusammenarbeit vorbei. Gerade beim Verteilungskampf im sozialen Bereich und auch im Jugendbereich bestehen erhebliche Probleme bei der Bündelung für nicht-investive Maßnahmen, wenn dafür in anderen Stadtteilen gespart werden muss. Im Grunde genommen steht die Einführung von Budgetierung für die Fachbereiche in den Kommunen und vielleicht auch auf den anderen Ebenen der Mittelbündelung zum Teil entgegen. Das ist eine Aufgabe, die man nicht dem Quartiermanagement überlassen kann. Grundsätzlich sollte die Erarbeitung von Bündelungskonzepten dem jeweiligen Fachressort oder auch dem Träger überlassen werden. Nicht alles kann vom Quartiermanagement erledigt werden. |
 |
|
Wir haben aber auch festgestellt, dass es sehr gute Förderdatenbanken und Broschüren gibt, die Möglichkeiten der Mittelbündelung aufzeigen und auch für alle, z.B. im Internet, abrufbar sind, unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft. Es gibt also Bündelungserfolge, die aber hier nicht im Einzelnen aufgezählt werden können. |
Heidede Becker
|
Die bisher noch fehlende Transparenz und Überschaubarkeit der Programme kann sicher durch Informationen im Internet, auch im Internetforum des Difu, in Teilen behoben werden. Wir kommen jetzt zur Arbeitsgruppe 8: "Miteinander von Deutschen und Migranten", einerseits eine Chance für das vielfältige Leben im Quartier, andererseits aber auch Anlass für Schwierigkeiten – nicht nur für Sprachprobleme, sondern auch für kulturelle Differenzen. |
Veronika Gottmann, Sanierungsträger L.I.S.T., Berlin
|
Wir haben dieses Thema auch vor dem Hintergrund einer strukturellen und alltäglichen Diskriminierung von Migranten in allen Bereichen unserer Gesellschaft diskutiert. Damit hängt zusammen, dass es schwierig ist, mit Migranten zusammenarbeiten zu wollen; andererseits werden im beruflichen Leben – auch innerhalb der Verwaltung – kaum Beispiele für eine Vorbildfunktion von Migranten sichtbar: In der Verwaltung arbeiten eben zum Großteil Deutsche. Das fängt in den Schulen oder Kitas an. Migranten sind in diesen Bereichen noch nicht eingebunden. Das bildet natürlich eine Diskrepanz zu dem, was wir im Quartier eigentlich wollen. |
 |
Wir haben unsere Diskussion mit dem wichtigen Thema Spracherwerb, Überwindung von sprachlichen Barrieren angefangen. Spracherwerb sollte möglichst früh stattfinden, nämlich in den Schulen oder noch früher in den Kindertagesstätten. Bei uns in der Soldiner Straße, Berlin-Wedding, gibt es Grundschulen mit 70 bis 85 Prozent von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache. Wenn ich in der ersten Klasse anfange mit Kindern, die kein Wort deutsch sprechen, ist es fast schon zu spät. Es ist dann schwierig, noch einen vernünftigen Spracherwerb zu gewährleisten. Man muss bereits in den Kindertagesstätten anfangen. Dies berührt natürlich das Thema "zusätzliche Fördergelder" – die Qualifizierung von Kita-Erzieherinnen und -Erziehern für Sprachvermittlung, denn diese sind ja nicht unbedingt Didaktik-Fachleute für den Spracherwerb. |
|
Man muss aber auch den Migranten – bei uns im Kiez Türken und Araber – die Chancen aufzeigen, die es für den Spracherwerb gibt und wie wichtig dieses Thema ist. Es muss klar sein, dass es wichtig ist, die Kinder in die Kitas zu schicken, damit sie dort schon anfangen, deutsch zu lernen. Es gibt aber z.B. bei uns im Gebiet religiöse Hemmnisse, Kinder in die Kita zu schicken. Die Essensversorgung in Kitas entspricht nicht streng islamischen Essensregelungen. Spracherwerb geht natürlich über Schule hinaus. Wichtig ist, das Thema auch gegenüber den Erwachsenen zu vermitteln. Auch im Alter ist Spracherwerb gefragt, weil Sprache auch Voraussetzung für Integration ist. Ein zweiter Block betrifft die Frage, ob ein Quartiermanagement Veranstaltungen für die gesamte Quartiersbevölkerung durchführt und hofft, dass auch Migranten kommen, oder ob Veranstaltungen speziell für Migranten, z.B. zu bestimmten Projekten für Migranten, angeboten werden sollen. Je näher ich an den Leuten "dran" bin, je konkreter die Projekte sind, desto eher wird es gelingen, Migranten einzubinden. Wenn ich die Strukturen von Migranten in Quartieren nutze, beispielsweise Sport-, Kultur- oder Moscheevereine, ist eine bessere Zusammenarbeit zu erzielen. Es ist wichtig, auf den Strukturen von Migranten in Quartieren aufzubauen. Ziel ist meistens, eine Integration von Deutschen und Nicht-Deutschen zu organisieren. Dabei entsteht durchaus auch die Frage, wieweit diese Gemeinsamkeit getrieben werden soll. Es ist schon ein Erfolg, wenn zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen– Deutschen, Türken, Arabern, anderen Ausländergruppen – ein möglichst reibungsloses Miteinander möglich wird oder wenigstens eine Plattform organisiert werden kann, auf der interkulturelle Konflikte diskutiert und gelöst werden, damit die ethnischen Konflikte nicht mehr ihre derzeitige Sprengkraft besitzen. Im Zusammenhang mit ethnischen Konflikten taucht immer die Frage auf, was tatsächlich ethnische Konflikte sind und was solche Konflikte, die zwischen sozialen Gruppen und Schichten auftreten. In den Vierteln sind auch Migranten keine homogene Gruppe. Es gibt auch da unterschiedliche soziale Schichtungen. Wenn wir unterschiedliche soziale Gruppen ansprechen, sprechen wir auch entsprechende soziale Gruppen von Migranten an. Die Frage ist, ob die Schwierigkeiten, Migranten anzusprechen, wirklich auf ein kulturelles Problem zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen zurückzuführen sind – oder haben wir es mit einem Problem zu tun zwischen Quartiermanagern mit Mittelschichtorientierung und Mittelschichtkommunikation einerseits und andererseits Gruppen, die eher der Unterschicht zuzuordnen sind und andere Kommunikationsformen haben. Diese Probleme gibt es natürlich auch mit deutschen Gruppen. Manche kulturellen Probleme sind im Grunde soziale Probleme in der Ansprache oder Einbindung. |
Heidede Becker
Es ist ungeheuer wichtig, darauf hinzuweisen, dass Migrantinnen und Migranten ebenso differenziert sind wie deutsche Bevölkerungsgruppierungen, und dass eine genauere und auch themenbezogene Ansprache möglicherweise mehr erreicht.
Die Arbeitsgruppe 10 hat sich mit Identitätsbildung und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, einem sehr wichtigen Bereich des Quartiermanagements und aller Umsetzungsprojekte im Rahmen der Sozialen Stadt. Dahinter stecken Stichworte wie beispielsweise Stärkung des Wir-Bewusstseins im Quartier sowie Differenzen zwischen Fremdimage und Selbstimage. Schon mit dem Bericht aus der Arbeitsgruppe "Kunst und Kultur" und den Beiträgen aus dem Plenum dazu haben wir wichtige Hinweise auf Hilfen für die Imagebildung, auf das Umkehren von einem Negativimage in ein Positivimage gehört.
Stefan Seifert, freie Planungsgruppe, Hamburg
|
Wir haben uns erst einmal gefragt, welchen Stellenwert Öffentlichkeitsarbeit hat. Immerhin ist Öffentlichkeitsarbeit das Mittel, das unsere Arbeit als Quartiermanager nach außen bringt. Themen waren Öffentlichkeitsarbeit und Integration sowie auch Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Was ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit? Öffentlichkeitsarbeit läuft für uns als Quartiermanager auf unterschiedlichen Ebenen: Wir haben die Stadtebene, dann die Stadtteilebene, auch ein größeres Gebiet, und kleinteilig die Quartiersebene. Dazu gibt es jeweils unterschiedliche Instrumente. Im Foyer war ein schönes Video zu sehen, das die große Ebene, die Stadt betrifft. So etwas brauchen wir nicht im Quartier oder in den Stadtteilen. |
 |
Als erstes wurde das Medium Zeitung thematisiert, Zeitung als etwas Konkretes, das man in der Hand halten und lesen kann – die erste Basis, um auch Leute anzusprechen, die man noch nicht kennt. In unserer Gruppe gab es einige Vertreterinnen und Vertreter von Quartiermanagement, die schon solche Zeitungen hergestellt haben. Es war Konsens, dass diese Zeitungen nach Möglichkeit ansprechend gestaltet und professionell hergestellt werden sollten – es sollte sich nicht um eine fotokopierte Beilage handeln. Nach Möglichkeit sollte die Zeitung im Quartier hergestellt werden. Vorhandene Kontakte sollte man nutzen, z.B. für das Layout oder die Herstellung, für Interviews mit oder Beiträge von einzelnen Anwohnern, Gruppen, Vereinen oder Institutionen im Quartier. Um einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen, ist ein einheitliches Layout erforderlich. Spätestens nach der dritten Ausgabe sollte dieser Effekt entstehen – und dies am besten ohne Werbung etwa eines großen Supermarkts, die man gleich in den Papiercontainer wirft. |
|
Angesprochen wurde auch die Frage der Verteilung: Wie erreicht man die Bewohner? Auch eine gut gemachte Zeitung landet schnell im Papiercontainer. Es gibt Projekte, bei denen die Zeitungsmacher die Zeitung auch selbst verteilen. Bei anderen wird mit Zeitungen von anderen Einrichtungen zusammengearbeitet, sei es mit der Mieterzeitung eines Wohnungsunternehmens oder mit einer Lokalzeitung, der die eigene Zeitung beigelegt wird. Es müssen aber weitere Kanäle im Quartier genutzt und Aktivitäten gestartet werden. Manche haben Schwierigkeiten zu lesen, etwa weil sie die Sprache nicht verstehen oder gar nicht lesen können. Als zu nutzende Medien wurden lokale Radiosendungen genannt, auch lokale Fernsehsendungen. Was das Internet angeht, scheint es im Bereich der Frühpensionäre hierfür ein großes Potenzial zu geben. Es stellt sich auch die Frage, wie man im Internet den Stadtteil für Jugendliche interessant darstellen kann. Öffentlichkeitsarbeit umfasst auf jeden Fall auch persönliche Kontakte. Diese sind das Aund O, denn nur so kann man direkt erfragen, was jemandem gerade unter den Nägeln brennt. Darüber hinaus sind aber auch projektbezogene Aktionen nötig, um Leute gezielt zu einzelnen Projekten einzuladen und dadurch zu aktivieren. Hierzu kann man Plakate benutzen, die man aber nicht erst zwei Stunden vor der Veranstaltung, sondern frühzeitig an markanten Stellen anbringt – am besten untermauert durch eine persönliche Einladung im Briefkasten oder direkt an die Haustür. Man muss aber darauf achten, dass man etwas bieten kann. Man sollte nicht nur zu einem Plenum, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner auch dadurch aktivieren, dass man beispielsweise Stadtteilrundgänge anbietet. Wir Planer als Quartiermanager entwickeln häufig Aktivitäten vom Plan her. Die Betroffenen können das oft nicht so erkennen. Meine Erfahrung zeigt, dass der einzelne Anwohner, auch in kleinen Quartieren, vielleicht doch die eine oder andere Ecke seines Quartiers, in dem er schon seit zehn Jahren lebt, noch gar nicht betreten hat. So kann jemand durch Stadtteilrundgänge dazu beitragen, Öffentlichkeitsarbeit für das Quartiermanagement zu machen. Einig waren wir uns auch darüber, dass es nichts bringt, wenn Öffentlichkeitsarbeit Strohfeuer bleibt. Sie muss langfristig und kontinuierlich angelegt sein. Man sollte auch auf Unterstützung von außen setzen. Es sind in unserer Gruppe Aktionen genannt worden, die von Sponsoren oder überörtlichen Medien, z.B. einem Radiosender, nach außen vermittelt wurden. Das hat den Effekt einer Außenwerbung für die Betroffenen im Quartier mit dem Effekt "man spricht von meinem Stadtteil – vielleicht sogar über die Grenzen unserer Stadt hinweg". Wir haben uns mit dem Begriff "Identifikation mit dem Stadtteil" auseinander gesetzt, – wenn auch ohne Konsens. Das Identitätsbild ist sehr zerrissen. Was macht die Identität eines Stadtteils aus? Sie macht sich z.B. an konkreten Orten fest, z.B. dem Wochenmarkt, den alle lieben, zu dem alle hingehen. Aber wenn der vorbei ist, dann fehlt die Identifikation mit dem Stadtteil vielleicht wieder. Zur Frage Identitätsbildung, Image und Marketing: Ein schlechtes Image kann sowohl von außen herangetragen als auch von innen entwickelt werden. Bei einem schlechten Image leidet in aller Regel auch das Selbstwertgefühl der Betroffenen. Was bedeutet dies für den Umgang mit dem Stadtteil oder für den Umgang der Menschen im Stadtteil untereinander? Als Manager muss man auch etwas vermarkten. Wir haben eigentlich ein schwieriges Produkt zu vermarkten, denn es handelt sich um Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf. Die Vorstellungen der Beteiligten sind sehr heterogen, und es geht darum, wie diese Vorstellungen Wirkungen nach innen erzeugen, die sich dann auch nach außen vermarkten lassen. Es geht also um messbare Erfolge, um die Bewertung von Zielen und den Rücklauf. Dazu können Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Publikationen, einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Öffentlichkeitsarbeit lässt sich nicht einfach nebenher machen. Pressearbeit reicht nicht. Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, die professionell ablaufen muss. Öffentlichkeitsarbeit für einzelne Projekte dient dem Ziel Stärkung im Quartier, damit man langfristig eine Imagewirkung – auch von innen nach außen – erreichen kann. |
Heidede Becker
|
Ich fand besonders wichtig, dass Sie zum Schluss auch noch auf das Marketing eingegangen sind, nämlich auf eine offensive Öffentlichkeitsarbeit, die sich nach außen richtet, die aber natürlich unterlegt sein muss mit ganz konkreten Verbesserungen im Gebiet– also keine Öffentlichkeitsarbeit, die ein "schwieriges" Produkt nur vermarktet, sondern die tatsächliche Verbesserungen auch imagefördernd nach außen bringt. Die Arbeitsgruppe 12 hat ein übergreifendes Thema behandelt, nämlich die "Probleme integrativer Stadtentwicklung". Mit der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ist auch festgelegt, dass maßnahmenbegleitend integrative Handlungskonzepte entwickelt und fortgeschrieben werden sollen. Herr Gerkens hat in seinem Statement zum Podium 1 den "Charme" des Programms darin gesehen, dass es fortschreibungsfähig ist. Das integrierte Handlungskonzept enthält aber sowohl das Planungs- als auch das Umsetzungskonzept, und es enthält die Kosten- wie auch die Finanzierungsübersicht. Die Frage ist, wie sich die bisher verbal formulierten integrativen Handlungskonzepte, so sie denn ausgearbeitet sind, gewissermaßen vom Kopf auf die Füße stellen lassen und damit wirklich umgesetzt werden. Welche Rolle spielt dabei das Quartiermanagement, inwieweit ist es eingebunden, inwieweit kann es die Entwicklung dieses Handlungskonzepts sowohl steuern als auch beeinflussen oder auch initiieren? |
Helene Luig-Arlt, Quartiersmanagement Flensburg
|
Unsere Arbeitsgruppe hat sich zuerst die Frage gestellt, was man unter einem integrativen Ansatz, unter integrativer Stadtteilentwicklung versteht. Wir haben zwischen zwei Ansätzen unterschieden, und zwar erstens dem integrativen Handlungsansatz und zweitens dem integrierenden Entwicklungsansatz: Der integrative Handlungsansatz ist ein übergeordneter, übergreifender Handlungsansatz, die Verknüpfung verschiedener, das heißt öffentlicher, privater und gemeinwesenorientierter Handlungsfelder; der integrierende Entwicklungsansatz enthält die Partizipation der Akteure im Stadtteil im weitesten Sinne. Als Forderungen an den integrativen Ansatz im Bund-Länder-Programm haben wir erarbeitet: erstens die Abklärung der Kompatibilität der Förderrichtlinien, zweitens die Bekanntmachung der Förderprogramme und der Richtlinien. |
 |
|
Welche Aufgaben kann das Quartiermanagement für diesen integrativen und auch den integrierenden Handlungsansatz übernehmen? Vorweg haben wir versucht, Quartier- oder Stadtteilmanagement zu definieren. Quartiermanagement scheint unter anderem auch größenabhängig zu sein; Stadtteilmanagement geht eher in die Richtung eines übergreifenden Ansatzes, der auch die Gesamtstadt in ihrer Entwicklung beinhaltet. Wir haben die Aufgaben des Quartiermanagements einzugrenzen versucht; es sollte zum einen keine Gemeinwesenarbeit, keine Sozialarbeit vor Ort machen, es hat auch keine Ressourcen zu verwalten und verkörpert keinerlei Machtstruktur. Es hat also offensichtlich nicht die Möglichkeit, sich mit entsprechenden Kompetenzen durchzusetzen. Seine Aufgaben wären, die Probleme aufzunehmen, sie zusammenzutragen und die Prozessorganisation zu übernehmen, unterschiedliche Interessen gegenüber anderen zu vertreten, eine aktive Vermittlerrolle zu übernehmen sowie alle gesellschaftlich relevanten Bereiche wie Wirtschaft, Soziales, Stadtplanung, Akteure, Öffentlichkeitsarbeit usw. stadtteilbezogen zu sensibilisieren und zu aktivieren. Zusammenfassend betreffen die Aufgaben des Quartiermanagements im Zusammenhang mit integrativer Stadtteilentwicklung zwei Bereiche: erstens die Initiierung und Koordinierung dialektischer Prozesse beteiligter Institutionen und Akteure oder anders formuliert: Ideen zu finden und Wege aufzuzeigen, wie man gemeinsam – ich unterstreiche gemeinsam – in Bewegung kommt. |
Heidede Becker
Quartiermanagement soll also die Funktionen des Motors und Moderators übernehmen. Da sind wir wieder bei der Bündelung, beim Integrieren, Aktivieren.
Der letzte Arbeitsgruppenbericht bezieht sich auf die "Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen". Wenn wir uns vor Augen führen, dass die Hälfte aller Programmgebiete Großsiedlungen aus den 60er- bis 80er-Jahren sind und dieser Anteil in den neuen Bundesländern noch höher liegt, nämlich bei fast 70Prozent, dann wird deutlich, welche zentrale Rolle die Wohnungsunternehmen in diesen Gebieten als Akteur und Ansprechpartner spielen. Dies betrifft natürlich auch die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Quartiermanagement und den Wohnungsunternehmen. Herr Holland ist beim Podium 1 so weit gegangen, von "Integration der Wohnungsunternehmen in das Quartiermanagement" zu sprechen und dies als Basis für die Realisierung weiterführender Beteiligungsfonds anzusehen.
Martin Höckmann, Arbeiterwohlfahrt Sachsen-Anhalt
|
Ich möchte zwei Eindrücke aus der Arbeitsgruppe voranschicken, erstens: Wenn wir von Wohnungsbauunternehmen sprechen, ist das eine sehr heterogene Gruppe. Man muss sich vorstellen, dass sich die Ausgangslagen von Stadtquartier zu Stadtquartier unterscheiden. Zweitens: Dieser Kongress soll ein Impulskongress sein. Ich habe deshalb die Aussagen unserer Gruppe ein bisschen provokant formuliert, damit sie hier auch noch im Plenum Diskussionen anstoßen. Eine erste These ist, dass es eine traditionelle Gegnerschaft zwischen Wohnungsbauunternehmen auf der einen Seite und sozialer Arbeit auf der anderen Seite gibt. Das liegt an den unterschiedlichen Ebenen, auf denen man miteinander kommuniziert. Der Dialog muss gefördert werden. Dabei ist eine wesentliche Frage, wie wir die unterschiedlichen Fachtermini aufeinander abstimmen können – das ist in anderen Gruppen zum Teil auch diskutiert worden–, um eine gemeinsame Handlungsebene zu finden. |
 |
|
Die zweite These enthält die Frage: Wie sieht die Wohnungswirtschaft, die soziale Arbeit oder das Stadtteilmanagement aus? Nach alter Tradition hat man in der Wohnungswirtschaft ein Bild von sozialer Arbeit oder Stadtteilmanagement, das sich an den Gemeinwesenarbeits-Strukturen der 60er-Jahre orientiert. Dieses Bild muss revidiert werden. Die sozialen Fragestellungen, die sich aus dem Stadtteilmanagement ergeben, sind nur noch ein Teil dessen, was das Stadtteilmanagement zu regeln hat. Wir haben in den Landesförderrichtlinien die drei Hauptbereiche soziale Kompetenzen, betriebswirtschaftliche Kompetenzen und stadtplanerische Kompetenzen. Hier sind also Personen gefragt, die nicht mehr nur die Integration von benachteiligten Gruppen im Auge haben, sondern die die Gesamtintegration eines Stadtteils als lebensfähiges Ganzes bedenken und damit eher vermittelnde als sich gegeneinander abgrenzende Tendenzen aufzeigen müssen. Wie qualifiziert müsste der Mitarbeiter sein, dass er von der Wohnungswirtschaft akzeptiert wird? Es müssten intermediäre Kompetenzen vorhanden sein, die diesen Prozess begleiten. Weiter haben wir festgestellt, dass gerade in den neuen Bundesländern die Tendenz herrscht, die soziale Komponente bei Fragen der Qualifikation nicht so hoch zu hängen. Ich kenne Beispiele aus Sachsen-Anhalt, wo z.B. soziales Stadtteilmanagement mit BAT Vb-Stellen im Rahmen von ABM geleistet werden soll. Das kann einfach nicht sein. Hier müssen wir die Frage stellen, wie die Kommunen sich in Zukunft vorstellen, zu einer qualifizierten Besetzung dieser Stellen zu kommen. Es müssen Ressourcen zur Verfügung stehen, um entsprechend qualifizierte Mitarbeiter "einkaufen" zu können. In einer ganzen Reihe von Stadtgebieten haben wir, was die Träger angeht, ausgeprägte Monostrukturen, das heißt, dass eine Wohnungsbaugesellschaft über 80 oder 90Prozent des gesamten Wohnungsbestands verfügt. Kollegen mit Erfahrung in diesen Bereichen haben die Forderung aufgestellt, im Rahmen der Trägerstrukturen auch eine Durchmischung herzustellen, damit ein einzelner Träger nicht eine derart starke Position im Stadtteil hat. Es hat sich gezeigt – so einige der Kollegen – dass es schwieriger ist, die Wohnungswirtschaft zu aktivieren als die Bürger. Wenn sich nämlich ein Einzelwohnungsunternehmen – vor allem, wenn das Stadtteilmanagement aus sozialen Belangen heraus durch die Stadtverwaltung initiiert wurde – aus diesem Prozess herauszieht, sich im Grunde verweigert, dann ist Stadtteilmanagement nicht umsetzbar. Wie kommt man von den investiven Forderungen zu den nicht-investiven Maßnahmen? Wohnungswirtschaft hat als vorrangiges Ziel die Vermarktung des Wohnungsbestands. Sie investiert in den Wohnungsbestand, das ist ein Teil des Interesses der Wohnungswirtschaft. Über diese Fragestellung der Investition innerhalb des Bausegments sollte man dazu kommen, die nicht-investiven Bereiche mit den Wohnungsbaugesellschaften zu diskutieren, weil über diese nicht-investiven Bereiche die Gesamtstadt als Bild umsetzbar wird und damit eine Dynamik im Prozess erzeugt werden kann. Bewegung darf aber nicht nur von den Wohnungsverwaltungen gefordert werden. Eine Verweigerungshaltung innerhalb der Wohnungswirtschaft gibt es viel weniger bei den Vorständen als auf der mittleren Managementebene. Diese mittlere Managementebene, die in Entscheidungen um das Stadtteilmanagement oftmals nicht einbezogen ist, beharrt auf der Linie: Wir haben einen Wohnungsbestand, und die Bürger sollen froh sein, wenn sie bei uns wohnen dürfen. Diese Einschätzung ist natürlich auf Dauer nicht mit Stadtteilmanagement kompatibel. Wir müssen hier Bewegung schaffen, die dahin geht, dass sich auch innerhalb der Wohnungswirtschaft ein Verständnis für das Stadtteilmanagement entwickelt. Wie lassen sich bestimmte Schieflagen des Gesamtstadtteils auffangen? Eine wesentliche Möglichkeit sind Bewohnerbefragungen. Diese werden allgemein dort, wo sie umgesetzt wurden, als sehr positiv empfunden. Es wurde ein Beispiel genannt, bei dem aus einer Befragung tatsächlich wohnungssteuernde Hilfestellung entwickelt wurde. Dies sollte noch vertieft werden; wenn das Difu Good-practice-Beispiele ins Internet einstellt, sollte man dieses Thema noch verstärkt diskutieren. Die nächste These betrifft "Bau durch Bürger". Investive Maßnahmen innerhalb der Gebiete der Sozialen Stadt sollten verknüpft werden mit lokalen Beschäftigungsinitiativen, um die Handelnden in den Stadtteilen in die tatsächlichen Prozesse einzubeziehen und auch diejenigen zu erreichen, die die Verlierer im System sind, z.B. langzeitarbeitslose Mitbürger, Sozialhilfeempfänger usw. Soziales Stadtteilmanagement sollte sich auch im Bereich der Qualifizierung engagieren – sowohl Kollegen innerhalb der Stadtverwaltung als auch der Wohnungswirtschaft. Damit sind die beiden Gruppen genannt, die hier noch zu Blockaden führen. Das heißt natürlich nicht, dass alle Mitarbeiter des mittleren Managements aus der Wohnungswirtschaft diese Konsequenzen nicht sehen. Aber hier sollte zumindest vom sozialen Stadtteilmanagement Einfluss in qualifizierender Hinsicht genommen werden. Die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte der Bürger ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt. Beispielsweise wird die Einstellung eines Concierge in bestimmten Stadtteilen durch die Mieter selbst geregelt. Es ist wichtig, dass bei der Frage der Beschäftigung auch die Betroffenen aus dem Stadtteil beteiligt werden. Zur Frage des Öffentlichkeitsmarketings ist in der Vorgruppe bereits vieles gesagt worden. |
Heidede Becker
|
Sie haben auch auf die Chancen hingewiesen, die in der Zusammenarbeit mit den Wohnungsunternehmen bestehen, gerade auch dann, wenn sich der Wohnungsmarkt als "Mietermarkt" darstellt. Auch bei den betriebswirtschaftlichen Kalkülen der Wohnungsbaugesellschaften liegen Chancen darin, dass sie ihre Mieter inzwischen als Kunden entdeckt haben und durchaus die Bereitschaft zeigen, da einzuschwenken. Auch Sie haben wieder Hinweise auf viele praktische Beispiele gegeben, über die wir uns – und da wird auch das Difu etwas beitragen – einen besseren Überblick verschaffen wollen. Bevor wir die Diskussion in das Plenum öffnen, möchte ich Herrn Rudolf Raabe bitten, aus Ländersicht die Beiträge und die Veranstaltung zu kommentieren. Als Vorsitzender der Fachkommission Städtebau der ARGEBAU gehört er zu dem Kreis, der mit dem "Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt" einen sehr wichtigen und hilfreichen Orientierungsrahmen, eine Arbeitshilfe für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt gegeben hat. Es ist im Verlauf dieses Impulskongresses immer wieder auf die besondere Rolle mancher Länder hingewiesen worden, die sich zum Träger und zum Initiator des Erfahrungsaustauschs zur Sozialen Stadt auf Landesebene machen. |
Rudolf Raabe, Vorsitzender der Fachkommission Städtebau der ARGEBAU, Wiesbaden
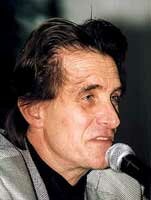 |
Als wir nach entsprechenden Vorarbeiten 1996 unseren Bauministern einen Beschlussvorschlag zu einer "Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt" vorlegten, war nicht absehbar, dass wir damit eine so gewichtige Initiative starten würden, wie sie – vier Jahre später – hier so prägnant zum Ausdruck kommt. Vielen Dank für Ihr engagiertes Eintreten für diese Aufgabe! Als Länder bieten wir weiterhin unsere Partnerschaft zu dieser großen Gemeinschaftsinitiative an. Als Ländervertreter lege ich Wert darauf, dass wir nicht nur etwas "angeschoben" haben und Ihnen Fördermittel zukommen lassen, damit Sie weiterarbeiten können, sondern dass wir auch an der weiteren Entwicklung dieses Programms wesentlich beteiligt sind. Eigentlich hatte ich befürchtet, dass hier – wo überwiegend die Kommunen vertreten sind – das Förderverfahren der Länder Gegenstand der Kritik wäre. Ich habe aber von Ihnen kaum derartige Bemerkungen gehört. Und das freut mich besonders, weil ich den Eindruck habe, dass diese Partnerschaften zwischen Ländern und Gemeinden tatsächlich funktionieren. |
|
Nun handelt es sich bei dieser Partnerschaft um eine relativ einfache und bewährte. Wir haben sie im Bereich der Stadterneuerung über 30 Jahre lang geübt. Was wir aber als die eigentliche Neuerung dieses Programms ansehen ist – und wir nehmen das sehr ernst –, dass es stärker als bisher nicht nur um ein Top-down-Modell geht, bei dem Bund und Länder ein Programm formulieren und die kluge Gemeinde sich an diesem Programm beteiligt, weil sie dafür Geld bekommt und die Pflicht zur Umsetzung hat. Dieses Top-down-Modell – und dies ist die neue Position – braucht ein starkes Bottom-up-Gegengewicht. Deswegen nehmen wir uns auch als öffentlicher Sektor stark zurück. Wir brauchen neben dem öffentlichen natürlich entscheidend den privaten Sektor; den müssen wir gewinnen – Public-Private-Partnership spielt seit einigen Jahren in der Stadtentwicklung eine bedeutende Rolle. Natürlich wenden wir uns auch ganz entscheidend an den dritten, den gemeinnützigen Sektor, die NGOs (Non-Governmental Organisations). Der anspruchsvolle Ansatz einer Gemeinschaftsinitiative ist natürlich anfällig für Kritik, weil er hohe Anforderungen an viele stellt. Es gibt eigentlich keine Stadtentwicklung und keine Entwicklung benachteiligter Stadtteile ohne Public-Private- und gemeinnützige Partnerschaften. Und es darf eigentlich auch keine Entwicklung dieser Stadtteile ohne integrierten Ansatz geben, ohne dass die verschiedensten öffentlichen und privaten Töpfe gebündelt werden. Dabei reicht es nicht aus, wenn die Fördermittel nur zusammengefasst werden und damit ein Wohlfahrtseffekt hervorgerufen wird, sondern es geht auch darum, dafür neues Geld einzuwerben. Wir müssen auch als Lobby auftreten und betonen, dass wir für diese anspruchsvoll formulierten Aufgaben auch mehr Geld brauchen. Ich erinnere mich daran, dass mich ein Staatssekretär mit den Worten vorgestellt hat: "Das ist Herr Raabe, der macht Stadterneuerung ohne Geld". Doch da bin ich deutlich missverstanden worden, denn wenn es auch nicht um die großen Investitionsprojekte geht – in den siebziger Jahren haben wir in der Stadtsanierung Tiefgaragen und große Infrastruktureinrichtungen gebaut –, brauchen wir dennoch entsprechend dem Anspruch auch hier Mittel für Investitionen. Darüber hinaus – und das ist ein noch schwierigeres Kapitel – müssen auch in den anderen Politikfeldern Mittel bereitgestellt werden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass selbst in kundigen Runden zwei Begriffe nicht deutlich auseinandergehalten werden: Das eine betrifft die "Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt". Ich habe dies einmal als Tortengrafik dargestellt. Die verschiedenen Politikfelder, die wir verklammern wollen, sind die Tortenstücke. Und auf dieser Torte sitzt in der Mitte eine dicke Kerze, die nicht nur Mut macht und Licht bringt, sondern auch eine spezielle Funktion hat. Wenn wir hier über das Programm Soziale Stadt sprechen, dann bemerken wir, dass der anspruchsvolle Ansatz der Gemeinschaftsinitiative durch das Programm nicht abgedeckt wird, dass wir durch unser Programm im Grunde "nur" – nur in Anführungszeichen, denn ich halte das Programm für sehr wichtig – ein Städtebauförderungsprogramm, ein Ressortprogramm des Bauministeriums, der Bauministerien der Länder und der Kommunen haben. Aber wir haben damit neben dem Investitionsprogramm Stadterneuerung auch ein Leitprogramm, und dieses Leitprogramm wird durch die Kerze verkörpert. Mit dem Leitprogramm wollen wir den Mehrwert erreichen, indem wir die anderen Politikbereiche koordinieren, Quartiermanagement einrichten, integrierte Handlungsprogramme ausarbeiten und Projekte entwickeln. Klar muss sein, dass wir die Durchführung der anderen Politikfelder aus unseren schmalen Städtebauförderungsmitteln nicht finanzieren können. Wir schieben die Programme und die Projekte an, und dies unter Einsatz des Quartiermanagements. Die Mittel für die anderen Politikfelder müssen eingeworben werden. Ich bin begeistert von diesem Ansatz. Aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es eine Fülle von Problempunkten gibt. Von wissenschaftlicher Seite wird beispielsweise gesagt: Ihr leistet doch gar nicht so viel, wie ihr vorgebt. Es ist klar, dass mit Stadtteilpolitik nicht die ganze gesellschaftliche Entwicklung gewendet werden kann. Große gesellschaftliche Strukturprobleme und negative Trends lassen sich allein mit dem Programm Soziale Stadt im Stadtteil nicht ändern. Doch es gibt ganz zentrale Aufgaben, die ganz auf den Stadtteil zugeschnitten sind. Das sind die Themen, die vorher diskutiert wurden: Identität, Stärkung der Kompetenz der Gebietsbewohner, das ganze Spektrum sozialer und kultureller Aufgaben im Stadtteil. Wir dürfen uns keinen zu großen Schuh anziehen, den wir nicht ausfüllen, aber an dem wir dann gemessen werden, z.B. im Rahmen einer Evaluation: Wie viele Arbeitsplätze wurden bezogen auf den gesamten Anteil der Arbeitslosen durch lokale Ökonomie geschaffen? Wie erfolgreich wurde die Armut im Stadtteil bekämpft usw.? Als Ländervertreter sage ich: Selbst wenn Bund und Land davon ausgehen, dass dieses Programm endlich ist und sich der Staat nach einiger Zeit wieder aus dieser Aufgabe zurückzieht, dann bleibt die Aufgabe als kommunale Aufgabe bestehen. Nachhaltige Stadtteilentwicklung heißt, dass wir in dieser Zeit, in der wir mit dem Programm Impulse geben, Strukturen in den Quartieren entwickeln, damit danach die zusätzlichen Maßnahmen überflüssig werden. Doch dazu müssen Strukturen im Gebiet aufgebaut sein, die es nachhaltig auf der Höhe seiner Entwicklung halten. Wenn wir uns danach vielleicht auch kein Quartiermanagement im Sinne von zwei zusätzlichen Kompetenzen leisten werden, brauchen wir aber eine Lenkungsgruppe in der Stadtverwaltung, die sich um den Stadtteil kümmert. Wir brauchen ein Stadtteilforum, in dem sich die Bürger der Stadt weiterhin – über die Laufzeit des Programms hinaus – Gehör verschaffen können, und wir brauchen Vereine und Initiativen der Bewohner. Wir brauchen Strukturen politischer Art, die den Stadtteil mit dem gesamten kommunalen Politiknetzwerk vernetzen. Diese so zu stabilisieren, dass nach einigen Jahren– dabei halte ich fünf Jahre für zu wenig, aber vielleicht nach zehn Jahren – sich das Förderprogramm "verabschieden" kann, das ist die eigentliche Aufgabe, die uns gestellt ist. |
Heidede Becker
|
Sie haben damit die Zugpferdfunktion der Städtebauförderung für das angesprochen, was mit dem Programm Soziale Stadt geleistet werden soll. Habe ich das richtig verstanden, dass im Grunde das Quartiermanagement, damit diese Kerze in der Tortenmitte nicht umfällt, der Kerzenhalter ist, der gerade über die Programmmittel der Sozialen Stadt finanzierbar ist? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass dies offenbar nicht überall in den Ländern so gesehen wird und damit nicht überall in den Kommunen angekommen ist, denn es gibt Programmgebiete, für die gesagt wird: Wir wollen oder wir können kein Quartiermanagement einrichten. |
Rudolf Raabe
|
In dem von Ihnen vorhin angesprochenen Leitfaden zur Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt der ARGEBAU sind genau diese Aufgaben der Städtebauförderung definiert: dass sie zwar nicht das gesamte Feld der Gemeinschaftsinitiative abdecken kann, dass sie aber klassisch als Investitionsprogramm Städtebauförderung und zusätzlich als Leitprogramm einzusetzen ist. Gerade diese beiden Begriffe haben wir in dem Leitfaden herausgearbeitet. Mit dem Leitprogramm ist gemeint, dass ein integriertes Handlungskonzept erarbeitet wird und auch umgesetzt werden soll, und dass das Quartiermanagement ganz zentraler Bestandteil dieses Leitprogramms ist. Deshalb würde es mich sehr wundern, wenn Länder Bedenken hätten, das Quartiermanagement aus Städtebauförderungsmitteln zu bezahlen. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. |
Heidede Becker
|
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt die Gelegenheit zu Kommentierungen, Ergänzungen und Nachfragen. |
Ingeborg Beer, Berlin
 |
Es wurde gesagt, dass das Programm dazu führen soll, Strukturen zu schaffen, und das Quartiermanagement sich eigentlich überflüssig machen soll. Der erste Redner hat gefragt, inwieweit im Rahmen des Quartiermanagements auch Strukturen geschaffen werden können, mit denen Bewohner in Beschäftigung kommen. Ich verweise auf eine |
Malte C. Krugmann, Senatskanzlei Hamburg
 |
Herr Raabe, ich fand ihren Hinweis sehr sympathisch, dass die Erfolgskriterien für das Quartiermanagement und die Quartierentwicklung nicht quantitativer Art sein dürfen. Ich glaube aber, dass die quantitativen Erfolgskriterien von der Politik dann doch eingeklagt werden. Wir haben in Hamburg seit 1994 Erfahrungen mit Quartiermanagement. Immer wieder ist die Frage gestellt worden: "Wieviel Arbeitsplätze habt Ihr denn eigentlich wirklich geschaffen?" Sie haben ganz locker von einer Laufzeit von zehn Jahren gesprochen. Es ist ein außerordentlich schwieriger Vermittlungsprozess, Verwaltung und Politik klar zu machen, dass Erfolge bei diesem Ansatz von Quartiermanagement und Quartierentwicklung nicht in einer Wahlperiode zu haben sind, sondern dass sie mindestens mit vier Jahren und noch länger rechnen müssen. Was Sie mit zehn Jahren veranschlagt haben, sind auch Erfahrungswerte aus Holland, Frankreich und Großbritannien: Quartiere, die über Jahrzehnte eine "Negativspirale" entwickelt haben, lassen sich nicht in vier Jahren wieder aufbauen. |
|
Nun zur Frage "Dauerhafte oder nicht dauerhafte Subventionierung des Quartiermanagements?" Es geht hier um eine grundsätzliche Frage des Ansatzes von Quartiermanagement. Wir sind in Hamburg der Auffassung, dass Quartiermanagement und vor allem die öffentliche Subvention hierfür befristet sein müssen, dass es keine öffentlichen Subventionen auf Dauer für diesen Ansatz geben darf. Dahinter stehen folgende Überlegungen: Wenn Sie sozial und wirtschaftlich nachhaltige Strukturen in einem Quartier schaffen oder wieder herstellen wollen, heißt das in der Konsequenz, dass Sie Verhältnisse in diesem Stadtteil schaffen wollen, die es dem Stadtteil ermöglichen, irgendwann aus eigener Kraft wieder seine Probleme zu bewältigen. Wenn Sie aber von vornherein sagen, wir subventionieren das auf Dauer, dann erzeugen Sie eine Mentalität, die diese Perspektive gar nicht richtig in den Blick bekommt. Beim Quartiermanagement geht es aus unserer Sicht um "Hilfe zur Selbsthilfe" und vor allem um die tatsächliche Lösung von Problemen und nicht um ihre Dauerstellung. Wenn Sie Förderung auf Dauer stellen, unterliegen Sie dem grundlegenden Denkfehler deutscher Sozialverwaltung und Fürsorge, die immer bei einem sozialen Problem sagt, wir brauchen mehr Geld und mehr Personal – und die Probleme bleiben; Sie bekommen die Probleme nicht aus der Welt. Von dieser etatistischen "Denke" müssen wir wegkommen, sonst helfen wir nicht der Bevölkerung, sondern produzieren die Kultur der Abhängigkeit in diesen Quartieren nur noch endlos weiter. Dass die Befristung und der Übergang, um aus der staatlichen Subventionierung Schritt für Schritt herauszukommen, auf die Quartiere abgestimmt sein müssen, damit es hier nicht zu unerträglichen Brüchen kommt, ist klar. Das muss von Quartier zu Quartier entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen entschieden werden. Das mit der Budgetierung, Frau Scheffler, habe ich nicht verstanden. Wir haben in Hamburg die Erfahrung gemacht, dass wir mit der Budgetierung erheblich mehr Transparenz in Bezug auf die unterschiedlichen Fördertöpfe in der Stadt bekommen haben und dass wir mit der Budgetierung zumindest Schritte in Richtung einer ergebnisorientierten Arbeitsweise der Verwaltung gemacht haben, weg vom Input, mehr hin zum Output. Das brauchen wir bei dem Ansatz Quartiermanagement ganz dringend, wir brauchen Ergebnisse. Die Verwaltung muss sich an diesen Ergebnissen messen lassen. Mit der Budgetierung sind wir da auf dem richtigen Wege; wir haben jedenfalls positive Erfahrungen gemacht. Herr Seifert hat die Öffentlichkeitsarbeit dargestellt. Wir haben in Hamburg damit hervorragende Erfolge bei problematischen Stadtteilen erzielt. Ich weise aber auf Probleme hin. Gute Öffentlichkeitsarbeit in den belasteten Quartieren führt zu wachsender Kritik im Quartier, weil häufig das Image außerhalb des Quartiers schneller besser wird als die tatsächlichen Verhältnisse im Quartier. Das entgeht der Bevölkerung natürlich nicht. Wenn dann wie bei dem Beispiel in Hamburg ein Kind von einem Kampfhund totgebissen wird, ist die ganze Imagekampagne, die über Monate oder über Jahre erfolgreich gewesen ist, von einem Tag auf den anderen kaputt. Dann kommen die alten Stigmatisierungen wieder hoch. |
Robert Sander, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
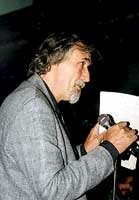 |
Zurück zum Stichwort Bündelung: Bei Bündelung – so wurde gesagt – geht es um Geld. Aber es geht nicht nur um Geld. Es geht um horizontale und vertikale Bündelung, nicht nur von Geld, sondern von Aktivitäten, von Akteuren, von Maßnahmen, z.B. auf Verwaltungsebene, und darum, dass die Betroffenen aktiviert werden und sich in ihren Aktivitäten bündeln. Ich meine, das sollte ergänzt werden. Herr Bader, Sie sprachen von Impulsen, die Sie entsprechend unserem Titel geben wollen. Die Bürger müssen sich melden, ihre Forderungen äußern und damit "nach oben" geben. Im Sinne des Programms Soziale Stadt heißt Aktivierung auch, die Betroffenen sind gefordert, aktiv zu sein und ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Da schien mir nur diese eine Richtung deutlich zu werden, und die andere ist mindestens ebenso wichtig. |
|
Zu Herrn Raabe: So toll das ist, was Sie auf den Weg gebracht haben, nicht alle Länderkollegen verstehen das Quartiermanagement als finanzierbar aus dem Programm; ich kann Ihnen dazu Beispiele nennen. In vielen Ländern wird das Programm Soziale Stadt an die Ausweisung von Sanierungsgebieten gebunden. Das ist nicht immer förderlich, weil die Gebietszuschnitte häufig kleiner sind. Ist es möglich, über die Sanierungsgebietsabgrenzung hinaus eine Abgrenzung des Gebiets "Soziale Stadt" vorzunehmen? |
Heidede Becker
Wir sollten hier jetzt nicht noch das Thema "Gebietszuschnitte" aufgreifen. Die Zeit ist viel zu kurz, um es angemessen zu diskutieren. Ich möchte aber den Diskutanten des Podiums die Gelegenheit zur Antwort geben.
Kurt Bader
Wir könnten jetzt eigentlich die Diskussion beginnen. Ich gehe auf den letzten Punkt ein. Natürlich gibt es Interessen der Bevölkerung, aber es gibt auch Interessen der hier Sitzenden und Mitarbeitenden. Ich warne davor, Mängel in den eigenen Arbeitsbedingungen nach unten zu transferieren; vielmehr geht es darum, eigene Arbeitsbedingungen zu schaffen, mit denen man auch mit gutem Gewissen die Interessen der Bevölkerung vertreten kann.
Zum Punkt des Kollegen aus Hamburg: Ich habe Schwierigkeiten mit der Argumentation; erstens einmal bin ich Österreicher, also nicht so sehr der deutschen Denkform verpflichtet, die Sie mir nahegelegt haben. Wir sind vielleicht etwas weicher, wir haben weichere Taktstöcke. Ich finde es scharf, auch provokant formuliert, eine überhebliche und arrogante Position, in einer Situation, wo es ein Roll-back im Sozialbereich gibt, wo Gesundheitsreformen zu einer Verlagerung in den privaten Bereich führen, wo Kolleginnen und Kollegen Fallzahlen zu bearbeiten haben, dass sie völlig fertig nach Hause gehen, wo die Belastung so groß ist, dass den Interessen der Bevölkerung nicht mehr entsprochen werden kann, darüber zu reden, dass es mit weniger Geld und Personal gehen soll. Das geht in die Richtung Privatisierung der verschiedenen Risiken. Da müssen die Fachkräfte und letztlich die betroffene Bevölkerung das Lehrgeld zahlen. Es wird niemand daran denken, Ärzte in einem Bereich anzusiedeln, wo die Krankheitsquote groß ist, mit der Zielsetzung, nach fünf Jahren die Ärzte wieder abzuziehen, weil die durchschnittliche Krankheitsquote sich durch Selbstheilungskräfte der Bevölkerung wieder reduziert hat.
Wenn es um zu wenig Gelder geht, dann schaue ich auf die Schmiergelder und Kriegsinvestitionen; wenn wir einen Bruchteil dieser Gelder für die Interessen der Bevölkerung hätten, würde das Programm Soziale Stadt etwas besser aussehen. Ich plädiere eindeutig für eine Kultur der Abhängigkeit und nicht für eine Kultur der Unabhängigkeit, dafür, die Leute nicht allein zu lassen. Und da wage ich noch einmal, den alten Marx zu zitieren: "Der abhängige Mensch ist der reiche Mensch."
Cäcilia Scheffler
Zum Thema Bündelung nicht nur von finanziellen Mitteln, sondern auch Bündelung aller Kräfte: Eine besondere Chance besteht gerade darin, dass man die unterschiedlichen Sichtweisen und Fachkompetenzen über diese geforderte Bündelung sozusagen an einem großen Tisch zusammenbringt.
Zum zweiten Punkt: Budgetierung mag einerseits sehr positiv und modern auf der kommunalen Ebene sein. Ich als Quartiermanagerin habe da meine gewissen Erfahrungen. Andererseits haben wir einen Bündelungserfolg, dass wir bei einem kommunalen Kulturprojekt im Bahnhofsviertel zwei Wochen Kulturprogramm ganz wunderbar situieren konnten. Dazu hat auch das Kulturamt seinen Teil aus seinem Budget beigetragen. Dagegen hat z.B. das Jugendamt zu seinem Budget befunden: "Wir haben keine müde Mark und genug in allen Bereichen zu tun. Es ist schön, wenn wir aus dem Programm Soziale Stadt zusätzlich etwas bekommen, aber aus unseren eigenen Mitteln können wir nichts dazu tun." Außerdem rechnen einzelne Fachbereiche, die jeweils ihre Budgets zu verwalten haben, sich gegenseitig die Leistungen auf. In diese Aufrechnung muss entsprechend ein gesamtes Mittelbudget einfließen. Damit entstehen Nachteile in der Kleinarbeit des Quartiermanagements.
Rudolf Raabe
Ich komme aus dem Bereich der Stadtsanierung. Dabei ging es im Wesentlichen um die Verbesserung der Infrastruktur sowie um die Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden. Wir haben in Hessen die Sanierungsmaßnahmen zum Teil 25 Jahre lang gefördert und hatten nach Abschluss der Maßnahmen oft den Eindruck, dass es immer noch genug zu tun gab. Wie aber – so frage ich mich – will man in Stadtteilen, in denen bauliche, infrastrukturelle und soziale Probleme in unterschiedlich starker Ausprägung bestehen, diese Probleme in fünf Jahren lösen? Für die bauliche Sanierung haben wir 25 Jahre benötigt, und für diese Probleme sollen wir nur fünf Jahre brauchen?
Bevor wir mit der Arbeit in den Quartieren der Sozialen Stadt begonnen haben, waren schon viele vor uns da: z.B. die freien Träger der Wohlfahrtspflege, die Städte mit ihren Sozialdezernaten. Sehr häufig wussten sie wenig voneinander. Die Aufgaben des Programms Soziale Stadt sind zu einem erheblichen Teil kommunale Aufgaben. Wenn das Programm Soziale Stadt nicht aufgelegt worden wäre, hätte die Diskussion vielleicht nicht so schnell und so engagiert in die Kommunen Eingang gefunden. Das Fördergeld befördert sicher auch die Diskussionen; aber die Kommunen und auch die Wohnungswirtschaft kommen nicht daran vorbei – siehe "überforderte Nachbarschaften" –, sich diesen Problemen zu stellen.
Deshalb wird das Thema Soziale Stadt – mit oder ohne Bund-Länder-Programm – weiterhin in den Kommunen virulent sein. Daher ist die Frage, ob man das Quartiermanagement aus einem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt fördert, fast nebensächlich. Die Kommune muss, wenn sie nicht im Programm ist, prüfen, wie sie ein Stadtteilmanagement eventuell mit privaten Partnern finanzieren kann. Dazu bietet sich z.B. die Wohnungswirtschaft an.
Unabhängig von der Laufzeit des Programms wird man Strukturen aufbauen müssen, um den Menschen in den Stadtteilen weiterhin Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ich glaube nicht, dass man die Hilfe fünf Jahre gibt, und dann helfen die sich die nächsten 50 Jahre selbst. Deshalb bin ich sicher, dass wir Strukturen zur längerfristigen Unterstützung in diesen Stadtteilen aufbauen müssen. Ob es sich dabei um das hier diskutierte Quartiermanagement handeln muss, das lassen wir vorerst einmal offen. Aber eine Politikstruktur in der Kommune, die den Stadtteil ernst nimmt, eine Verwaltung, die sich auf den Stadtteil hin orientiert, Stadtteilbeiräte oder andere Organisationen, die sich um den Stadtteil kümmern, die werden wir bestimmt weiterhin brauchen.
Heidede Becker
Mir scheint, dass in den Kommunen angesichts der direkten Konfrontation mit den Problemen in vielen Stadtteilen schon ein starkes Engagement vorhanden ist. Nicht bei allen, aber ich denke, mit Ihrem Plädoyer rennen Sie bei vielen kommunalen Vertretern offene Türen ein. "Rennen" ist jetzt etwas übertrieben.
Meine Damen und Herren, ich möchte gern zum Abschluss auf die zentrale Rolle des Erfahrungsaustauschs zu sprechen kommen, eine Aufgabe, der wir uns bei der bundesweiten Programmbegleitung durch das Difu auch verpflichtet fühlen und in der wir engagiert sind, in der sich auch die Länder verpflichtet fühlen. Es ist nötig, einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen zu organisieren. Wir können aus der Veranstaltung auch lernen, dass dabei neue Methoden wichtig sind, z.B. Info-Märkte und die offensive Nutzung von Netzwerken. Wir haben hier mit noch schüchternen Elementen, mit der Vielfalt der Arbeitsgruppen versucht, mehr Akteure in den direkten Erfahrungsaustausch einzubinden. Mir scheint auch wichtig zu sein, dass der Erfahrungsaustausch zu den handlungspraktischen Themen vertieft werden muss, nämlich durch das Kleinarbeiten der großen Ebene auf die wirklichen Probleme vor Ort, Ihr Erfahrungswissen nutzend und – das haben viele Diskussionen in den Arbeitsgruppen gezeigt – durch den Austausch über bereits laufende gute Beispiele. Bundesweit bemühen wir uns um den Aufbau einer Projektdatenbank, wenden uns diesbezüglich auch an Sie, an Netzwerke und die vielen Engagierten mit der Bitte um Informationen und die Weiterleitung von Erkenntnissen. Mit der Projektdatenbank möchten wir die Möglichkeit schaffen, themen- und projektbezogen Informationen abrufbar zu machen: Wo läuft was, wie läuft das, und wer ist dort Ansprechpartner? Wie ein roter Faden zieht sich der Bereich "Verständigung" durch unsere Debatte: Klärung von Missverständnissen, Überzeugungsarbeit, Überwindung von Sprachbarrieren, Verständigung ist eine zentrale Aufgabe, die im Zuge von Erfahrungsaustausch intensiviert, präzisiert und besser angegangen werden kann.
Zum Abschluss möchte ich ganz vielen danken: den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier auf dem Podium für ihre Beiträge, auch den vielen hilfreichen Geistern hier in Werk II sowie den hilfreichen Geistern im Hintergrund: vom BMVBW und vom Difu. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine gute Heimfahrt und danke Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Engagement und Ihr Durchhaltevermögen.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004