soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Erfahrungen mit Organisation und Verfahren des Quartiermanagements
Podiums- und Plenumsdiskussion
Moderation:Thomas Franke |
||
Auf dem Podium:Kerstin Jahnke |
 |
|
|
Klaus Lindemann |
||
|
Ludger Schmitz |
||
|
Andreas Fritsch |
||
|
Diana Stuhr |
||
|
Cornelia Cremer |
||
|
Jens Tappe |
Thomas Franke, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
 |
Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen waren offenbar sehr lebhaft. Zum Teil ging es um einen intensiven Erfahrungsaustausch, zum Teil um das Aufwerfen oder Wiederaufgreifen von praxisrelevanten Fragen. Wir wollen auf den beiden heutigen Podien nicht aus den einzelnen Arbeitsgruppen Bericht erstatten, sondern stattdessen versuchen, unter der Hauptfragestellung "Erfahrungen mit Organisation und Verfahren des Quartiermanagements" in kurzen Statements darzustellen, was in den Arbeitsgruppen zu diesen Themen diskutiert worden ist. Auf dem Podium vertreten sind die Arbeitsgruppen "Zusammenarbeit mit den Akteuren im Quartier", "Verhältnis zu Stadtverwaltung und Rat", "Aktivierung der Bevölkerung", "Aufgaben, Struktur und Qualifikation", "Beschäftigung und Qualifizierung", "Bildung und Kultur" sowie "Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen". Frau Jahnke von der Arbeitsgruppe 1 "Zusammenarbeit mit den Akteuren im Quartier" macht "Programmbegleitung vor Ort" im Brandenburger Modellgebiet der Sozialen Stadt Cottbus, Sachsendorf-Madlow. Wer sind überhaupt die Akteure im Quartier? Wie kommunizieren sie miteinander – oder herrscht vielleicht eher Konkurrenz vor? Welche Motivation oder "Nichtmotivation" zur Zusammenarbeit besteht, und wie kann man die Kooperation strukturieren? Was bedeutet dies für das Verfahren von Quartiermanagement? |
Kerstin Jahnke, Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner
Wir haben in der Arbeitsgruppe intensiv darüber geredet, welche Verantwortungen vom Quartiermanagement übernommen werden können und haben daran im Prinzip auch aufgerollt, wer die Akteure sind. Zu diesen gehören die Stadtverwaltung, die verschiedenen Ämter, freien Träger, Gremien bürgerschaftlicher Verantwortung. Die Wohnungsunternehmen spielen ebenfalls eine Rolle. Insgesamt ist der gemeinsame Wille der Akteure die Grundlage für erfolgreiches Quartiermanagement. Es wurde sehr wohl auf Konkurrenzen und Probleme in der Zusammenarbeit hingewiesen.
|
Da in unserer Arbeitsgruppe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen kamen (aus verschiedenen Städten in Ost und West, auch aus dem Quartiermanagement), sind entsprechend differenzierte Probleme angesprochen worden – die auch ganz unterschiedlich eingeschätzt werden. Es ist schwierig, die Problemlage zu vereinheitlichen. So erweist sich zum Beispiel der Austausch zwischen den verschiedenen Ämtern als problematisch vor der Frage, wer welche Verantwortung hat, dies betrifft auch die Entscheidungskompetenzen. Dabei geht es darum, wo das Quartiermanagement angesiedelt wird. Zum einen werden Bearbeiter aus der Stadtverwaltung benannt, in anderen Fällen haben Büros diese Aufgabe übernommen. Es gibt verschiedene Formen der institutionellen Einbindung und des Zusammenwirkens verschiedener Akteure: Lenkungs- und Koordinationsrunden, aber auch Koordinatoren. In vielen Gebieten, in denen bereits Gremien existieren, werden diese einbezogen. |
 |
Als Problem wurde gesehen, dass durch das Quartiermanagement neue Akteure in ein Gebiet hineinkommen, sich ansonsten aber die Strukturen nicht ändern. Dies kann bedeuten, dass Quartiermanagement eine Alibifunktion bekommt und nicht zu einer tatsächlichen Änderung von Strukturen beiträgt.
Hinsichtlich der Instrumente können Stadtteilforen der Öffentlichkeit sehr viele Impulse geben, die in kleineren Arbeitsgruppen weiterentwickelt werden. Es ist möglicherweise auch sinnvoll, dass in diesen Quartiermanagementgebieten gerade durch das Eskalieren von Konflikten neue Ansätze gefunden werden können.
Thomas Franke
Mir scheint vor allem Ihr Eingangssatz wichtig, mit dem der gemeinsame Wille aller Akteure als Voraussetzung dafür betont wurde, auf der Umsetzungsebene etwas zu bewirken. Gleichzeitig haben Sie die Frage der Entscheidungskompetenzen angesprochen. Dies war auch beim Podium 1 die zentrale Frage: Verfügungsfonds, Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure mit unterschiedlichen Ressourcen.
Hier kann ich überleiten zur Arbeitsgruppe "Verhältnis des Quartiermanagements zu Stadtverwaltung und Rat". Es geht dabei um eine Akteurskonstellation mit unterschiedlichen Arbeitsebenen. Welche Funktion, welche Aufgabe hat die Verwaltung in dem Zusammenspiel der verschiedenen Akteure? Wie sieht das Verhältnis von Verwaltung und Quartiersebene aus, welche Aufgaben und Herausforderungen entstehen daraus für das Quartiermanagement, und wie sind Informationsfluss und Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Quartiermanagement organisiert? Letztendlich geht es auch um die Frage: Wie kann Verwaltung motiviert werden, kooperativ zusammenzuarbeiten, das heißt, wie gesagt wurde, ihre "Hausaufgaben zu machen?" Dazu Herr Lindemann.
Klaus Lindemann, Arbeitskreis "Bündnis für Waldauer Kinder und Jugendliche", Kassel
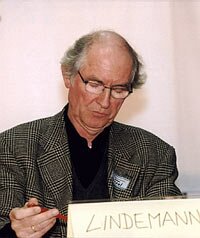 |
Ich bin Laie, das vorneweg, und ich hoffe, dass die Aspekte, die ich ausgewählt habe, einigermaßen den Tenor unserer Diskussion treffen und auch auf Ihre Fragen genügend eingehen. Es ging darum, was es – über die bisherige Stadtteilarbeit hinaus – durch das Programm Soziale Stadt für eine neue Qualität gibt. Gleich zum Aspekt: Was kann Verwaltung motivieren? Man kann aufgrund unserer Diskussion sagen, dass die beste Motivation ein klarer Rats- oder Magistratsbeschluss ist, der auch die Verwaltung in die Verantwortung nimmt und ihr deutlich macht, in welcher Weise von ihr erwartet wird, dass sie sich einer neuen Aufgabe stellt – auch indem sie entsprechende Strukturen und Prozeduren findet. Das klingt äußerlich, ist es bis zu einem gewissen Grade auch, aber es kommt etwas Zweites dazu: Es kommt darauf an, in den Verwaltungen Personen zu finden, die das sinnvoll finden oder die zumindest offen und lernfähig sind. Wenn man beides zusammennimmt, sind das entscheidende Voraussetzungen für ein gedeihliches Miteinander, das sonst nicht automatisch eintritt. In jedem Falle sind wir davon ausgegangen, dass man sich einen langfristigen Prozess vorstellen muss, von dem auch erwartet werden kann, dass nicht nur in dem Modellgebiet Veränderungen geschehen, sondern dass auch andere Stadtteile sich daran orientieren und auch andere Verwaltungen versuchen, ihre Arbeit zu "modernisieren". |
Wir haben uns den von Ihnen gestellten Fragen durch die Betrachtung der Dynamik genähert, die durch "Soziale Stadt" in Gang kommt. Es kann weder ausschließlich ein Von-oben-nach-Unten noch ein Von-unten-nach-Oben geben; vielmehr muss es ein Prozess sein, in dem die Beteiligten dank ihrer Offenheit und Lernfähigkeit bereit sind zuzuhören, aufeinander einzuwirken und Argumente auch von anderen aufzunehmen. Wir haben das mit dem Begriff "dialektischer Prozess" bezeichnet. Wichtig sind dabei die Initialzündungen. Es gibt verschiedene schöne Beispiele, wie so etwas in Gang kommt, letzten Endes aber keine allgemeine Wahrheit. Ein wichtiges Moment ist Projektorientierung, weil sich durch schnelles, besser: zügiges Handeln den Bürgern noch am ehesten vermittelt, dass hier etwas Neues geschieht. Außerdem ist eine Reihe von gruppendynamischen Regeln zu beachten, etwa: Keiner darf verlieren, der soziale Friede muss gewährleistet sein und Ähnliches.
Wir haben versucht, uns mit einem Organigramm dem Geheimnis dieser Prozesse anzunähern. Es herrschte Einvernehmen darüber, dass es erst einmal eine Gruppierung braucht, z.B. ein Bürgerforum, in dem die Bürger, die Stadtteilleute unter sich ihre Angelegenheiten klären. Das schließt nicht aus, dass auch Politiker, die im Stadtteil leben, daran teilnehmen. Auch muss es eine verwaltungsinterne Gruppe geben. Und entscheidend beim Quartiermanagement ist die Frage: Was liegt dazwischen? Ich hatte als interessierter Laie zunächst den Eindruck, dass es sich mehr oder weniger um eine Blackbox handelt. Aber es stellte sich dann doch heraus, dass es zur Zusammensetzung dieses Gremiums, für das es unterschiedliche Bezeichnungen gibt, und auch zu seinen Funktionen weitgehende Übereinstimmung gibt. Dabei wurde deutlich, dass je nach Größe des Quartiers ganz unterschiedliche Dimensionen ins Spiel kommen können, dass es auf jeden Fall wichtig ist, die jeweilige Situation im Stadtteil zu berücksichtigen.
Eine zentrale Frage war die nach der Entscheidungskompetenz – festgemacht am Beispiel des Verfügungsfonds. Ich hatte den Eindruck, dass die Meinungen eine ziemliche Bandbreite widerspiegelten. Vielleicht ist es nicht ganz falsch, es so zusammenzufassen, dass dank einer umsichtigen Regie durch das Quartiermanagement der Bürgerwille respektiert werden muss. Die Verwaltung würde sich dann bemühen, diesen adäquat und den Regeln entsprechend umzusetzen. Nur bei einem harten Dissens muss die Politik eine Entscheidung treffen.
Thomas Franke
Sie haben von Strukturen der Selbstbindung – auch der Verwaltung – gesprochen und vom persönlichen Engagement in der Verwaltung. Es reicht also offensichtlich nicht aus, Strukturen oder Programme in die Verwaltung zu bringen, sondern es geht besonders darum, dass auch die Inhalte, die vermittelt werden sollen, von den Akteuren aufgegriffen werden und nicht einfach nach "Plan B" gehandelt wird.
Klaus Lindemann
Dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Vielleicht kommt es daher, dass ich Pädagoge bin. Ich glaube, dass die Person das Entscheidende ist – natürlich im Rahmen von Sozialer Stadt, aber was wirklich geschieht, das entscheiden Personen.
Thomas Franke
Sie haben von verwaltungsinternen Runden und von Stadtteilgremien gesprochen, in denen die Professionellen zusammenkommen, um sich ein Bild zu machen, wie man theoretisch arbeiten könnte oder was im Stadtteil zu entwickeln ist. Und Sie haben von den engagierten Leuten in der Verwaltung gesprochen, die ebenso engagiert sind wie Quartiermanagerinnen und Quartiermanager auf der Umsetzungsebene. Haben Sie auch darüber gesprochen, wie da ein schneller Austausch oder eine relativ schnelle Kommunikation stattfinden kann?
Klaus Lindemann
Die Frage der Schnelligkeit ist schwer zu beantworten. Deswegen habe ich mich vorhin auch korrigiert und "zügig" gesagt; bestimmte Dinge brauchen ihre Zeit, und engagierte Personen werden auf allen Ebenen gebraucht. Innerhalb des Quartiermanagements müssen – man kann es sich als repräsentatives Gremium vorstellen – alle Entscheidungsträger beteiligt sein, sodass unter der Regie des Quartiermanagements – manchmal ist sogar Mediation notwendig –, die Entscheidungen so weit vorbereitet werden, dass es der Verwaltung und auch dem Magistrat nicht schwer fällt, die Wünsche der Bürgerschaft in deren Sinn auch umzusetzen.
Thomas Franke
Arbeitsgruppe 3 "Aktivierung der Bevölkerung": Neben mir sitzt Herr Fritsch, Bürger aus Halle. Diese Arbeitsgruppe hatte einen besonders großen Zulauf. Sie haben unter anderem zum Thema: "Mit welchen Methoden kann Quartiermanagement Bevölkerung aktivieren und erreichen?" diskutiert. Sie haben auch über das Problem gesprochen, dass man bestimmte Gruppen nicht erreichen kann und wie man damit umgeht: Methoden der Aktivierung, was sind Ziele von Aktivierung, warum aktiviere ich überhaupt Bürger, was kann ich mir als Quartiermanagement für Ziele setzen, und welche Rolle hat diese Aktivierung im Umsetzungsprozess auf der lokalen Ebene?
Andreas Fritsch, Bürger aus Halle
Wir haben uns erst einmal bemüht, den Begriff der Aktivierung einzugrenzen; er hat für uns drei Ebenen: die Ebene der Mitarbeit, die der Mitwirkung und die der Mitentscheidung. Wir haben, bevor wir in die Diskussion der Methoden eingetreten sind, klargestellt, dass wir im Quartiermanagement an den Folgen von Strukturproblemen arbeiten und dass dazu das Programm Soziale Stadt enorme Chancen bietet, auch wenn die Möglichkeiten letztlich begrenzt sind.
 |
In einer weiteren Fragestellung haben wir uns den Zielen genähert und festgestellt, dass es hier um nachhaltige Entwicklung von Quartieren geht, und dass insbesondere den Nachbarschaften, der Stärkung der Selbstorganisationskräfte im Quartier eine zentrale Bedeutung zukommt. Des Weiteren ist zu nennen, dass die Bürger Verantwortung übernehmen und sich mit ihrem Quartier verbunden fühlen. Wichtig war für uns auch, dass wir uns keine isolierte Diskussion vorstellen können, sondern dass wir an alle Bürger im Quartier herankommen – sowohl an die so genannten Mittelstandsbürger, wenn sie noch vorhanden sind, als auch an benachteiligte Problemgruppen. Was braucht man an Ressourcen? Da sind natürlich die Finanzmittel zu nennen. Unserer Meinung nach wären außerdem die lokalen Möglichkeiten vor Ort auszuloten – insbesondere mit den Wohnungsbaugenossenschaften. Jetzt zur zentralen Frage: Wie soll man so etwas durchführen? Eines lässt sich vorausschicken: Die Methode gibt es nicht; es gab aber einen Konsens in unserer Gruppe darüber, dass sich Quartiermanagement auf anschlussfähige Projekte beziehen sollte. Es sollte eine Vor-Ort-Präsenz geben und damit eine Art Problemermittlung sichergestellt werden. An Formen – nacheinander genannt, aber ohne Wertung – sehen wir eine aktivierende Befragung, bei der die Bürger tatsächlich von Haus zu Haus befragt werden, wie sie sich die zukünftige Entwicklung des Stadtteils vorstellen und ob sie bereit wären, mitzumachen. Es wurden Erfahrungen aus einem Quartier in Hamburg berichtet, wo das funktioniert hat. |
Des Weiteren sind Fragebögen erwähnt worden, auch kombiniert mit Preisausschreiben. Workshops, z.B. in Form von Zukunftswerkstätten, wären methodisch nachvollziehbar. Bürgerforen bieten immer noch die Möglichkeit, an Problemgruppen heranzukommen, die sich sonst nicht äußern.
Darüber hinaus ist der Aspekt Öffentlichkeitsarbeit stark betont worden. Zu den Fragebögen ist noch zu ergänzen, dass sie zeitnah rückgekoppelt werden sollten, damit die Bürger erfahren, was bei der Fragebogenaktion herausgekommen ist, und sie sich nicht als Datenlieferanten missbraucht fühlen. In diesem Zusammenhang steht auch die Öffentlichkeitsarbeit; alles, was im Quartier geschieht, sollte mit hoher Transparenz durchgeführt werden, und die Bürgerforen müssten regelmäßig auch der Informationsrückkopplung dienen. In Infoblättern kann auf Neuigkeiten aufmerksam gemacht und Kooperation angeboten werden.
Zentrale Bedeutung wurde in der Diskussion auch dem Verfügungsfonds zugesprochen, weil sich mit ihm in einer ausreichenden Finanzausstattung sehr viel schneller Dinge realisieren lassen und nicht erst, wie als Negativbeispiel aus einer Stadt berichtet wurde, ein siebenseitiger Antrag zu stellen ist. Es geht damit um einen Verfügungsfonds, über den die Bürger entscheiden können und mit dem sie – wie sich herausgestellt hat – sogar pfennigfuchserisch umgehen. Das stellt eine zentrale Form der Aktivierung dar.
Thomas Franke
Zu den Formen, die der Aktivierung von Quartiersbevölkerung dienen sollen, habe ich eine Frage: Gibt es auch Aktivierungsformen, die nicht diesen Veranstaltungscharakter haben? Sie haben weiter darüber gesprochen, dass zur Aktivierung der Quartiersbevölkerung auch die Vor-Ort-Bevölkerung wichtig ist. Das heißt, man kann diese Veranstaltungen auch dezentral konzipieren. Diese Vor-Ort-Präsenz scheint wesentlich zu sein, wenn man Bevölkerungsgruppen erreichen möchte. Sie haben gesagt, dass schwer erreichbare Gruppen einen Kern für die Beantwortung der Frage bilden, wie man Bevölkerung aktivieren kann. Haben Sie dazu in der Arbeitsgruppe konkreter, vielleicht auch über Beispiele gesprochen?
Andreas Fritsch
Zum einen: Die aktivierende Befragung hat kaum Veranstaltungscharakter. Wir haben in der Diskussion festgestellt, dass sich Gemeinsamkeiten nur schwer entwickeln lassen, weil die Quartiere, über die wir reden, sehr unterschiedlich sind. Beispielsweise wurde ein Quartier erwähnt, in dem 28 Sprachen gesprochen werden. Da geht es natürlich bei Bürgerbeteiligung zuerst einmal darum, die sprachliche Barriere zu beseitigen. Bei anderen Quartieren, beispielsweise Plattenbausiedlungen hier im Osten der Republik, gibt es ganz andere Probleme. Die haben eher mit den Leerständen zu tun. Die von uns genannten Punkte beziehen sich auf konkrete Formen, die uns realisierbar erscheinen.
Thomas Franke
Das bedeutet, dass es für Aktivierungsstrategien – wie gestern auch zum Quartiermanagement besprochen – kein Patentrezept zu geben scheint, sondern sie sich an den spezifischen Ausgangsbedingungen und den jeweiligen Problemlagen orientieren müssen. Dieser Befund ist mit Sicherheit auch spannend, wenn wir uns den Aufgabenstrukturen und der Qualifikation von Quartiermanagement zuwenden. Ich hatte den Eindruck, dass es auch hier keine Patentrezepte gibt. Ludger Schmitz aus der Arbeitsgruppe 4 "Aufgabenstruktur und Qualifikation": Welche Aufgaben, welche Funktion hat Quartiermanagement? Wie strukturiert man das? Welche fachlichen und persönlichen Qualifikationen muss eine Quartiermanagerin oder ein Quartiermanager haben?
Ludger Schmitz, Stadtteilmanagement in Stendal und Schwedt
 |
Wir haben uns ein bisschen schwer getan, weil wir gemerkt haben, wie viele unterschiedliche Formen von Stadtteilarbeit es tatsächlich gibt. Es war schwer, all dies auf einen Nenner zu bringen. Die Aufgaben sind sehr komplex und sehr unterschiedlich. Wir haben zum Teil kontroverse Ansichten gehabt – die Mehrzahl kam aus der Gemeinwesenarbeit – zum Themenkomplex Stadtplanung und Sozial- oder Gemeinwesenarbeit. Die dritte Säule kommt über die URBAN-Schiene herein, wo es um europäische Strukturfördermittel geht; wenn wir dann noch die Wirtschaftsförderung hinzunehmen, ist man irgendwann an dem Punkt angelangt, an dem der Stadtteilmanager eine Art "eierlegende Wollmilchsau" sein muss, eigentlich derjenige, der alles können muss. Daran hat sich in der Diskussion die Frage geknüpft, was eigentlich die Hauptaufgabe von Quartiermanagement ist. Wir haben ein bisschen auf den Managerbegriff zurückgegriffen. Ist das eigentlich der richtige Begriff? Ein Manager kommt eher aus der Wirtschaft und soll eigentlich einen am Boden liegenden Betrieb wieder "auf die Beine bringen". Dabei kümmert er sich nicht darum, dass die letzte Schraube angedreht ist. Manager versuchen vielmehr, die Strukturen des Betriebs zu erkennen, die Ursachen dafür herauszufinden, warum etwas schief gelaufen ist, und sie versuchen, an die entsprechenden Leute und Institutionen mit Lösungswegen heranzukommen. Die Koordinationsarbeit muss also die Hauptarbeit sein, und wir sollten nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen. Nicht wir oder die Quartiermanager sind diejenigen, die die Aktionen und die Arbeit machen, sondern wir müssen die Initialzündungen geben – ein relativ schwieriger Prozess. Das ist denen, die schon länger dabei sind, auch klar. |
Auch alleine da zu sitzen, ist dramatisch. Es muss klar gesagt werden, dass Quartiermanagement vor Ort mit mindestens zwei bis drei Leuten ausgestattet sein muss. Wir haben dazu das Bild von einem Tandem benutzt. Die Aufgabenstellung des Quartiermanagements erfolgt in der Regel durch die Verwaltung; dann kommt das Quartiermanagement, das als Regulativ dagegenwirken soll. Nun kommt es darauf an, dass beide wirklich auf einem Tandem "zusammen radeln", dass nicht einer vorne oder einer hinten alleine "radelt". Wenn es funktionieren soll, müssen beide "radeln".
Eine wichtige Frage war, inwieweit das Quartiermanagement Anwalt für bestimmte Gruppen ist. Ist das Quartiermanagement Anwalt für die Randgruppen oder Problemfälle? Darüber gab es kontroverse Meinungen; ob es also um absolute Neutralität und wirklich nur die Koordination der Interessen geht, aber nicht um die Anwaltschaft für eine Seite. Kontroversen beziehen sich darauf, inwieweit das Quartiermanagement Sprachrohr für Randgruppen sein kann, die sich in der Öffentlichkeit in der Regel nicht artikulieren. Die Frage kann wohl letztlich nicht beantwortet werden, man muss die spezifische Situation in dem Quartier beachten.
Am Schluss haben wir die Qualifikation diskutiert. Das fiel uns relativ schwer. Am liebsten wäre uns derjenige, der als Kommunikationswissenschaftler in der Moderationsrolle perfekt ist; das heißt, es kann nicht allein der Stadtplaner, allein der Sozialarbeiter sein. Die Sprache ist das Wichtige. Wir stellen immer wieder fest, wie häufig wir aneinander vorbeireden, wenn einer aus der einen Gruppe mit einem aus der anderen Gruppe spricht. Es muss die Fähigkeit vorhanden sein, die Wirtschaftssprache, Sozialsprache und Planungssprache zu kennen und zu beherrschen, damit wir den Input für das Quartiermanagement erkennen können. Außerdem darf sich das nicht im stillen Kämmerlein abspielen, sondern muss nach außen weitergegeben werden.
Das Ganzheitliche und nicht nur das eigene Fachressort zu sehen, ist eine wichtige Fähigkeit. Teamfähigkeit muss gegeben sein. Es wurde auch diskutiert, ob sich Quartiermanagement in Förderprogrammen auskennen muss. Doch auch da geht es hauptsächlich um die Frage, wie man sich die Wege zu den Leuten mit Fachwissen erschließen kann, und wie man für sich mit minimalem Aufwand herausfindet, was man von diesem Fachwissen definitiv braucht oder inwieweit man andere motivieren kann, ihr Fachwissen in die Sache einzubringen.
Diese Motivationsförderung ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich viele Fachleute gibt, die für diese Aufgabe fähig sind, wenn sie bestimmte Qualifikationsmerkmale haben, nämlich die Motivation, das Miteinanderringen, die Kenntnis der Fachsprachen der einzelnen Ressorts. Noch schwerer haben wir uns damit getan, was es eigentlich für Qualifizierungsangebote gibt, also inwieweit Moderation und das Erschließen von Aufgabenfeldern vermittelt werden. Einige Verwaltungen entwickeln für sich selbst Antworten auf die Frage, inwieweit sie eher dienen lernen sollen, inwieweit das auch mit bestimmten Sprachen und Verhaltensmustern einhergeht.
Thomas Franke
Drei Aspekte fand ich besonders interessant, sie sind auf dem gestrigen Podium auch schon angeklungen. Quartiermanagement kann offensichtlich nicht als alleinige Problemlösungsinstanz etabliert werden. Dies bedeutet, dass, wenn etwas nicht so läuft, wie es in der Verwaltungsagenda vorgesehen ist, nicht dem Quartiermanagement die Schuld zugewiesen werden kann. Das betrifft auf der einen Seite das Problem des Aufgabenspektrums des Quartiermanagements, aber vielleicht auch das der Aufgabenüberlassung.
Sie haben auch die je unterschiedlichen Ausgangslagen, Quartiere und Probleme angesprochen. Hier gibt es vielleicht übertragbare Ideen, wie man Quartiermanagement einrichten kann, aber sicher keine Patentlösung, wie man vor Ort agiert. Zum Thema Sprache erinnere ich daran, dass beim Podium 1 gefordert wurde, eine Quartiermanagerin oder ein Quartiermanager sollte einen engen Gebietsbezug haben. Die "Sprache des Quartiers" ist elementar, wenn man an Begriffe wie Motivation oder auch Akzeptanz denkt.
"Beschäftigung und Qualifizierung" lautete der Titel der Arbeitsgruppe 6. Die bisherigen Arbeitsgruppen haben sich mit Organisation und Verfahren von Quartiermanagement beschäftigt. Jetzt kommen wir in den Bereich der thematischen Handlungsfelder von Quartiermanagement. Frau Stuhr arbeitet im sächsischen Modellgebiet "Leipziger Osten" und versteht Beschäftigung und Qualifizierung als wesentliche Bestandteile von lokaler Ökonomie. Es gibt viele Träger, es gibt verschiedene Akteure, die in lokale Beschäftigungsmaßnahmen und -projekte involviert sind. Es gibt sicherlich auch verschiedenste Mittel, die zum Einsatz kommen. Wie kann man Quartiermanagement hier koordinieren?
Diana Stuhr, lokale Beschäftigungsentwicklung, Leipzig
 |
Das von uns schnell erkannte Problem ist, dass wir Quartiermanagement in unterschiedlicher Größe und mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen haben. Wir haben die Aufgabe, der Beschäftigungsqualifizierung nachhaltige Strukturen mit dem Einsatz von temporären Maßnahmen zu schaffen. Das bedeutet, wir müssen unterschiedliche Fördermöglichkeiten und Träger bündeln. Dabei sind wir sehr schnell an die Grenzen des eigentlichen Quartiermanagers gelangt, weil es unmöglich ist, durch die vielfältigen Aufgaben das Thema Beschäftigungsförderung noch zusätzlich zu bewältigen. Es gab Übereinstimmung darüber, dass eine Struktur geschaffen werden muss, die den Komplex Beschäftigungsförderung steuert. Das kann zum einen heißen, dass das Thema extern ausgesiedelt wird. Es gab zum anderen den Vorschlag, innerhalb des Quartiermanagements einen integrierten Beschäftigungsmanager einzustellen. Auf alle Fälle müsste es eine Person oder eine Personengruppe sein, die einen Überblick über das gesamte Gebiet hat, also über alle Träger und Möglichkeiten, an die Wirtschaft und die Bevölkerung heranzukommen. Aufgabe des Quartiermanagers ist es in diesem Zusammenhang, den Kontakt mit der Wirtschaft zu halten, die Probleme zu analysieren und die Ergebnisse an die externe und interne Struktur weiterzugeben. |
Wenn wir eine solche Beratungsstelle haben, war das zweite Problem, auf das wir gestoßen sind, die Bedeutung der Autorität, das heißt: Wie bringe ich die Beteiligten im Projekt dazu, sich an Abstimmungsgrundsätze und an das Gebot der Überschaubarkeit zu halten? Wir haben viele Maßnahmen und Aktionen, die parallel und unkoordiniert laufen. Wir müssen also versuchen, ein System zu finden, in dem das alles organisiert, zentriert und überschaubar gemacht wird. Eine Möglichkeit wäre, einen Stadtteilbeirat in der Organisationsform eines Forums einzurichten, wo Projekte diskutiert und beschlossen werden und wo ein Überblick über die Träger besteht, das heißt ein zentrales Forum, bei dem alles zusammenläuft. Viele Städte gehen direkt über ihre Ämterrunden. Es gibt so viele Ansätze, dass sich kaum sagen lässt, welches der richtige Weg ist. Wichtig ist zu versuchen, so viele Mittel wie möglich zu bündeln und Synergien herzustellen. Durch die Doppelungen gehen auch große Chancen verloren. Beschäftigungsförderung, Qualifizierung an sich ist ein langwieriger Prozess, das heißt, man kann die Ergebnisse nicht in zwei Jahren sehen. Die Wirtschaft braucht Zeit, damit die Ergebnisse im Stadtteil realistisch betrachtet werden können.
Thomas Franke
Sie haben von temporären Maßnahmen bei Beschäftigung und Qualifizierung gesprochen. Was bedeuten diese für die "Projektkulisse im Quartier?"
Diana Stuhr
Das heißt, dass viele Maßnahmen auf ein Jahr beschränkt sind. Das fängt an bei ABM und Beschäftigungsprojekten, bei denen Teilnehmer z.B. Arbeitsverträge für ein Jahr haben, und die Maßnahmen danach auslaufen. Wir müssen Wege finden, wie nach Ablauf dieser Maßnahmen der Stadtteil trotzdem noch erhaltenswert bleibt und die Ergebnisse dieser Maßnahmen im Stadtteil weiterhin vorhanden sind – zum Beispiel über Stadterneuerung, über Abrissarbeiten, bei denen man nachhaltig auch diese neu entstandenen Flächen pflegt. Das heißt im Zusammenhang mit Wirtschaftsförderung auch, die Unternehmen irgendwann einmal alleine lassen zu können, sodass diese sich selbst tragen und der Stadtteil nach Abschluss der Projekte nicht wieder auf seinen Ausgangspunkt zurückfällt.
Thomas Franke
Sie haben darüber gesprochen, dass unterschiedliche Akteure und Träger von Maßnahmen koordiniert werden müssen, und dass dies eine sehr umfangreiche Aufgabe ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, überlegen Sie auch, ob diese Koordination ausgelagert werden soll, also nicht unmittelbar Aufgabe des Quartiermanagements vor Ort sein muss. Sie haben auch die Verbindlichkeit von Beschlüssen angesprochen. Wenn eine Vielzahl von Akteuren zusammengebracht wird, wenn also Aktivierung und Koordination gelingen, welche Art von Verabredungen muss dann mit welchem Grad von Verbindlichkeit getroffen werden, damit Maßnahmen erfolgreich sind und diejenigen, die sich verabredet haben, tatsächlich dem Plan entsprechend handeln?
Diana Stuhr
Ich bin der Meinung, dass bei einem derart großen Programm, in dem mit viel Geld umgegangen wird, bestimmte Handlungsrichtlinien gelten müssen, innerhalb derer sich jeder bewegen sollte. Das fängt erstens damit an, sich mit anderen Projektbeteiligten im Gebiet und mit anderen externen Projekten abzustimmen. Es darf nicht dazu kommen, dass wir beispielsweise einen Händler im Stadtteil in einer Woche mit fünf verschiedenen Organisationen besuchen und der eine einen Praktikanten, der andere einen Jahresarbeitsvertrag anbietet. Zweitens müssen wir unsere Projekte durchschaubar machen und Bericht über sie erstatten. Das müsste in Handlungsrichtlinien integriert werden, damit wir von den anderen wissen und die Angst voreinander ablegen, der andere könnte uns den Auftrag wegnehmen. Oft sind Synergie- und Kooperationsmöglichkeiten vorhanden, die man erkennt, wenn man einfach nur miteinander spricht.
Thomas Franke
Die Arbeitsgruppe 7 "Bildungs- und Kulturarbeit" hatte relativ wenige Teilnehmer. Ich frage mich, ob dieses Thema nur geringe Bedeutung im Rahmen von integrativen Handlungskonzepten hat oder ob vielleicht die Organisationsfragen derzeit als wichtiger erscheinen. Frau Cremer ist die Sprecherin dieser Arbeitsgruppe und Quartiermanagerin in Berlin-Marzahn. Welche Bedeutung haben Bildung und Kultur im Quartier? Und was kann Quartiermanagement in diesem Zusammenhang leisten?
Cornelia Cremer, URBAN-Plan, Berlin
 |
Zunächst haben wir den Titel der Arbeitsgruppe umformuliert. Wir haben nicht von "Bildungsarbeit und Kultur" gesprochen, sondern von "Kunst und Kultur" im Quartier. Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass wir sehr wenige waren, nämlich vier Personen. Wir dachten erst, vielleicht sind wir ja "hinter dem Mond", haben uns zum Schluss aber eher als sehr weitblickend begriffen. Die Förderung der "sozialen Stadt" betrifft die baulich-räumliche Entwicklung und die soziale Stadtentwicklung auf der programmatischen Ebene im Programm Soziale Stadt. Wir sind der Meinung, dass dieser Ansatz um den Aspekt Kunst und Kultur erweitert werden muss. Auch das muss im Stadtteil gefördert werden. Dafür sollten sich alle stark machen. Warum? Dazu haben wir drei Schlüsse gezogen: "Kunst und Kultur" im Stadtteil aktiviert, fördert Kommunikation und stärkt die Kreativität. Dies sind genau jene Bausteine, die beim Empowerment der Bewohner zum Tragen kommen, die Bausteine, die zu einem lebendigen Stadtteil führen. |
Kunst- und Kulturereignisse im Stadtteil sind nicht zuletzt auch imagebildend. Wir alle arbeiten in einem gestressten Stadtteil, deswegen auch die Förderung. Sehr interessant waren Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen; aus Berliner Sicht hat man den Eindruck, dort sei man schon viel weiter, weil es bereits wesentlich länger Quartiermanagement gibt. Dennoch berichtete der Kollege von einem Gespräch mit dem Kulturamt: Wie können wir uns mit dem Quartiermanagement vernetzen? Die Antwort, die ich so auch kenne, war: "Ja, keine Zeit, kein Personal, kein Geld". Es muss nicht so sein, aber ist häufig so, dass man als Quartiermanager erst Überzeugungsarbeit leisten muss, dass Kultur im Quartier etwas sehr Wichtiges ist.
Wir haben über verschiedene Projekte diskutiert, über Kunst- und Kulturprojekte zusammen mit Bewohnern, aber auch darüber, Künstler in die Quartiere zu holen. Ich möchte gerne auf zwei Projekte aus Nordrhein-Westfalen hinweisen: auf die "Markierung von Angsträumen" und auf die "Schreibwerkstatt". Es geht aber nicht in jedem Stadtteil darum, für Ateliers Räume bereitzustellen, Räume für Ausstellungen. Wir haben über ein breites Spektrum geredet, haben dann aber gemerkt – und daraus leitet sich eine wichtige Forderung ab –, dass eine Vernetzung fehlt, eine Plattform, wo man andere Projekte kennen lernt und sie übertragbar macht.
Man braucht Ideen, auch Quartiermanagement-Ideen. Quartiermanagement soll ein bisschen dazu inspiriert werden, sich an die Menschen zu wenden, Künstlerverbände aufzusuchen, stärker mit Künstlern ins Gespräch zu kommen, diese dafür zu interessieren.
Eine letzte Forderung haben wir an das Difu. Wenn es noch einmal eine Tagung zum Quartiermanagement organisiert, wäre es schön, unsere Idee aufzugreifen und Künstler sowie Kulturschaffende einzuladen, damit wir mit ihnen in einen Dialog treten können.
Thomas Franke
Danke, auch für diese Anregung. Offensichtlich scheinen die Leistungsfähigkeit, das Potenzial von Kunst im öffentlichen Raum oder in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf und die Wertschätzung – Sie sagten vorhin "Keine Zeit, kein Personal, kein Geld" –, um die das Quartiermanagement kämpfen muss, auseinander zu klaffen.
Die letzte Gruppe "Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen" wird durch Herrn Tappe vertreten. Wie wichtig sind Kinder und Jugendliche im Stadtteil? Wer sind überhaupt "die" Kinder und "die" Jugendlichen? Muss man sich darüber Gedanken machen, ob es innerhalb dieser Zielgruppe noch Unterzielgruppen gibt? Welche Rolle spielen sie? Und die Frage ist natürlich auch, wie und vor allem wo kann man Kinder und Jugendliche erreichen, die sich wahrscheinlich anders angesprochen fühlen und woanders anzutreffen sind als die Erwachsenen, um die es auch geht?
Jens Tappe, Student der Sozialpädagogik an der Fachhochschule Magdeburg
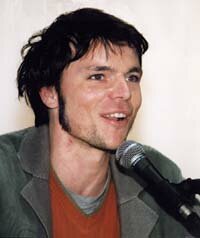 |
Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gesprochen, und Sie sind eine ganze Menge. Ich würde also jetzt lieber eine Hausarbeit schreiben. Das erste, was wir in der Arbeitsgruppe nach einer kurzen Vorstellungsrunde festgestellt haben, ist, dass eine ganze Gruppe von Menschen, die schließlich auch Bewohner des Quartiers sind, ausgeblendet wird. Fast die Hälfte unserer Gruppe kam aus der sozialpädagogischen Fachrichtung, aber es fand sich niemand, der hätte sagen können, wie eine Mitwirkung von Jugendlichen aus stadtplanerischer Sicht aussehen könnte. Deshalb haben wir etwas länger über die Rahmenbedingungen für die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Schließlich haben wir gefordert, dass bei allen am Quartiermanagement Beteiligten – auch von stadtplanerischer und Verwaltungsseite – ein eindeutiges Bekenntnis zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen da sein muss, und das nicht nur als ein Lippenbekenntnis, sondern diese Beteiligung muss wirklich gewollt sein. |
Man muss sich auch bewusst sein, dass die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen andere Formen des Zugangs erfordert; damit sind wir dann bei unserem eigentlichen Thema. Für Kinder und Jugendliche muss man sehr niederschwellige Angebote machen, besonders für Emigranten und Benachteiligte, weil die über konventionelle Formen der Mitwirkung sehr selten angesprochen werden.
Für Quartiermanager sind sicherlich die Schulen ein wichtiger Ort und Ansprechpartner. Bei Kindern und Jugendlichen muss beachtet werden, dass sie ein Bedürfnis nach zeitnahen Entscheidungen mit zeitnahen Aktivitäten haben; wenn sie sich engagieren, dann auch, um etwas dafür zu bekommen. Es ist nötig, dass sie schnell sehen oder zumindest hören von dem, was sie getan haben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht an der Planung beteiligt werden können. Nur ist es nötig, dass über ihre Vorschläge die betreffenden Leute schnell entscheiden. Es gab einen Vorschlag zur Jugendarbeit, dass im Rahmen des Verfügungsfonds ein eigener Etat vorhanden sein sollte, damit bestimmte Vorhaben zeitnah umgesetzt werden können und z.B. nicht erst über verschiedenste Gremien ein bisschen Farbe für eine Wand beantragt werden muss.
Klar ist auch, dass es bei Kindern und Jugendlichen noch verschiedene Untergruppen gibt. Das fängt beim Alter an. Kinder kann man wahrscheinlich in Bezug auf ihr eigenes Stadtviertel mit einem spielerischen Stadtteilrundgang erreichen, während die Älteren das als Spielerei empfinden und gar nicht erst mitmachen. Die Älteren kann man eventuell eher über kulturelle Angebote ansprechen.
Beim Verfügungsfonds ist wichtig, dass damit eine gewisse Autonomie der Jugendlichen garantiert wird und sie im Prinzip die gleichen Probleme durchmachen, die ein Quartiermanager auch hat. Wenn ich mir vorstelle, dass es unter den Jugendlichen die Hip-Hopper, die Kleinen, die Großen, die Punker, die Stinos und was weiß ich nicht alles gibt, dann hat jeder gruppenbedingt eigene Interessen: Während der Skateboarder und die Hip-Hopper wahrscheinlich eher eine Skateboardrampe haben möchten, wollen andere einen Bolzplatz. Das müssen diese Gruppen untereinander aushandeln – hoffentlich machen sie es dann auch –, um abzuwägen, was sinnvoller ist. Es handelt sich um die gleichen Probleme wie beim Quartiermanagement: Welches Projekt fördert man, welches nicht?
Thomas Franke
Zwei Punkte fallen mir auf, die wir bereits in einem anderen Kontext diskutiert haben, erstens das Thema "Sprache". Sie haben vorhin gesagt, dass sich vor allem Sozialberufe um Kinder und Jugendliche kümmern. Es wäre aber eigentlich notwendig, dass auch andere Professionen mit Kindern und Jugendlichen zusammengebracht werden. Die Frage, wie man Kinder an Stadtplanungsprozessen beteiligt, ist letztlich ein "Sprachproblem". Wie kann man Planungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sensibilisieren, Kinder zu verstehen oder sich Kindern gegenüber angemessen auszudrücken? Oder umgekehrt: Wie können sich Kinder und Jugendliche in die strengen Rationalitäten beispielsweise eines Planungsamtes hineindenken? Diese Vermittlungsarbeit ist auch eine zentrale Aufgabe von Quartiermanagement, wenn man die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ernst nimmt.
Sie sprachen auch vom Verfügungsfonds dahin gehend, dass man einen noch schnelleren Sonderfonds für Kinder einrichten sollte. Darin steckt für mich auch das Thema Entscheidungskompetenzen: wenn man über Entscheidungskompetenzen oder – deutlicher ausgedrückt – über Dezentralisierung von Macht auf die Quartiersebene spricht, hat man meiner Meinung nach Kinder und Jugendliche nicht automatisch im Blick. Die Frage ist, wie Kinder und Jugendliche ermächtigt werden, an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen im Stadtteil aktiv mitzuwirken.
Wir haben noch 20 Minuten zur Diskussion. Da das Spektrum der angesprochenen Verfahren, Probleme, Kommunikationsstrukturen so groß war, sollten wir die Diskussion jetzt offen gestalten.
Helga Rake, plankontor, Hamburg
 |
Ich bin im Quartiermanagement tätig. Ich möchte voranschicken, dass ich es bedauerlich finde, dass erstens die Kulturarbeitsgruppe so dünn besetzt war, und dass zweitens die Gruppe "Gesundheit" ganz ausgefallen ist. Wir haben in unserer Arbeit erfahren, dass Gesundheit gerade in den benachteiligten Stadtteilen eine immense Rolle spielt, einmal wegen der Monostruktur dieser Stadtteile, die zur Folge hat, dass die Leute unter psychischen Problemen leiden, dann aber auch durch Arbeitslosigkeit und kumulierte Probleme, mit denen sich diese Menschen oft konfrontiert sehen. Sie sind auch oft nicht in der Lage, die einfachsten gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Deshalb haben wir dieses Thema aufgegriffen. Ich empfehle auch den anderen, die in dem Bereich arbeiten, sich dieses Themas anzunehmen. Außerdem möchte ich auch unterstützen, was Frau Cremer zum Thema "Kunst und Kultur" gesagt hat: Auch dies ist ein wesentlicher Bestandteil in der "sozialen Stadt", zumal wir uns in einer Freizeitgesellschaft befinden. Außerdem können über Kunst- und Kulturprojekte einerseits Arbeitsplätze geschaffen werden, andererseits lässt sich durch Wandbilder usw. auch Identifikation mit dem Stadtteil erzielen. |
Drittens gibt es ein Theater- und Musikprojekt für Jugendliche, das ich in einer Kleinstadt in Niedersachsen – Nienburg an der Weser – kennen gelernt habe, das auch in die Soziale Stadt eingebunden werden soll. Hier haben Jugendliche die Möglichkeit, selbst Stücke zu schreiben, selbst die Musik dazu zu machen, sie selbst aufzuführen. Sie lernen dabei Beleuchtung, Tischlerarbeiten und alles, was zum Theater dazugehört. Dieses hervorragende Projekt dient außerdem der sozialen Integration von Jugendlichen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Die Gruppe heißt Sputnitsche und reist auch durchs Land. Sie können die Gruppe für Ihren Stadtteil anfordern und sich die Theaterstücke, z.B. "Amerika", ansehen. Solche Projekte sind integrationsfördernd. Deshalb muss darauf mehr Schwergewicht gelegt werden.
Noch eine Bemerkung zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen: So schwierig, Herr Franke, wie Sie das dargestellt haben, sehe ich das nicht, denn Kinder sind sehr offen und bereit, und sie möchten auch gerne beteiligt werden. Das Problem sind in der Tat die Zeitdimensionen, z.B. bei einer Spielplatzplanung. Da vergehen zwei, drei Jahre, bis die Fördergelder kommen. Und dann sind die Kinder bereits dieser Spielgruppe entwachsen und brauchen eigentlich wieder etwas anderes. Deshalb plädiere ich dafür, dass sehr kurzfristig gehandelt wird. Wir haben ein Projekt durchgeführt, bei dem man Kindern einen Kinderstadtplan an die Hand gibt, der gemeinsam mit Kindern in einem Stadtteil erarbeitet wurde. In diesem Plan können sie nachgucken, wo ihre Lieblingsspielplätze sind, aber auch, wo die gefährlichen Bereiche sind, also Kreuzungsübergänge usw. Da haben sie wirklich etwas in der Hand, das ist der erste Schritt zur Beteiligung. Darauf sind sie dann auch ungeheuer stolz. Das Projekt macht Mut, dass man mit Kindern wirklich etwas erarbeiten kann; die Planer vor Ort sind da schon sehr offen.
Thomas Franke
Wir vom Difu haben uns gestern Abend die Frage gestellt, warum manche Arbeitsgruppen so stark besetzt waren und zwei ausfielen. Drückt sich darin eine Bewertung aus? Sind die beiden ausgefallenen Themen tatsächlich nicht interessant? Oder stehen andere Fragen gegenwärtig noch im Vordergrund, z.B. die Folgenden: Wie organisiere und strukturiere ich Quartiermanagement? Welche Aufgaben kann, darf und soll es haben, und welche Qualifikationen braucht man?
Karin Schmalriede, Lawaetz-Stiftung, Hamburg
 |
Ich komme von einem Träger, der im Quartiermanagement tätig ist. Mir ist aufgefallen, dass sehr oft gesagt worden ist, es gebe keine Patentrezepte. Das ist natürlich richtig. Aber es gibt viele wunderbare Erfahrungen, auf die zurückgegriffen werden kann. Und das ist mindestens ebenso wichtig wie die Information, dass es keine Patentrezepte gibt. Man muss alles sicher gebietsgenau vorstrukturieren und entwickeln. Deshalb ist der Austausch unter denen, die in der Praxis tätig sind, sehr zentral, ob das nun im Gesundheits- oder im Kinderbereich ist. In unserer Arbeitsgruppe "Aktivierung" waren sehr viele, die positive Erfahrungen mit der Aktivierung von Kindern und Jugendlichen gemacht haben. Man kann halt nur in eine Arbeitsgruppe gehen, das ist das Problem. |
Thomas Franke
Der Komplex Erfahrungsaustausch wird auch nachher noch angesprochen werden. Es gibt unterschiedliche Ebenen von Erfahrungsaustausch. Hier mit 300 Menschen in verschiedenen Arbeitsgruppen lassen sich die Probleme wahrscheinlich nur anreißen, nicht tiefgehend genug behandeln, obwohl durchaus auch Praxisbeispiele ausgetauscht wurden. Der Erfahrungsaustausch wird noch zunehmen müssen, ein Erfahrungsaustausch auch mit denjenigen, die eingebunden werden müssen, die persönliches Engagement zeigen oder entwickeln sollen.
Bernd Hartmann, Magdeburg
 |
Ich habe eine Nachfrage an die Podiumsteilnehmer. Vorher aber meine persönliche Meinung dazu, warum die Besetzung der Themen so unterschiedlich ausgefallen ist. Für mich wird das am Beispiel Gesundheit und Quartiermanagement ziemlich deutlich. Vielleicht sollten wir uns alle selbst einmal im Spiegel angucken. Ich habe den Eindruck, dass das auch etwas damit zu tun hat, in welche Milieus man sich begibt: zu Workshops, zu Tagungen oder Ähnlichem. Ich persönlich kenne z.B. eine Gruppe von Leuten, die sich sehr intensiv mit Gesundheitsfragen und Wohnen sowie mit Gesundheitsmanagement beschäftigt. Ich sehe aber von diesen keinen einzigen hier. Herr Tappe, Sie kennen die Leute von der Fachhochschule Magdeburg auch. Vielleicht haben Sie dazu noch eine Ergänzung. |
Vorher aber noch meine Frage. Ich habe in den Resümees der Arbeitsgruppen etwas vermisst und wollte nachfragen, ob das vielleicht doch eine Rolle gespielt hat. Sowohl bei den Aktivitäten oder Aktivierungen der Bürger als auch in dem Spezialgebiet "Jugend und Soziale Stadt" fehlt mir das Instrument Informationstechnologien, Internet. Davon habe ich bis jetzt nichts gehört. Ich vermute aber, dass es eine sehr große Rolle spielen könnte, zum einen, weil ich die Gruppe Jugendliche und Kinder damit sehr gut erreiche, und weil die Schwelle der Beteiligungsmöglichkeit sehr niedrig ist. Außerdem ist eine gewisse Anonymität, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, gewahrt. Ich kann mir vorstellen, dass Bürgerbeteiligung für bestimmte Gruppen auf diesem Wege einfacher möglich ist, vielleicht auch aufgrund von persönlich gewollten Abgrenzungen. Nur als Extrembeispiel: Welcher Jugendliche hat Lust, zu den Bürgerforen zu kommen, in denen die Rentner und Vorruheständler sitzen und auf die Jugendlichen mit ihrem Bolzplatz schimpfen? Das heißt doch aber, dass für die Jugendlichen andere Möglichkeiten erschlossen werden müssen.
Kurt Bader, Fachhochschule Nordostniedersachsen, Lüneburg
Ganz kurz zu Gesundheit, Kunst und Kultur. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Bereiche, die unangenehm sind, die Bereiche, die den Staat viel Geld kosten, werden stigmatisiert und privatisiert oder an den Rand gedrängt. Die Politikverdrossenheit ist ein Ergebnis der Tatsache, dass die Bevölkerung wenig an Gestaltung teilhaben kann. Das Thema Gesundheit erscheint uns angesichts der ganzen Privatisierungstendenzen zunehmend als ein Bereich, von dem wir meinen, dass wir unsere Angelegenheiten hier privat "richten" müssen. Das wird uns politisch auch nahe gelegt. Kultur und Kunst sind nur dann gut, wenn sie oppositionell sind; wenn man sie aber ghettoisiert, ausgrenzt und als Sonderbereich etikettiert, hat die Normalbevölkerung damit nichts mehr zu tun. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Umso mehr müssten, wenn aktive Selbstgestaltung und Mitgestaltung im Mittelpunkt stehen, kulturelle und künstlerische sowie gesundheitliche Aspekte – und zwar Gesundheit im Sinne von Teilhabe und Wohlergehen – viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir müssten da etwas offensiver herangehen.
Rolf-Peter Löhr, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
Die Arbeitsgruppen zu Jugend, Gesundheit und Kunst sind ja nicht deswegen so schwach besetzt gewesen oder ausgefallen, weil wir sie schlecht behandelt hätten, sondern weil die Prioritäten anders gesetzt worden sind. Das war keine staatliche Vorgabe, sondern unsere, Ihrer aller Entscheidung. Vielleicht ist das auch einfach Ausdruck eines Prozesses. Wir sind mit der Sozialen Stadt am Anfang einer schwierigen Entwicklung. Die Kooperation auch im engeren, unmittelbar auf Stadtentwicklung bezogenen Bereich ist schwierig genug, sodass diese anderen Themen eher hintangestellt werden.
Das Difu wird mit dem Landesgesundheitsamt Brandenburg eine Veranstaltung machen, bei der aufgearbeitet werden soll, warum diese Zusammenarbeit nicht so gut klappt, wie man sich das vorstellt. Wo liegen die Hemmschwellen, wo die Probleme? Und gemeinsam mit der Fachhochschule Nordostniedersachsen werden wir versuchen etwas zur Kultur- und Stadtentwicklung zu machen.
Wie Frau Schmalriede vorhin betont hat, muss nicht alles neu entwickelt werden. Man kann auf Beispiele zurückgreifen, Erfahrungen und Ergebnisse relativ leicht für sich selbst anpassen und entwickeln. Aber es muss passieren. Dasselbe gilt für Kinder und Jugendliche. Ich würde wie Herr Franke sagen, dass es kein Sprachproblem, sondern ein Problem des Wollens ist. Mit Kindern kann man sich wunderbar unterhalten. Man spricht ja auch als Vater oder Mutter mit seinem Kind. Das Kind versteht einen auch, wenn man das will und wenn das Kind das will. Es gibt prägnante Beispiele, dass die Mitwirkung von Kindern, wenn sie ernst genommen wird, auch sehr wirtschaftlich ist. Es gibt ein schönes Beispiel aus Köln, wo ein Wohngebiet entwickelt wurde und die Kinder gefragt wurden, die Planer aber die Kinderbelange überhaupt nicht berücksichtigt haben. Der Investor fand die Beiträge der Kinder sehr wertvoll, weil sich damit die Wohnungen und das ganze Gebiet sehr viel besser vermarkten ließen als mit dem, was die Planer sich alleine ausgedacht hatten. Es wurde so gebaut, wie die Kinder es gewollt haben, und es wurde sehr gut vermarktet.
Thomas Franke
Ich denke, "Sprache wollen" ist das zentrale Thema.
Ludger Schmitz
Ich finde es nicht verwunderlich, dass die Arbeitsgruppe "Aufgabenstruktur und Qualifikation" so stark besetzt war. Wir hatten schon ein Problem. Es gab ein paar Profis, die schon seit zwei, drei Jahren im Quartiermanagement tätig sind. Und es gab welche, die überhaupt noch nicht im Rahmen des Programms arbeiten und sich informieren wollten, wie sie für sich diese Aufgabenstellung definieren können. Wir konnten denen letztendlich keine Antwort geben, weil die, die schon im Programm arbeiten, nicht ihr ganzes Lebenswerk ausbreiten konnten. Die meisten haben definitiv bei Null angefangen, entweder ganz frisch oder aus dem früheren Erfahrungsschatz heraus, weil sie aus der Altstadtsanierung kommen.
Da wir nicht immer alle bei Null anfangen sollten, steht für mich die Frage im Raum, ob es nicht z.B. über das Difu oder über wen auch immer so etwas wie eine Zusammenstellung der Städte geben sollte, die schon Quartiermanagements eingerichtet haben, die schon Erfahrungen machen, damit man sich dann eine Beschreibung aus dem Internet oder wo auch immer herholen kann, was in dem einzelnen Quartier eigentlich gemacht wird. Dann brauche ich nicht alle 30 Quartiermanager anzurufen, sondern kann auf vergleichbare Faktoren hinweisen. Dann kann ich mit entsprechenden Leute Kontakt aufnehmen. Es geht darum, für uns Strukturen zu finden, wie wir schneller miteinander kooperieren können. Deshalb sind solche Kongresse wichtig. Man nimmt sich das im Alltagsgeschäft dann jedes Mal vor. Das Wichtigste passiert hier eher in den Kaffeepausen, in denen man nämlich Leute anspricht: "Wie habt Ihr das denn jetzt eigentlich gemacht?" Um das fortzusetzen, wäre es gut, wenn wir die Adressen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen, Informationen darüber, was sie machen und wo im Einzelnen gearbeitet wird.
Thomas Franke
Daran arbeiten wir gerade in unserem Hause. Die Begleitung der Umsetzung des Programms Soziale Stadt und auch die Vorbereitung der "Programmbegleitung vor Ort" haben viel Zeit gekostet. Wir sind dabei, gute Beispiele zu sammeln und zu dokumentieren – ausgestattet mit den entsprechenden Hinweisen auf Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner. Wir entwickeln gegenwärtig eine Projektdatenbank, um Beispiele aufzunehmen und sie dann auch zur Verfügung zu stellen.
Andreas Fritsch
Es ist zur Gruppe 3 "Aktivierung" noch eine konkrete Frage gestellt worden, auf die ich kurz antworten möchte. Gefragt wurde, ob die Thematik "Neue Medien" angesprochen wurde. Es sind bei uns in der Arbeitsgruppe gute Beispiele benannt worden. In einem Fall war das Bürgerbüro in einem Stadtteil mit einem Internetcafé kombiniert, was insbesondere von den jungen Leuten sehr gut angenommen wurde. Und noch einmal zur Gruppenbesetzung: Die Nachfrage hat ja weniger etwas mit der Wertschätzung anderer Bereiche zu tun, sondern mit einer Prioritätensetzung, die man für sich vorgenommen hat. Und für mich ist die Bürgerbeteiligung das A und O.
Thomas Franke
Es dürfte im Verlauf unserer Diskussionen deutlich geworden sein, dass die Aktivierung vor Ort ganz zentral für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt ist. Da es keine weitere Wortmeldung gibt, schließe ich hiermit das Podium.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004