soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
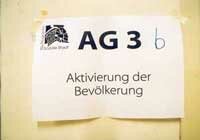
Moderator: Arnold Jung, Mannheim
Sprecher: Kurt Bader, Lüneburg
Berichterstatterin:Ulrike Meyer, Berlin
In der Diskussion wurde unterschieden zwischen Beteiligung, Aktivierung und Teilhabe, letzteres als umfassendster Form; bei allen Formen ist die Schaffung von tragfähigen Voraussetzungen für die Einbeziehung der betroffenen Menschen von größter Bedeutung. Die Aktivierung ist langfristig dort am erfolgreichsten, wo die Personen von sich aus selbst aktiv werden.
Voraussetzungen
Der eindeutige und erklärte politische Wille für die Aktivierung muss vorhanden sein; mit einer "Politik zum Anfassen" sollte auch das Abgeben von Macht und Finanzmitteln verbunden sein. Bei langen Planungs- und Umsetzungszeiträumen entstehen verschiedene Beteiligungsformen, analog dazu ist auch die Schaffung von verbindlichen politischen Strukturen erforderlich; ohne diese droht bürgerschaftliches Engagement in die Leere zu laufen. In Bezug auf die kontinuierliche Verbesserung der Lebenssituation werden Politik und Verwaltung immer in der Pflicht bleiben, umfassende Dienstleistungen sind zu erbringen. Um in den Stadtteilen zielführend aktiv werden zu können, ist eine ressortübergreifende Bestandsaufnahme erforderlich. Auf der Grundlage eines positiven Klimas und eines verbesserten Images – beides sollte in starkem Maße durch Öffentlichkeits- und Pressearbeit angestrebt werden – können allmählich dauerhafte Strukturen entstehen, die ihren Ausdruck unter anderem im Vereinsleben und in verschiedenen Interessenvertretungen finden. Diese Strukturen sollten sowohl materiell als auch ideell gestärkt und durch eine umfassende Vernetzung aller Fachkräfte unterstützt werden. Als Rückkopplung bewährt sich auch die Anerkennung von kleinen Schritten vor Ort (Wertschätzung des Ehrenamtes). Diese Notwendigkeit korrespondiert mit der Diskussion um die Bürgerkommune.
Als wichtige Grundlagen für die Erreichung der Bevölkerung werden eine kontinuierliche Präsenz von Fachleuten vor Ort sowie offene Anlaufstellen mit sehr niederschwelligen Angeboten angesehen.
Methoden
Als Dreh- und Angelpunkt verschiedener Aktivierungsformen wird die Notwendigkeit diskutiert, bei den wirklichen Problemen, Bedürfnissen und Interessenlagen der Bevölkerung anzusetzen, den Bewohnern in ihrer Lebensumwelt zu begegnen, sie an ihrem aktuellen Standort "abzuholen" und sie wirklich ernst zu nehmen. Hierbei müssen die verschiedenen "Sprachen" der Menschen gefunden werden. Die behutsame Unterstützung eigener Aktivitäten hat oberste Priorität. Um die Bewohnerschaft in den vorhandenen Fähigkeiten zu bestärken, sind verschiedene Professionen erforderlich. Dienstleistungsangebote sollten nach den Bedürfnissen entwickelt werden. Es kann nicht darum gehen, dem Stadtteil "ein neues Kleid" zu schneidern – und die Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht satt (sinngemäß zitiert nach Klaus Selle).
Die Methoden differieren stark, je nach Ebene und Gebietsgröße. Kleinräumige, zeitlich befristete Beteiligungsformen auf Projektebene z.B. bei Haus- und Wohnungsmodernisierungen oder Wohnumfeldverbesserungen werden von allen Arbeitsgruppen-Mitgliedern als relativ unproblematisch beschrieben. Mit der zügigen Sichtbarmachung von kleinen Erfolgen können die Betroffenen gut "bei der Stange gehalten" werden. Kurzfristige Motivation wird schnell erreicht. Hingegen bestehen große Unsicherheiten bei der Beteiligung an umfassenderen Entwicklungsprozessen. Der richtige Zeitpunkt der Beteiligung wird als problematisch erachtet, zumal vielerorts große Frustration über die starke Planungsdominanz herrscht. Viele Akteure sind oft vereinzelt tätig, hier sind Zusammenführungen sinnvoll, ebenso Klärungen, wo welche Potenziale für die Stadtentwicklung vorhanden sind.
In der Arbeitsgruppe werden sehr heterogene Erfahrungen berichtet, von der aktivierenden Bewohnerbefragung über Stadtteilfeste bis hin zu aktivem Spiel mit Spielzeug-Autos in einem Modell des Stadtteils, das auf der Straße aufgebaut wird. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird als sehr sinnvoll erachtet, auch wenn Kinder schnell aus ihren Lebenszusammenhängen herauswachsen oder wegziehen. Die starke Bewohnerfluktuation in den Gebieten stellt auch im Hinblick auf die Beteiligungsformen ein Problem dar.
Quartiermanagement und Bevölkerungsaktivierung
Ausführlich geht es in der Diskussion um Fragen des Sinns und der Ausgestaltung von Quartiermanagement, wobei dessen Bedeutung in Bezug auf die Aktivierung keineswegs groß eingeschätzt wird; die verschiedenen Träger, Gesellschaften, Institutionen, Vereine, politischen Gruppierungen usw. sind bei der Einbeziehung der Bevölkerung wesentlich stärker gefragt. Das Quartiermanagement kann bei der Aktivierung von Bevölkerungsteilen lediglich eine koordinierende, teilweise auch eine initiierende Rolle übernehmen.
Kritisch werden darüber hinaus folgende Aspekte beleuchtet:
- Oft wird festgestellt, dass das Quartiermanagement vom Auftraggeber abhängig ist. Die Frage, wo Quartiermanagement sinnvoll anzusiedeln sei, bleibt offen.
- Die Dokumentation der Ergebnisse des Quartiermanagements ist häufig aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses allzu positiv und geschönt.
- Solche Aktivitäten, deren Ergebnisse unklar oder deren Gefahrenpotenziale nicht abzuschätzen sind, werden vom Quartiermanagement oftmals nicht riskiert.
- Das Quartiermanagement gibt häufig für nicht zufriedenstellende Entwicklungen den Sündenbock her.
- Da jeder Stadtteil eine andere Ausgangslage hat, ist auch für jeden ein eigenes, präzise abgestimmtes Quartiermanagement erforderlich. "Rezepte" zur Ausgestaltung können nicht gegeben werden.
- In Berlin (Boxhagener Platz) sind drei Firmen mit dem Quartiermanagement beauftragt; ein solches Konstrukt führt in Teilen zu kontraproduktiven Konkurrenzen zwischen den Büros.
- Quartiermanagement benötigt einen eigenen Haushaltsansatz, um fachliches Know-how einkaufen zu können (in Berlin bereits praktiziert).
- Quartiermanagement ist primär Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bevölkerung; es kann langfristig nur effektiv arbeiten, wenn die Verwaltungsstrukturen geändert werden (Stichwort Neues Steuerungsmodell).
- Die Bezeichnung "Quartiermanager" sollte geändert werden in "Stadtteilkoordinator" oder "Stadtteilmoderator".
- In diesem hochsensiblen Bereich bewähren sich oft ABM-Kräfte nicht, da sie einerseits nicht über ausreichende Kompetenzen verfügen und andererseits keine Kontinuität in der Arbeit hergestellt werden kann.
- Der Ablauf von Förderungszeiträumen sollte von Anfang an mitbedacht werden, wenn es um die Initiierung selbsttragender Strukturen geht.
Fazit
In der Abschlussdiskussion formuliert die Arbeitsgruppe verschiedene Thesen und auch Forderungen, die sich nicht nur auf das Thema der Bewohneraktivierung beziehen:
- Die starke Trennung zwischen investiven und nichtinvestiven Maßnahmen sollte in effektiver Form aufgehoben oder flexibilisiert werden.
- Es ist nicht davon auszugehen, dass Fachkräfte in den Quartieren "auf Abruf" arbeiten, d.h. darauf hinarbeiten, sich so schnell wie möglich überflüssig zu machen, sondern dass eine Vielzahl von Dauereinrichtungen und damit festen Stellen erforderlich ist, um die Menschen in diesen Stadtteilen zu unterstützen und zu fördern.
- Der Begriff "Management" ("Quartiermanagement") ist in diesem Zusammenhang schlecht gewählt; die Menschen in den Gebieten benötigen vielmehr Unterstützung, Begleitung und auch Stärkung, aber sollten nicht "gemanagt" werden.
- In den Stadtteilen müssen solche Bedingungen geschaffen werden, dass die Menschen ihre Bedürfnisse formulieren können und zur Umsetzung befähigt werden. Die Betroffenen dürfen keineswegs "pädagogisch umgeformt" werden.
- Die formulierten Bedürfnisse werden zur Veränderung von Verwaltungsstrukturen und Dienstleitungsformen sowie zu einem neuen Dienstleistungsverständnis führen.
- Die benachteiligten Stadtteile stellen den Katalysator für die Gesamtstadt dar; generell sind für das Gemeinwesen mehr Mitgestaltungs- und bessere Mitsprachemöglichkeiten erforderlich.
- Arbeit ist das zentrale Anliegen in all den angesprochenen Gebieten. Es sollten Arbeitsplätze im Rahmen von Beteiligungsprozessen geschaffen werden, und hierfür sollten die Bewohnerinnen und Bewohner entsprechend qualifiziert werden.
- Auf Dauer werden sich die Menschen in den Stadtteilen kaum an deprimierenden, langweiligen und "trockenen" Prozessen beteiligen. Es muss wieder Spaß machen, sich zu beteiligen, Spaß machen, die Aufregung auch mal lauthals zu formulieren!
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 3b

|
Name |
Vorname |
Institution |
|
Bader |
Kurt |
Fachhochschule Nortostniedersachsen |
|
Eger |
Martina |
Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH |
|
Elsässer |
Ralf |
doppelspitze |
|
Girrbach |
Lothar |
AG West e.V. |
|
Helmling |
Margrita |
Stadt Ludwigshafen |
|
Jung |
Arnold |
Stadt Mannheim |
|
Klahuhn |
Edeltraut |
Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH |
|
Kummer |
Christoph |
LAG Soziale Brennpunkte |
|
Ludewig bei Bader |
Birte |
|
|
Meyer |
Ulrike |
Difu |
|
Miculcy |
Beate |
Arbeitsgemeinschaft für Sozialplanung und |
|
Schramm |
Gunter |
Büro Planwerk |
|
Selle |
Anke |
Hansestadt Hamburg |
|
Streck |
|
Kairos Consult |
|
Wappelhorst |
Sandra |
|
|
Wunderich |
Sabine |
Stadt Leipzig |
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004