soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
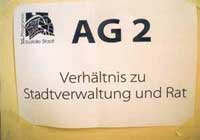
Moderator und Berichterstatter: Rolf-Peter Löhr, Berlin
Sprecher: Klaus Lindemann, Kassel
Aus der Vorstellungsrunde und Interessensbekundung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergaben sich für die weitere Diskussion zwei Rahmenthemen und vier Themenfelder, die beispielhaft aufgegriffen und von denen ausgewählte Aspekte beleuchtet wurden.
Rahmenthemen
- Aktivierung des Bürgerinteresses von unten nach oben,
- Möglichkeiten des Umgangs mit Widerstand.
Implizite und explizite Themenfelder
- Verwaltungsmodernisierung und Kooperation in der Stadtverwaltung,
- Integration von Rat und Verwaltung in die Meinungsbildung von unten nach oben,
- Fragen der Mittelverwendung im Verhältnis zwischen Verwaltung und örtlicher Bürgerschaft,
- Nutzen der Potenziale im Stadtteil zugunsten des Quartiers wie der ganzen Stadt.
Beispiel Verfügungsfonds Exempel für das Verhältnis von Rat und Verwaltung zur Bürgerschaft
Als besonders illustrativ für das Verhältnis von Rat und Verwaltung zur Bürgerschaft können die Einrichtung und Verwendung von Verfügungsfonds angesehen werden. Allgemein bestand in der Diskussion Einigkeit darüber, dass es zur Aktivierung der Bevölkerung und zur Initiierung eines Selbstorganisationsprozesses notwendig sei, mit schnellen Entscheidungen kleine Maßnahmen zu finanzieren, ohne dabei mittel- und langfristige Ziele zu vernachlässigen. Die herkömmlichen bürokratischen und politischen Entscheidungswege seien dafür in der Regel zu lang. Einem Verfügungsfonds wurde daher große Bedeutung beigemessen.
Es wurde argumentiert, mit Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit könne die Verwaltung all jene Aufgaben bewältigen, für die auch ein Verfügungsfonds infrage komme. Dem wurde entgegengehalten, dass es gerade darauf ankomme, die Bürgerschaft selbst entscheiden zu lassen und somit nach und nach an die Mitverantwortung für ihren Stadtteil heranzuführen. Es handele sich um eine Frage der Machtabgabe seitens der Verwaltung, was gerade besonders engagierten und innovativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung nicht immer leicht falle. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass die Vergabe von Mitteln für kleinere Projekte ein wichtiges Instrument für Lokalpolitiker zu deren Profilierung sei. Dies sei bei der Einrichtung von Verfügungsfonds nicht mehr gewährleistet. Dem wurde entgegengehalten, dass dies zwar zutreffe, es aber gerade deshalb darauf ankomme, die Politik als Partner zu gewinnen und nicht als Gegner anzusehen. Dann würden sich neue Profilierungsmöglichkeiten ergeben.
Aspekte einer partizipativen Organisationsstruktur
Durch diese Diskussion wurde deutlich: Der sinnvolle Einsatz eines Verfügungsfonds setzt eine Organisationsstruktur voraus, die gleichermaßen die Mitwirkung mehrerer Akteursgruppen ermöglicht, die der Bürgerschaft wie jene von Vereinen und Verbänden, die von lokaler, insbesondere quartiersbezogener Politik wie jene von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Es wurde Einigkeit erzielt, dass eine solche Organisationsstruktur mindestens aus zwei Elementen bestehen muss, nämlich einem Bürgerforum, in dem prinzipiell alle Bürgerinnen und Bürger mitwirken können, sowie einer Lenkungsgruppe, in die das Bürgerforum, Vereine und Verbände sowie Politik und Verwaltung Mitglieder entsenden. Obwohl nicht direkt Thema dieser Arbeitsgruppe, bestand Einigkeit, dass die Wohnungswirtschaft ebenso wie die lokale Wirtschaft in diese Gremien in besonderer Weise einbezogen werden müssen.
Während das Bürgerforum eine Diskussionsplattform darstellt, die projektbezogen Anregungen und Vorschläge unterbreitet, diskutiert die Lenkungsgruppe entscheidungsorientiert. Deren Empfehlungen richten sich unmittelbar an den Bezirk oder den Stadtrat, wobei davon ausgegangen wird, dass die Politik im Regelfall den Empfehlungen der Lenkungsgruppe Folge leisten wird. Als wichtig wurde angesehen, parallel zur Lenkungsgruppe in der Verwaltung eine Projektgruppe zu installieren, die von einem oder einer Gebietsbeauftragten für das jeweilige Quartier verantwortlich geleitet wird. So kann die Transparenz der Verwaltung gesichert werden und zugleich das Programm Soziale Stadt an Verbindlichkeit für die Verwaltung gewinnen. Überdies ließe sich auf diese Weise die von der Verwaltungsmodernisierung geforderte Bürgernähe deutlich verbessern. Gleichwohl solle der Verwaltung in diesen Gremien nur eine beratende Funktion zukommen.
Entscheidend für die Funktionsfähigkeit dieser Struktur ist, dass sie auf der Basis eines integrierten Entwicklungskonzepts und eines Rahmens für die Entscheidungskompetenzen, beides vom Rat beschlossen, tätig wird. Um rasche Entscheidungen zu ermöglichen und Verfahrensklarheit zu gewinnen, erschien es allen Teilnehmenden sinnvoll, für diese Gremien Geschäftsordnungen zu erlassen, die das Procedere bei Konflikten regeln.
Das Quartiermanagement wurde dabei als besonders wichtig für die Aktivierung der Bürger, für die Identifizierung und Initiierung von Projekten und für den ständigen Kontakt zu Politik und Verwaltung angesehen. Dabei sei es unerlässlich, dass das Quartiermanagement auf gleicher Augenhöhe wie die Verwaltung agiere es dürfe folgerichtig nicht weisungsabhängig sein. Nötig sei vielmehr eine Zielvorgabe, in deren Rahmen sich das Quartiermanagement frei bewegen könne. Das Quartiermanagement müsse sowohl im Bürgerforum als auch im Lenkungsgremium mit Sitz und Stimme vertreten sein.
Fazit
Auf der Basis der diskutierten partizipativen Organisationsstruktur könne es gelingen, die Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung in ihrem Quartier zu interessieren, weil sie sich ernst genommen fühlten und wichtige Partner von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden seien.
Man war sich einig, dass eine solche Struktur, angepasst an die jeweiligen örtlichen Bedingungen und Bedürfnisse, nicht nur in Gebieten der Sozialen Stadt, sondern in allen Teilen der Stadt sinnvoll sei und auch ohne zusätzliche Finanzierung ein wichtiges Element zur Unterstützung und Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung sein könne.
Wenn Politik und Verwaltung sehr frühzeitig in die Entscheidungsfindung mit einbezogen würden, entstünden auch keine Parallelstrukturen, sondern Mitbestimmungsstrukturen im Schatten der Hierarchie von Rat und Bezirkvertretung, sodass die Politik zwar zum einen Macht abgebe, zum anderen aber Einfluss durch den unmittelbaren Kontakt mit der Bürgerschaft und der Wirtschaft gewinne. Widerstände gegen solche Strukturen und Prozesse könnten auf diese Weise minimiert und Vorurteile gegenüber der Verwaltung wie gegenüber der Politik abgebaut werden. Der Einsatz von Mitteln aus Verfügungsfonds sei in diesem Zusammenhang nur einer von mehreren wichtigen Handlungsansätzen.
Auf diese Weise, so das Resümee zum Schluss, ließen sich die Potenziale eines Stadtteils für das Quartier nutzbringend einsetzen und könnte eine positive Entwicklung für das Quartier wie für die gesamte Stadt eingeleitet oder unterstützt werden.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 2

|
Name |
Vorname |
Institution |
|
Bartel |
Frank |
Ministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr |
|
Braun |
Michael |
|
|
Bruns |
Peter |
Stadt Emden |
|
Engler |
Jörn |
Magistrat der Kreisstadt Eschwege |
|
Fechner |
Bernhard |
Stadt Zittau |
|
Grandt |
Brigitte |
Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH |
|
Hartmann |
Günter |
Städtische Sanierungsgesellschaft Sangerhausen mbH |
|
Heimann |
Ulli |
Stadt Saarbrücken |
|
Hippe |
Hannelore |
Stadt Lu.-Wittenberg |
|
Lindemann |
Klaus |
Arbeitskreis Bündnis für Waldauer Kinder und Jugendliche, Kassel |
|
Lindenblatt |
Heike |
Stadt Dortmund |
|
Löhr |
Rolf-Peter |
Deutsches Institut für Urbanistik |
|
Lübbers |
Christian |
Stadt Stade |
|
Matzke |
Peter |
Stadt Wetzlar |
|
Maxara |
Karin |
Stadt Gera |
|
Ritter |
Susanne |
Landeshauptstadt München |
|
Schneider |
Heide |
|
|
Schultes |
Jutta |
Stadt Wuppertal |
|
Tropschuh |
Inge |
Stadt Ingolstadt |
|
Vieweg |
Andreas |
Stadt Northeim |
|
Witte |
Torsten |
Büro für Freiraumplanung und Kommunikation |
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004