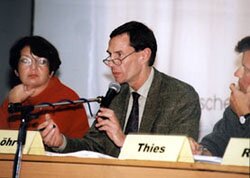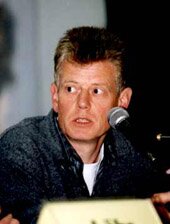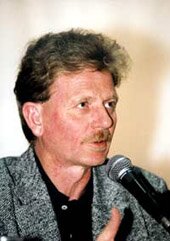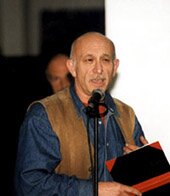soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Quartier, Stadt, Land
Erfahrungen mit dem Quartiermanagement
Podiums- und Plenumsdiskussion
Moderation:
Dr. Rolf-Peter Löhr,
Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
Auf dem Podium:Karsten Gerkens, Brigitte Grandt, Klaus-Jürgen Holland, Karl Jasper, Wolfgang Krumm, Susanne Ritter, Reinhard Thies, |

Rolf-Peter Löhr, Deutsches Institut für Urbanistik, BerlinGuten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch im Namen der Projektgruppe Soziale Stadt des Deutschen Instituts für Urbanistik sehr herzlich hier in Leipzig begrüßen. Unser Tagungsort das Werk II war bis zur Wende die Produktionsstätte von Maschinen zur Prüfung von Werkzeugen. Das Werk I produziert noch weiter, aber das Werk II steht heutzutage für kulturelle und andere Veranstaltungen zur Verfügung. Und wir nutzen es heute, um ein Werkzeug zu prüfen, das für die Umsetzung des Programms Soziale Stadt eine zentrale Bedeutung hat. |
|
Wenn Sie in der Ausstellung die Graphik zum Programm gesehen haben, die wir für den Weltstädtebaukongress Urban 21 erarbeitet haben, dann ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass das Quartiermanagement das Zentrum oder man könnte auch sagen die Basis dieses Programms darstellt und deswegen ein großer Teil von dessen Umsetzung auf dem Quartiermanagement lastet. Das Quartiermanagement kann deswegen nur funktionieren, wenn es von der Bevölkerung getragen und auch von der Stadt, vom Land und vom Bund unterstützt wird: durch die Bereitstellung von Mitteln, durch das Einbringen von Know-how, durch die Unterstützung in vielen Fragen. All das soll Gegenstand dieses Kongresses sein.
Mit diesem Eröffnungspodium sollen Aufgaben und Möglichkeiten dargestellt werden, die für das Quartiermanagement von besonderer Bedeutung sind. Und da mit dem Programm Soziale Stadt quasi ein partizipatorischer Paradigmenwechsel vollzogen wird, soll hier eine Entwicklung von unten nach oben und nicht von oben nach unten erfolgen. So wollen wir auf diesem Podium auch mit der Quartiersebene beginnen.
Deswegen stelle ich Ihnen als erste Frau Grandt von der Entwicklungsgesellschaft in Duisburg vor, die sich mit dem Programm Soziale Stadt in Duisburg und dort im Stadtteil Marxloh beschäftigt. Welche Probleme gibt es aus Ihrer Sicht, ein Quartiermanagement in einem Gebiet zu installieren? Es handelt sich ja in der Regel um Gebiete, in denen bereits Aktivitäten stattfinden, Initiativen und Einrichtungen vorhanden sind, und jetzt kommt noch ein Quartiermanagement dazu. Das kann durchaus zu Irritationen führen. Wie lässt sich das Quartiermanagement einbinden?
|
|
Brigitte Grandt, Entwicklungsgesellschaft DuisburgEntscheidend für das Funktionieren des Quartiermanagements sind zwei Voraussetzungen: erstens die Beteiligung des Ortsteils und zweitens der politische Wille der Stadt. Die lokalen Akteure und Gegebenheiten sollten schon bei der Planung einbezogen werden. Bewohnergruppen, Vereine, Verbände, Institutionen, Wohnungsgesellschaften, Teile der Verwaltung und des Arbeitsamtes, Ortsteilpolitik und viele andere sind Kenner der lokalen Situation. Ihre Meinungen und Vorstellungen müssen Grundlage der Planung sein. |
Deshalb möchte ich für die Ebene des Ortsteils fünf wichtige Grundsätze nennen:
- Die Einrichtung eines Quartiermanagements sollte im Ortsteil gewollt, besser aus dem Ortsteil heraus gefordert werden. Das Quartiermanagement sollte so etwas wie eine Aufbruchstimmung erzeugen: Endlich tut sich etwas in unserem Stadtteil.
- Dies gelingt meiner Ansicht nach nur, wenn alle Akteure im Quartier frühzeitig einge-bunden werden.
- Die Akteure sollten weitestgehend bei der Aufgabengestaltung des Quartiermanagements mitarbeiten. Handlungsziele und Ansätze sollten auch auf Quartierebene abgestimmt sein.
- Es sollte geprüft werden, ob nicht schon vorhandene Akteure vor Ort die Aufgabe des Quartiermanagements übernehmen könnten. Dies würde die Nachhaltigkeit der Maßnahmen langfristig eher garantieren.
- Die Personen, die im Quartiermanagement arbeiten, sollten über gute lokale Kenntnisse verfügen, ebenso über die Kompetenz, insbesondere mit den besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen, die oft über kein Sprachrohr verfügen, zusammenzuarbeiten.
Den Grundsätzen für den Ortsteil entsprechen fünf Grundsätze für Verwaltung und Politik:
- Das Quartiermanagement sollte von Verwaltung und Politik wirklich gewollt sein. Nur so ist eine erfolgreiche Arbeit möglich.
- Das Quartiermanagement sollte von Verwaltung und Politik als Chance gesehen werden, die Probleme und Potenziale eines Stadtteils besser zu erfassen und somit zielgerichteter und wirkungsvoller handeln zu können.
- Politik und Verwaltung sollten bereit sein, Kompetenzen abzugeben, um eine wirkliche Beteiligung aller lokalen Akteure zu gewährleisten. Sie sollten sich auf ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die der Steuerung und Kontrolle der Arbeit, zurückziehen und weitestgehende Entscheidungskompetenzen an die Stadtteilebene delegieren.
- Das bedeutet beispielsweise auch die Bereitstellung eines Fonds zur eigenverantwortlichen Verfügung der Ortsteilakteure. Dieser ist für das Quartiermanagement besonders wichtig, weil er ermöglicht, kleinere, aus dem Ortsteil geforderte Maßnahmen unmittelbar umzusetzen. Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass sich hier etwas tut; der Fonds ist ein Grundelement zur Aktivierung der Bevölkerung.
- Die genannten Grundsätze sind für das Funktionieren des Quartiermanagements unabdingbare Voraussetzungen. Sie zu erfüllen, kann ein langwieriger Prozess werden. Konflikte sind dabei vorprogrammiert. Zum Quartiermanagement gehört daher auch eine offene und konstruktive Streitkultur.
Rolf-Peter Löhr
Wir wollen auf dem Podium zunächst einmal das Spektrum der verschiedenen Positionen darlegen. Und deswegen begrüße ich jetzt Herrn Thies, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen, der darüber hinaus über reichhaltige Erfahrung mit Gemeinwesenarbeit in Gießen verfügt. Das Leitprogramm für das Programm Soziale Stadt ist die Städtebauförderung und die ist bei den Städtebauern und Stadtplanern angesiedelt. Nun bildet die Kooperation zwischen Städtebauern und Sozialarbeitern nicht unbedingt das Zentrum der bisherigen Arbeit von Städtebauern und Sozialarbeitern. Wie wird denn die soziale Seite in dieses Programm einbezogen und welchen Beitrag kann sie dazu leisten?
|
|
Reinhard Thies, LAG Soziale Brennpunkte HessenEs gibt tatsächlich nur wenig Tradition in der Zusammenarbeit zwischen sozialen und städtebaulichen Akteuren. Das gilt für alle Ebenen: auch im Sozialbereich, im öffentlichen Bereich, bei den Sozial- und Jugendministerien, den sozialen Trägern, der Wohlfahrtspflege auf Bundes- sowie auch auf der Landesebene. Deshalb ist es ein wichtiges Ziel, dass der soziale und der städtebauliche Bereich als zentrale Achsen zusammenfinden. |
Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass neben der öffentlichen Verwaltung die wirtschaftlichen, einschließlich der wohnungswirtschaftlichen Akteure insbesondere mit den freien Trägern den Nicht-Regierungs-Organisationen und mit den Verbänden zusammenkommen. Darin liegt ein wichtiger Ansatz für Kooperation; und das muss auf allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden und Stadtteil) stattfinden. Wir haben in Hessen diese Erfahrung gemacht; deshalb wurde die Arbeitsgemeinschaft Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS) gegründet, in der sich alle Akteure auf Landesebene treffen.
Auf der lokalen Ebene, in Gießen, wurde ein Trägerverbund gebildet; sowohl die Träger der Sozialarbeit, der Jugendhilfe, der Beschäftigungs- und der Ausbildungsqualifizierungsförderung als auch die Wohnungsunternehmen und die Stadt gründen einen Verein, und die Akteure im Quartier, in der Nordstadt, fungieren dann als Träger des Quartiermanagements. Das setzt natürlich voraus Frau Grandt hat dies schon angesprochen , dass integrierte Ansätze und Kooperation in der Verwaltung gewollt sind.
Darüber hinaus hat man sich in Gießen entschieden, zur Einbindung von Politik und Bevölkerung einen Stadtteilbeirat zu installieren, an dem sich sowohl die Fraktionen des Stadtparlaments als auch sechs Delegierte der Quartiersbevölkerung beteiligen. Es erscheint uns wichtig, dass es Foren und konkrete Angebote gibt, an denen sich Bevölkerung und Akteure beteiligen können.
Wer nun soll als Quartiermanager agieren? Wir plädieren dafür, dass ein Tandem eingesetzt wird: möglichst ein Stadterneuerer in einer Planungsbeauftragtenrolle und ein Sozialakteur im Sinne eines Gemeinwesenbeauftragten. Besonderen Wert lege ich darauf, dass der Gemeinwesenbeauftragte im subsidiären Bereich sprich bei den freien Trägern angesiedelt wird, damit er sich gegenüber dem Quartier sowie den dort aktiven Gruppen und Bürgerinitiativen loyal verhalten kann und sich nicht aus Loyalität zur Verwaltung und zur Wohnungswirtschaft anders darstellen muss. Das Tandem macht gleichzeitig deutlich, dass ein Kooperationsansatz erarbeitet und eingeübt werden muss. Wir finden deshalb, dass in diesem Bereich gezielte Qualifikation notwendig ist, dauerhafter Erfahrungsaustausch organisiert werden muss sowohl auf der lokalen als auch auf der Landesebene und, wie hier, auch auf der Bundesebene.
Rolf-Peter Löhr
Quartiermanagement funktioniert nur, wenn auch die Bürger und Bürgerinnen mitwirken. Wie kann man denn die Bürgerschaft aktivieren, sie in die Entscheidungsprozesse einbeziehen? Welche Handlungsansätze, welche Chancen gibt es dafür? Dazu bitte ich Herrn Holland um das Wort. Er ist Gebietsbeauftragter für ein Quartier in Hannover-Vahrenheide, in dem die Prinzipien der Sozialen Stadt angewendet werden, das aber noch nicht Programmgebiet ist, und er hat schon lange Erfahrung als Anwaltsplaner in Sanierungsgebieten.
|
|
Klaus-Jürgen Holland, Sanierungsbüro Hannover Vahrenheide-OstLassen Sie mich die Antwort auf drei Möglichkeiten zur Aktivierung beschränken; außerdem eine etwas pragmatische Eingrenzung: Erstens, die Übergänge sind fließend, und zweitens, die Entfaltungsformen sind sehr zahlreich. Die erste Möglichkeit ist unsere klassische Möglichkeit der Beteiligung die wir bereits seit mehr als 20 Jahren praktizieren über Foren, Initiativen, Runde Tische. Diese eher mittelschichtspezifische Form des Stadtteildiskurses funktioniert nur, wenn eine Diskursbasis im Stadtteil vorhanden ist, in der Regel durch Vereinsarbeit und kleinteilige Arbeit von politischen Parteien angelegt. |
Diese Voraussetzung finden wir in der Mehrzahl der Gebiete im Programm Soziale Stadt hinsichtlich der Bevölkerungsstrukturen nicht vor. Deswegen ist die Reichweite dieses Ansatzes auch relativ gering. Wenn dieses Instrument funktionieren würde, wären die Stadtteile nicht das, was sie sind. In den Quartieren, in denen es entsprechende Ansätze gibt, lässt sich die Arbeit auch fördern und stabilisieren. Zum einen müssen Sie Planungsressourcen zur Verfügung stellen. Zum anderen braucht die Arbeit von Bürgerforen, um wirksam zu sein, eine Antwort im politischen Raum. Sie müssen Zugang zu lokalen politischen Gremien haben, um dort eine direkte Auseinandersetzung führen zu können.
Die zweite, völlig andere Möglichkeit bedeutet, die Bewohner eines Quartiers in ihrer Alltagssituation dort abzuholen, wo sie ihre alltäglichen Probleme haben; diese werden dann ganz besonders deutlich, wenn z.B. Wohnungsmodernisierungen anstehen oder die Reorganisation des wohnungsnahen Umfelds. Da können Sie eine unmittelbare Beteiligung direkt an den Vor- und Nachteilen der Maßnahmen für den Stadtteil orientieren. Das setzt eine frühzeitige Beteiligung voraus, also nicht erst, wenn die Pläne fertig sind. Es setzt weiter eine intensive, auch begleitende Betreuung voraus. Eine dritte Voraussetzung ist die Integration der Wohnungsunternehmen in das Quartiermanagement, damit Sie überhaupt Zugang zu und Steuerungsmöglichkeiten über diese Ressourcen bekommen. Ein Vorteil dieser Ansätze das zeigen Erfahrungen besteht darin, dass dabei Grundlagen für weiterführende Beteiligungsformen geschaffen werden, etwa die Überführung von Beteiligungen an solchen hausnahen Ereignissen in längerfristige Mieterselbstorganisation.
Die dritte, nach meiner Meinung in ihrer Wirkung sozial nachhaltigste Möglichkeit ist die, Bewohner zu Akteuren im Quartier zu machen, ihnen die Möglichkeit zu geben, Aufgaben in bürgerschaftlicher Selbstorganisation wahrzunehmen, in der Regel in Vereinsform. Sie müssen dazu natürlich die Ressourcen zur Verfügung stellen, das heißt, Sie müssen erstens die Ressourcen innerhalb der Verwaltung umverteilen. Um so vorzugehen, braucht man zweitens einen wesentlich über den Investitionshaushalt hinausreichenden Haushalt in der Regel ist dies bei Sanierungsmaßnahmen der Fall nicht nur während der Sanierungsdurchführung, sondern vor allem auch nach der Sanierung. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie solche Formen der bürgerschaftlichen Selbstorganisation nutzen wollen, entsprechende Mittel langfristig in den Haushalt der Kommune einstellen.
Rolf-Peter Löhr
Was von allen, auch von der Quartiersebene, betont wurde, ist der politische Wille. Damit verbunden ist auch eine gewisse Machtabgabe, eine Machtverlagerung auf die Quartiersebene, auf die Bürger. Das ist sicher ein nicht ganz einfacher Prozess. Daneben muss aber auch auf der Verwaltungsseite etwas passieren. Die Lösung des Problems kann nicht allein in der Installierung eines Quartiermanagements bestehen, das dann die Probleme löst. Was macht die Stadt? Frau Ritter, wie sieht es in München aus?
Susanne Ritter, Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt MünchenDer organisatorische Aufwand durch die Installierung des Programms sollte vor allem auch im Hinblick auf den möglicherweise ja befristeten Einsatz des Programms so gering wie möglich gehalten werden. Allerdings sind neue Strukturen erforderlich. Das ist auch bei uns so. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick dazu geben, wie wir die Organisation verwaltungsintern in den Stadtteilen installiert haben und wie dabei die Politik eingebunden wurde. Bei alledem müssen selbstverständlich die Spielregeln, mit denen die Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen agieren, klar und für alle durchsichtig sein, weil sonst Mitwirkung und Ehrenamt nicht abzuverlangen sind. |
|
Wir haben zunächst die Politik eingebunden, indem wir ein Umsetzungskonzept im Stadtrat beschlossen haben; dieses Umsetzungskonzept hat auch schon die gesamte Organisationsstruktur beinhaltet. Wir betreiben dieses Programm in München gemeinsam mit vier Referaten, die sich in einer Lenkungsgruppe zusammengefunden haben und gemeinsam entscheiden. Die Projektsteuerung des Programms liegt in den Händen dieser Lenkungsgruppe, die eine eigene Geschäftsordnung hat. Das Planungsreferat übernimmt dabei die Geschäftsführung. Die Bauverwaltung hat also nicht das Sagen, sondern wir sind ein Teil dieser Gruppe. Sie setzt sich insgesamt aus den Disziplinen Arbeit, Wirtschaft, Gesundheit, Umwelt und Soziales sowie Stadtentwicklungsplanung und Stadtsanierung zusammen. Die Lenkungsgruppe hat die Möglichkeit, jeweils Fachleute anderer Referate, Externe, aber auch die Politik projektbezogen zuzuladen. Ansonsten agiert sie verwaltungsintern.
Für uns war weiter klar, dass auf Stadtteilebene feste Gremien nötig sind, in denen die Multiplikatoren zusammengebunden werden. Wir haben solche Gremien in zwei Sanierungsgebieten installiert. Diese Gremien nennen sich Koordinierungsgruppen; sie setzen sich aus Multiplikatoren der Verwaltung sowie der Politik zusammen und beziehen die Stadtteilpolitik mit ein. Beide Gruppen arbeiten bereits mit großem Engagement. Ihnen wird jetzt quasi als Unterstützung das Quartiermanagement zur Seite gestellt. Natürlich gab es auch bei uns viele Diskussionen über die Installierung dieses Quartiermanagements auch im politischen Raum, sodass diese Vorgehensweise im Stadtteil sehr gut angekommen ist. Wir haben die Quartiermanager auch gemeinsam ausgewählt. Es war für uns klar, dass wir dem Stadtteil keine Quartierskoordinatoren präsentieren, sondern dass der Stadtteil gemeinsam mit dieser Lenkungsgruppe die Vertreter des Stadtteils auswählen soll.
Wir knüpfen damit ein Stück weit an Traditionen der Stadtsanierung in München an. Schon immer haben wir das Soziale eng mit dem Baulichen vernetzt. Diese Politik erfährt also eine formelle Einbindung; aber auch auf informeller Ebene wird bei uns in Form von Veranstaltungen, Gesprächen, Dialogen mit der städtischen und der örtlichen Politik relativ viel getan.
Insgesamt konnten wir durch diese Dialogbereitschaft auf allen Ebenen das Programm Soziale Stadt gut installieren. Vor allem sind wir auf eine enorme Mitwirkungsbereitschaft in den Stadtteilen gestoßen, die wir wiederum mit der Bereitstellung eines Verfügungsfonds aufgreifen und mit dem wir in gewisser Weise auch etwas zurückgeben können. Die Koordinierungsgruppe befindet über Projekte, die aus dem Verfügungsfonds bezahlt werden. Das funktioniert bisher auch ganz gut.
Rolf-Peter Löhr
Sie haben besonders diese Wechselseitigkeit des Prozesses hervorgehoben: die Dialogbereitschaft auf Seiten der Stadt und die Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerschaft. Und hier können Sie mit dem Verfügungsfonds etwas zurückgeben. Deutlich war auch die recht tiefgehende Umstrukturierung in der Verwaltung und dies mit geringerem organisatorischen Aufwand. Aber es muss sicher noch ein bisschen mehr passieren selbst bei der längeren Tradition der Münchener Bürgerbeteiligung. Diese Tradition haben mehrere Städte. Worum es jetzt aber auch geht, ist, neben der Entwicklung solcher organisatorischen Strukturen auch eine inhaltliche Vorgabe für das Quartiermanagement und für die übrige Stadtverwaltung zu liefern. Das Programm setzt die Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzepts voraus. Herr Bürgermeister Tschense hat bereits auf den Leipziger Stadtentwicklungsplan Wohnbauflächen hingewiesen, dazu Herr Gerkens.
Karsten Gerkens, Amt für Stadtsanierung und Wohnungsbauförderung der Stadt LeipzigMich bewegt die ganze Zeit die Frage: Worüber reden wir, was soll bewegt werden? Ich habe den Eindruck, dass wir zum Teil über ganz unterschiedliche Dinge reden. In Leipzig haben wir eine Situation mit 60 000 leeren Wohnungen; wir befürchten die ersten Konkurse von Wohnungsunternehmen. Wir müssen einfach etwas tun. Uns ist die Bevölkerung, der Arbeit folgend, davongelaufen, vielleicht in den Westen, aber auch in das Stadtumland, weil dort einiges attraktiver war. Hier geht es wirklich darum, eine Stadtstruktur zukunftsfähig und marktfähig zu machen. Im Grunde geht es auch darum, sich auf den Kundenwunsch einzustellen, denn wir haben Probleme in den Bereichen mit hoher Dichte und wenig Grün; dort haben wir keine Möglichkeit, individuelle Wohnformen anzubieten. Innerhalb dieser Bereiche müssen wir etwas tun. |
|
Unser Programmgebiet für Soziale Stadt umfasst knapp 200 Hektar. Hier wollen wir mit dieser Ressource und dem Einsatz von Städtebaufördermitteln versuchen, einen Stadtteil umzudrehen. Ansonsten hat dieser Stadtteil keine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Entweder gelingt es uns, dieses Quartier so umzustrukturieren, dass die Bürger diesen Stadtteil wieder akzeptieren, oder wir können es eigentlich lassen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Aufgaben ein Quartiermanagement hat.
Wir haben uns darauf verständigt, den Quartiermanager Stadtteilmoderator zu nennen, weil es nicht um ein Quartier oder um einen Block geht, sondern um ein großes Gebiet. Wir können diesen Mann oder diese Frau nicht mit den immensen Aufgaben allein lassen, sondern wir müssen versuchen, ihnen Hilfestellung zu geben. Die Verwaltung muss in vielen Bereichen ihre Hausaufgaben erst noch machen. Wir haben das eigenartige Prinzip, dass die Verwaltung anders funktioniert als der Rest der Welt. Ein Großteil der Aufgaben des Quartiermanagements liegt nicht direkt in der Sache, sondern darin, die Probleme eines untauglichen Systems zu beseitigen.
Der Quartiermanager wird sicher völlig überfordert, wenn wir nicht in den Ämter- oder Koordinierungsrunden versuchen, die Probleme zu lösen. Diese Lösungen müssen allerdings aus unserer Sicht sehr weit oben angesiedelt werden; sie stehen in direkter Verbindung zu Fragen der Verwaltungsmodernisierung und der Haushaltskonsolidierung. Wenn das alles funktioniert, dann hat der Quartiermanager bei den Projekten, die wir hier vor uns haben, eine Chance.
Ich sage dies deshalb hier so deutlich, weil wir in der Arbeitsgruppe Sächsische Städte zum Programm Soziale Stadt Projekte besprechen, bei denen es sich im Wesentlichen um Stadtumbauprojekte handelt. Die Größenordnung unseres Leipziger Gebietes haben andere Städte auch. Das heißt, hier wird mit dem Programm der Strukturwandel und Strukturumbruch in Ostdeutschland bearbeitet. Das ist als Anregung auch für die morgigen Arbeitsgruppen gedacht, damit wir hier nicht auseinander gehen und völlig aneinander vorbeigeredet haben. Ich finde wichtig, dass man sich über diese Dimension verständigt.
Rolf-Peter Löhr
Mich würde doch noch ein Wort zu dem integrierten Handlungskonzept interessieren. Da haben Sie doch einen Plan erarbeitet. Wie ist der entwickelt worden?
Karsten Gerkens
Das integrierte Handlungskonzept ist natürlich mit den Akteuren im Stadtteil abgestimmt worden. Wir haben dieses Konzept in Verbindung mit unterschiedlichen Bereichen aufgestellt nicht nur mit dem Baubereich und dem Sozialbereich, auch mit Beschäftigungsprogrammen und Ähnlichem. Daraus entsteht natürlich wieder die Notwendigkeit der Zusammenführung zur Weiterentwicklung dieses integrierten Handlungskonzepts. Wir haben festgestellt, dass das erst ein Anfang war und dass nun viele weitere Projekte dazukommen. Der Charme des Programms Soziale Stadt besteht vielleicht darin, dass es nicht mit einer fertigen Konzeption beginnt, sondern in seinem Verlauf wesentlich weiterentwickelt wird. Wir haben die Hoffnung, dass die Finanzmittel, die zunächst relativ knapp scheinen, gar nicht der entscheidende Punkt sind, sondern dass viele Ressourcenbündelungen dazukommen können. Es geht z.B. um die Projektkoordination Arbeit. Wir haben zig Projekte, bei denen es um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) geht. Wir brauchen dringend die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt. Das integrierte Handlungskonzept ist nötig, um zu wissen, wo man startet; aber wir müssen die Fortschreibung dieses Konzepts im Auge behalten, denn es gibt hier keinen Stillstand, sondern viel Dynamik.
Rolf-Peter Löhr
Es ist wichtig, dass wir bei diesem Programm nicht davon ausgehen, wir wüssten schon, wie es geht, und es bloß noch umgesetzt werden muss, sondern es setzt für alle, auch für die Bürgerinnen und Bürger, sehr viel voraus. Diese grundlegenden Änderungen bisheriger Verhaltensgewohnheiten sind besonders wichtig. Wir bekommen die Quartiere nicht richtig in Schuss, wenn die Verwaltung nicht selber in Schuss ist. Da kommt dann auch das Thema auf, wie wir mit den vorhandenen Ressourcen effektiver umgehen können. Dafür spielt die Bündelung, ein wichtiger Handlungsansatz im Programm, eine ganz große Rolle. Bund und Länder bündeln ihre Mittel auf ihren jeweiligen Ebenen, heißt es dazu im Programm ganz lapidar dazu Herr Krumm, der im Land Berlin auf der Senatsebene im Referat Soziale Stadt tätig ist.
Wolfgang Krumm, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, BerlinAls Stadtstaat hat Berlin sowohl die ministerielle Aufgabe, für das Programm Soziale Stadt die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, als auch die eher kommunale Aufgabe, das Programm in enger Abstimmung mit den jeweiligen Bezirksverwaltungen konkret umzusetzen. Zunächst einige grundsätzliche Vorbemerkungen zu den Möglichkeiten der Mittelbündelung aus Landessicht: |
|
- Die Problemlagen in benachteiligten Stadtquartieren, so wie sie sich in den jeweiligen Politik- bzw. Handlungsfeldern darstellen, sind nicht neu; sie kulminieren jedoch in einigen Gebieten aufgrund der dort vorhandenen vielschichtigen Problemüberlagerungen.
- Daher reichen die in den verschiedenen Handlungsfeldern bestehenden Förderstrukturen und -programme (z.B. in den Bereichen Beschäftigung und Qualifizierung, Soziales, Kinder- und Jugendhilfe, öffentlicher Raum, Bauen und Wohnen) nicht mehr aus, um die Stabilisierung und Aufwertung dieser besonders belasteten Stadtquartiere sicherzustellen. Integrative, aber auch ergänzende Programme sind erforderlich, um die komplexen Probleme nachhaltig anzugehen.
- Zweierlei ist daher insbesondere vor dem Hintergrund der vorgegebenen Sparhaushalte zu tun: Zum einen sind die in allen Fachressorts bisher bereits bestehenden Programme dahingehend zu durchforsten, ob und inwieweit sie prioritär oder mit zusätzlicher lokaler Komponente in besonders belasteten Stadtquartieren zum Einsatz gebracht werden können. Zum anderen sind ergänzende, zusätzliche Ressourcen und Mittel zu mobilisieren sowohl zusätzliche Förderprogramme z.B. der EU oder des Bundes als auch zusätzliche Ressourcen in Form von Mobilisierung vorhandener Selbsthilfekräfte, Eigeninitiative, ehrenamtlicher Mithilfe sowie zusätzliche Mittel und Ressourcenbereitstellung von Dritten.
An dieser Stelle möchte ich den Gesichtspunkt der Mittelbündelung noch um zwei weitere Aspekte erweitern: Es geht neben der additiven Bündelung von vorhandenen Programmen auch noch um den Aspekt der Verstärkung sowie den der Verknüpfung bzw. Vernetzung vorhandener Programme.
Ausgangspunkt ist das Programm Soziale Stadt, das auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung zwischen Bund und Ländern zu einem Drittel vom Bund und von Berlin als Stadtstaat zu zwei Dritteln komplementär finanziert wird. In anderen Bundesländern fallen bezüglich der Anteilsfinanzierung ein Drittel auf das Land und ein Drittel auf die Kommune. Neben investiven Maßnahmen im baulich-räumlichen Bereich lassen sich mit diesem Programm auch aktivierende Beteiligungsverfahren sowie Projekte in den verschiedenen Handlungsfeldern zur Stabilisierung und Aufwertung der Stadtquartiere finanzieren. Aufgrund dieses breiten Maßnahmespektrums wirkt es als das zentrale integrierte Stadtteilförderprogramm. Hier setzt nun das Bemühen ein, Mittel bzw. Förderprogramme so zu bündeln, dass nachhaltige Effekte zur Stabilisierung und Aufwertung der benachteiligten Gebiete erzielt werden können.
Bei einer additiven Strategie sollten zunächst alle bereits bestehenden Förderprogramme aus den unterschiedlichen Fachressorts zur Problembewältigung herangezogen werden. Dazu müssen als erstes die infrage kommenden Programme zusammengestellt, bezüglich ihrer Einsatzbreite beschrieben und den Quartiermanagern an die Hand gegeben werden.
Nicht alle bestehenden Programme können aufgrund ihrer Programmsystematik für eine gebietsspezifische Anwendung genutzt werden. Viele Regelprogramme sind strukturell oder flächendeckend wirksam oder beziehen sich auf Zielgruppen. Hier ist nun zu prüfen, ob und inwieweit durch Veränderung der Programmkonstruktion (z.B. Änderung der Konditionen, Zweckbindung, Einsatzbereiche usw.) eine lokale Komponente eingebaut werden kann, die den Programmeinsatz in besonders benachteiligten Gebieten ermöglicht oder ihn dort besonders priorisiert. Diese Transformation von bestehenden Programmen zur Verstärkung des Ressourceneinsatzes ist aber meist nicht kostenneutral zu haben; Mehrkosten oder Mindereinnahmen im Landeshaushalt sind meist die Folge.
So hat Berlin beispielsweise als flankierende Maßnahme zur Gebietsstabilisierung in bestimmten Gebieten die Fehlbelegungsabgabe zeitbefristet ausgesetzt (Konsequenz: Mindereinnahmen); ein Mietenkonzept mit Aussetzen förderungsbedingter Mieterhöhungen für die Jahre 1999 und 2000 wurde beschlossen (Konsequenz: Mindereinnahmen); die Kindertagesstätten-Personalkostenverordnung wurde geändert mit einem erhöhten Personalschlüssel für Einrichtungen mit Kindern aus benachteiligten Stadtquartieren (Konsequenz: Personalmehrkosten). Lediglich die Aufhebung der Belegungsbindung in bestimmten benachteiligten Gebieten war kostenneutral.
Diese Programmanpassungen müssen natürlich, wenn sie finanzielle Auswirkungen haben, in den jeweiligen Landeshaushalt eingestellt werden; außerdem ist die Akzeptanz der zuständigen Fachverwaltung erforderlich. Hier sind daher Hürden zu überwinden; das heißt, auf den fachlichen Ebenen ist Überzeugungsarbeit zu leisten, und auf den politischen Leitungsebenen sind entsprechende Vorgaben zu machen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass zunächst ein Großteil der bisher vorgenommenen Programmanpassungen das bau-, wohnungs- und mietenpolitische Handlungsfeld betrifft, also in den Zuständigkeitsbereich der Senatsverwaltung fällt, in dem auch die Verantwortung für das Programm Soziale Stadt liegt. Schrittweise zeigt sich jedoch bereits eine Akzeptanz für gebietsorientierte Priorisierung von Fachprogrammen auch in den anderen Fachressorts.
Neben diesen zusätzlichen Effekten durch Anpassung oder Änderung bestehender Regelprogramme ist die Vernetzung bestehender Förderprogramme ein weiterer Arbeitsschritt des Landes. Hier ist nicht die bloße Addition gemeint, sondern die Nutzbarmachung verschiedener Programme zur Erzielung einer Gesamtfinanzierung für ein bestimmtes Projekt. Es sind in erster Linie abweichende Anwendungsregelungen zu treffen, Ermessensspielräume auszuloten und nutzbar zu machen, um eine Mischfinanzierung bilden zu können. Hier sind beispielsweise Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme (IdA, SAM oder ABM-Maßnahmen) mit Förderprogrammen bei der Modernisierung und Instandsetzung im baulichen Bereich zu verbinden. Diese Verknüpfungen verursachen derzeit jedoch noch einen hohen Abstimmungsaufwand.
Eine weitere Bündelungschance liegt in der Heranziehung und Nutzbarmachung von Sonderprogrammen der EU und des Bundes. Hier kann und sollte das Land diese zusätzlichen Fördermittel akquirieren und sie schwerpunktmäßig in den Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf einsetzen bzw. sie in die Gemeinden mit Quartiermanagementgebieten lenken. (Dazu gehören z.B. die EU-Programme ESF, EFRE sowie die Bundesprogramme E&C, das Freiwillige soziale Trainingsjahr und die Pilotprojekte des BMVBW zur sozialen Stadt.)
Auch Mittel und Ressourcen der Bezirke stehen zur Verfügung. Hier erwartet das Land und so haben wir es im Senatsbeschluss Soziale Stadt auch festgelegt , dass die Bezirke soweit möglich ihre Mittel prioritär in ihren benachteiligten Quartieren einsetzen. Dabei kann es sich z.B. um Mittel der Jugendförderung, der baulichen Unterhaltung, der Förderung von Projekten handeln.
Rolf-Peter Löhr
Mich interessiert natürlich am meisten, wie Sie die Akzeptanz der anderen Ressorts erreichen. Aber zuerst noch als letzter Partner in dieser Runde Herr Jasper, der im Land Nordrhein-Westfalen für die Programme Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf und Soziale Stadt zuständig ist und der damit über die längste Erfahrung mit diesem Ansatz verfügt. Nordrhein-Westfalen hat eine Evaluierung durchgeführt: Gibt es im Rahmen dieser Evaluierung Ergebnisse, die das Quartiermanagement und die damit zusammenhängenden Fragen betreffen?
|
|
Karl Jasper, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, DüsseldorfDas Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) hat im Auftrag unseres Hauses 28 Stadtteile evaluiert und dabei auch die Arbeit von 22 Stadtteilbüros untersucht. Daraus ergeben sich mehrere Feststellungen für die Zusammenfassung. Es gibt erstens keine Vorgabe des Landes an die Kommunen, Stadtteilbüros oder Quartiermanagement einzurichten. Das wäre gegen die Verfassung, Artikel 28 Grundgesetz. Aber zweitens wir empfehlen die Einrichtung solcher Stadtteilbüros. Und drittens bieten wir auch finanzielle Unterstützung an, und zwar in der Art und Weise, wie sie Herr Feist dargestellt hat, wenn Dritte als Sanierungsträger für die Durchführung von Stadterneuerungsaufgaben in den Stadtteilen beauftragt werden. |
Viertens: Die Organisationsform in allen 22 untersuchten Stadtteilbüros ist unterschiedlich. Es gibt kein Deckblatt, das man auf alle Stadtteile legen kann. Mittlerweile sind es übrigens auch mehr. Man muss auf die Spezifika der betroffenen Stadtteile Rücksicht nehmen und die Organisationsform dementsprechend ausrichten. Das ist nordrhein-westfälische Praxis. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung ein Rat: Die vorhandene Kompetenz im Stadtteil sollte von Anfang an in das Quartiermanagement integriert werden. Soziale Kompetenzen, ob das bei den Gewerbevereinen im Stollwerk oder beim Sportverein oder bei der katholischen Kirchengemeinde ist, sind die Motoren für ein aktives Bürgerleben oder auch für Engagement der Beteiligten vor Ort.
Fünftens: Kein Stadtteilbüro ist auf unbefristete Zeit installiert, sondern in der Regel werden die Verträge auf Zeit geschlossen, meistens für fünf Jahre mit der Möglichkeit zu verlängern. Aber die Stadtteilbüros haben auch den Anspruch, sich selbst überflüssig zu machen, nämlich selbsttragende Strukturen zu ermöglichen. Auch ist auffällig, dass nicht in allen Stadtteilen von Anfang an mit einem Quartiermanagement oder Stadtteilbüro begonnen wurde, sondern dies hat sich zum Teil erst im laufenden Prozess nach zwei bis drei Jahren als zwingend notwendig erwiesen.
Sechstens: Die Aufgaben, die das Stadtteilbüro vor Ort zu erledigen hat, richten sich erstens an den Adressatenkreis Bewohnerinnen und Bewohner, zweitens an die örtliche Politik und drittens an die Verwaltung, egal ob Kommunalverwaltung, Landesverwaltung oder welche Zwischeneinrichtungen die jeweiligen Verwaltungsebenen noch geschaffen haben. Und dabei muss das Quartiermanagement ständig ansprechbereit sein, umgekehrt auch ständig bereit sein, diese Adressaten von sich aus anzusprechen. Wo das gegeben ist, machen Stadtteilbüro und Stadtteil gute Erfahrungen.
Siebtens: Das Stadtteilbüro selbst muss sich vor allem um Projekte, um prozessorientierte Aufgaben kümmern. Es kann auch dazu kommen, dass einige Stadtteilbüros sogar selbst als Beschäftigungsträger auftreten, um bestimmte Maßnahmen voranzubringen. Sinn der Erkenntnis: Die Entscheidungsbefugnis im Stadtteilbüro ist zwingend erforderlich, um einen Vor-Ort-Prozess erfolgreich bestreiten zu können. Dieser wird im Wesentlichen unterstützt durch ein Stadtteilbudget, über das im Stadtteilbüro in unterschiedlichen Organisationsformen entschieden werden kann. Wir haben ein Stadtteilforum als eingetragenen Verein, in dem 60 Vereine Mitglieder sind. Sie entscheiden über ein Budget wie ein Sanierungsträger. Das zeigt, dass auch diese Art der Entscheidungsbefugnisse nicht über einen Kamm geschoren werden kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie demokratisch legitimiert sind und dass auch die Stadtteilbudgets über den Rat oder den Haushaltsausschuss zur Verfügung gestellt werden.
Wenn man achtens zur Bewertung und Empfehlung kommt, so kann man festhalten: Ein lokales Management ist erforderlich und zwar hauptberuflich für die Vernetzung der lokalen Akteure. Nur so sind selbsttragende Strukturen in Zukunft möglich. Das Stadtteilbüro muss eine Mittlerfunktion zwischen Bevölkerung, Verwaltung und Politik ausüben. Dann können wir neuntens feststellen, dass Akzeptanz und Effizienz auch im Verwaltungshandeln erhöht werden können und dass die Stadtteilentwicklung beschleunigt wird, weil durch ein aktives Bürgerengagement viele Schranken abgebaut werden und Vertrauen zurückgewonnen wird insbesondere in den Stadtteilen, in denen sich mitunter schon sehr viele von der Gesellschaft verabschiedet haben.
Zu den Anforderungen an ein erfolgreiches Stadtteilmanagement gehören zehnte Feststellung auf jeden Fall die Unterstützung durch die örtliche Politik, klare Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse, ein Stadtteiletat und eine ständige Präsenz vor Ort. Wir reden deshalb von Stadtteilbüros, um auch die lokale Verbundenheit zum Stadtteil festzuhalten. Die Größe des Stadtteils muss Überschaubarkeit ermöglichen. Das heißt, wenn der Stadtteil größer wird, muss man eventuell auch in zwei oder drei Büros vor Ort präsent sein können. Die Qualifikation lässt sich nicht an einem ganz bestimmten Berufsfeld festmachen, auch wenn Stadtentwicklung und Sozialwesen die Hauptsäulen guter Stadtteilarbeit sein können. Aber auch Verwaltungswirte oder Betriebswirte mit hervorragender Qualifikation im Umgang mit einer durchaus schwierigen Klientel können hier erfolgreich sein.
Sie hatten mich auch nach Problemen gefragt: Wenn es eng wird, zeigen alle mit dem Finger auf das Stadtteilmanagement. Jeder sollte sich aber im Klaren sein: Wer mit dem Finger auf einen Anderen zeigt, hat immer noch drei Finger gegen sich.
Rolf-Peter Löhr
Wenn aber Kooperation wirklich ernst gemeint ist, dann darf das mit dem Fingerzeigen nicht mehr sein, denn da muss jeder seinen Teil leisten. Alle auf dem Podium haben betont, dass an vielen Stellen etwas beigetragen werden kann und muss, und dass nur, wenn das alles zusammen funktioniert, etwas dabei herauskommt. Unter diesen Umständen kann sich das Quartiermanagement oder das Stadtteilbüro positiv auf die Entwicklung im Quartier und vielleicht auch in der gesamten Stadt auswirken, denn es soll nicht nur punktuell Folgen haben, sondern ein Umdenken in der gesamten Stadtverwaltung für alle Bereiche der Stadt erzeugen.
Wichtig ist mir auch noch Folgendes: Herr Gerkens sprach davon, dass die Bürger als Kunden ernst genommen werden müssen. Das ist prinzipiell richtig, aber nicht bei einem engen Kundenbegriff. Vielmehr müssen die Bürger Koproduzenten sein, das heißt, sie müssen mitwirken. Sie sind nicht nur Empfänger von Leistungen, sondern sie sind mit anderen gemeinsam Produzenten der Leistungen.
Da wir diese Tagung als eine Arbeitstagung verstehen, von der aus Impulse gegeben werden, jetzt meine Bitte an Sie alle, Fragen zu stellen und weitere Erfahrungen einzubringen.
Helene Luig-Arlt, Quartiermanagement FlensburgIch habe zwei Fragen, erstens zum Thema Verfügungsfonds oder Stadtteilbudget: Von welcher Größenordnung wird da für welche Art von Projekten ausgegangen? Woher bekommen Sie das Geld? Das sind Fragen an Frau Grandt und Herrn Jasper. Und an Frau Ritter eine Frage zum Thema Entscheidungskompetenz: Wenn sich die vier Verwaltungsressorts, von denen Sie sprachen, zu einer Gruppe zusammengefunden haben, wie ist es dann mit der politischen Entscheidung? Können Sie das dann auch wirklich umsetzen? |
|
Brigitte Grandt
Der Verfügungsfonds wird uns schon länger vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Er ist sehr wichtig für die Arbeit. Wir verwenden ihn ausschließlich zur Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten und bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil, also für Projekte, die aus der Bürgerschaft, aus den Stadtteilen, von Vereinen und Initiativen vorgeschlagen oder initiiert werden. Es kommt darauf an, dass die Mittel direkt und unmittelbar zur Verfügung stehen. Bewohner sind sicherlich schwer zu aktivieren und zu motivieren; aber wenn Ideen und Vorschläge kommen, dann brauchen wir unmittelbar diese Mittel, um sie auch umzusetzen. So ist beispielsweise eine Skaterbahn in Duisburg-Marxloh entstanden, die zusammen mit Jugendlichen gebaut wurde. So ist das mittlerweile eigenständig laufende kleine Wohnprojekt Betreutes Wohnen für türkische Mädchen entstanden. Das sind Projekte, die wir auch mit diesen Mitteln unterstützen. Es kann aber auch das Stadtteilfest sein, an dem alle Akteure und die lokale Wirtschaft teilnehmen. Was die Größenordnung betrifft: Wir brauchen rund 200$nbsp;000,- DM im Jahr.
Karl Jasper
Die Grundlage für dieses Stadtteilbudget wurde Mitte der neunziger Jahre geschaffen, als das Innen- und Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen für den Anschub in diesen Stadtteilen einen Titel als Modellfall aus Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes für besonders strukturschwache Regionen zur Verfügung gestellt haben. Er wurde 1998 in die Stadterneuerungsrichtlinien des Landes aufgenommen. Es handelt sich um Pauschalmittel zur Unterstützung bewohnergetragener Projekte. Was in den Stadtteilen letztlich umgesetzt wird in einer Größenordnung zwischen 10 000,- DM pro Stadtteil pro Jahr bis zu dem Betrag, den Sie gerade aus Duisburg gehört haben , ist das, was wir als Verfügungsfonds verstehen.
Klaus-Jürgen Holland
Auch in Hannover praktizieren wir das Instrument Verfügungsfonds mit 50 000,- DM im Jahr für einen Stadtteil von 8 000 Einwohnern; über diese Fonds verfügt das Bürgerforum für Aktivitäten der Bürger. Politisch geht das selbstverständlich noch durch die Gremien, weil es sonst haushaltsrechtliche Probleme verursacht. Aber das ist ein Fonds, der nur von der Stadt zur Verfügung gestellt und ausschließlich im Stadtteil von den Bürgern verwendet wird. Der Verfügungsfonds ist eine wichtige Bedingung dafür, dass ein Bürgerforum akzeptiert wird, weil dieses dann nämlich Mittel für Aktivitäten im Quartier zur Verfügung hat und darüber entscheiden kann.
Reinhard Thies
Wir haben in Hessen leider noch keine Verfügungsfonds. Aber wir haben außer den städtebaulichen Mitteln auch noch die Mittel des Sozialetats, zum Beispiel in Gießen: Dort hat das Sozialdezernat für das Programm Soziale Stadt etwa 400$nbsp;000,- DM jährlich zur Verfügung, die viel flexibler in die örtlichen Projekte einfließen können als die städtebaulichen Mittel, die mit dem Land abgestimmt werden müssen. Darüber hinaus haben die Träger vor Ort (Beschäftigungsträger, Träger der Jugendhilfe usw.) eigene Projektmittel, über die sie verfügen können.
Außerdem halte ich, was die Legitimation für die Vergabe aus dem Verfügungsfonds angeht, das Instrument eines Beirats für ein zentrales Element. Einerseits legitimiert dieser die Verfügung über die Mittel. Wenn in diesem Beirat die Vertreter der Bürgerschaft mindestens 51 Prozent der Mandate haben und sich natürlich auch in ihren Quartieren legitimieren müssen für das, was sie dort administrieren, dann ist das andererseits eine Einladung an die Bürger, mitzutun, auch untereinander Interessensausgleich darüber zu suchen, welche Prioritäten und welche Projekte in dem Stadtteil realisiert werden sollen. Wir haben es nicht mit einer homogenen Gruppe zu tun. Da gibt es auch Interessensgegensätze, die auszugleichen sind.
Rolf-Peter Löhr
Verfügungsfonds sind natürlich auch ein Zeichen von Machtabgabe, weil Mittelentscheidung das liebste Instrument der Politiker ist. Und wenn diese darauf verzichten, dann ist das schon eine Tat. Wichtig ist daher die Frage nach Einbeziehung der Politik in die Entscheidungsfindung.
Susanne Ritter
Wir haben in München zwei Stadtteile mit jeweils ungefähr 20 000 bis 25 000 Einwohnern im Programm. Wir starten im Vergleich zu Duisburg ganz bescheiden mit einem Verfügungsfonds von 30$nbsp;000 DM pro Stadtteil. Über diesen Verfügungsfonds kann die Koordinierungsgruppe, in der Politik, Multiplikatoren und Verwaltung vertreten sind, entscheiden. Die Gruppe hat sich dem Konsensprinzip verpflichtet. Über die Multiplikatoren jetzt verstärkt noch durch die Quartierskoordination kommen Projekte aus der Bewohnerschaft hinzu. Die Entscheidung für kleine Projekte erfolgt in dieser Koordinierungsgruppe, z.B. haben wir Farbe für eine Malaktion im Stadtteil finanziert oder einen Streetballkorb, der sonst über den öffentlichen Haushalt sehr schwer zu finanzieren gewesen wäre. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, als Verwaltung vor Ort Paten für die entsprechenden Projekte zu sein.
|
|
Kurt Bader, Fachhochschule Nordostniedersachsen, LüneburgWir haben im Kreis Kaltenmoor auch 8 000 Leute. Ich will das Problem ein bisschen zuspitzen. Ich finde es hervorragend, dass die Stadtverwaltung Farbe zur Verfügung stellt. Wir haben lange darum gekämpft, 50 000,- DM als Verfügungsfonds zu bekommen. Wir haben etwa 200 Millionen pro Jahr. Es stellt sich schon die Frage, wie groß der Entscheidungsspielraum der Bürgerinnen und Bürger ist. Man könnte ein bisschen provokativ sagen: Das ist vielleicht ein kleines Bonbon, was man den Bürgern gibt, dass sie für 30$nbsp;000,- DM Farbe bekommen und den Eindruck haben, sie könnten ihren Stadtteil mitgestalten. Wesentliche Entscheidungen werden aber woanders gefällt. |
Vorhin ist gesagt worden, es sei gut, dass die Verwaltung arbeitet, ihre finanziellen Pflichten übernimmt und damit den Stadtteil entlastet. Das klingt zunächst einmal von der Arbeitsteilung, ganz nett. Sieht man aber genauer hin die Situation in Lüneburg und vermutlich auch die in anderen Städten ist so , dann werden Entscheidungen hinter geschlossenen Türen gefällt und die Bürger mit getroffenen Entscheidungen konfrontiert. Die Entscheidungen betreffen drei, fünf oder zehn Millionen; im Unterschied dazu stehen zwei Kübel Farbe und maximal 50$nbsp;000 DM pro Jahr als Verfügungsfonds.
Ein zweiter Aspekt: Wir machen die Erfahrung, dass wir keine Schwierigkeiten haben, aktive Bürgerinnen und Bürger zu finden. Die Schwierigkeit liegt in der Verwaltung, in den Strukturen und darin, dass Kooperation im Interesse einer gemeinsamen Sache offenbar in manchen Kommunen nicht geübt wird.
Drittens halte ich die Einrichtung von Bürgerforen auf Zeit für zu beschränkt. Das würde ja heißen, es gibt ein Limit oder eine Norm der Bedürfnisbefriedigung. Wer definiert diese Norm? Wenn sie erfüllt ist, können dann diese Bürgerforen wegfallen? Das erinnert mich stark an den Slogan in der Sozialarbeit, deren Ziel es sei, sich überflüssig zu machen. Kennen Sie eine Beziehung in der Welt, von der man sagen würde, ich gehe sie ein, um mich überflüssig zu machen? Ich kenne keine. Wenn ich also davon ausgehe, dass Bedürfnisse nach oben hin offen sind und wir einen großen Bedarf haben, dann halte ich die Einrichtung von zeitlich beschränkten Bürgerforen für zu kurz.
Eine letzte Bemerkung: Es wird viel über Bürgerbeteiligung gesprochen. Das finde ich richtig und wichtig. Die Frage ist, ob wir nicht die ganze Zeit über Bürger und Bürgerinnen sprechen. Auf dem Forum ist niemand vertreten, der unmittelbar Bürger und Bürgerin in den Stadtteilen ist. Ich warne vor der Gefahr und da schließe ich mich ein , dass wir als Fachleute versuchen, permanent über Bürgerinnen und Bürger zu reden, die aber von solchen Impulskongressen weitgehend ausgeschlossen sind.
Rolf-Peter Löhr
Wenn ich von hinten anfangen darf: Verschiedene Kongresse haben verschiedene Funktionen. Wir haben vorhin von Bürgermeister Tschense und von Herrn Gerkens gehört, dass in Leipzig eine Starterkonferenz mit den Bürgern stattgefunden hat. Die Bürger bestimmen über das, was in ihrem Gebiet passiert. Das ist ja gerade das große Ziel im Programm, dass Macht an die Bürger abgegeben wird. Dass man das nicht mit einem Fingerschnipp anordnen kann, sondern dass es ein längerer Prozess ist, muss man schon allen Beteiligten zugestehen. 50 Jahre lang hat die Verwaltung in Deutschland sehr gut funktioniert und sehr gute Ergebnisse gebracht. Jetzt sehen wir, dass es so nicht mehr geht. Die Verwaltung so Frau Ritter, Herr Gerkens, aber auch die Quartiermanager bemüht sich ja in sehr vielen Fällen heute darum, anders zu verfahren.
Es kommt natürlich darauf an, dass nicht nur die Farbtöpfe und die 50$nbsp;000,- DM im Quartier entschieden werden, sondern dass dort auch ein wichtiger Beitrag zu dem geleistet wird, was an sonstigen Investitionen in das Gebiet fließt. Dass wir deswegen aber die parlamentarische Demokratie aufgeben, sehe ich natürlich nicht. Unsere Rahmenbedingungen haben sich im Prinzip gut bewährt. Der Stadtrat hat seine Bedeutung und er hat auch Interessen auszugleichen. Große Investitionen wirken über das Quartier hinaus, da kann nicht jeder für sich entscheiden. Aber es muss für die Bevölkerung Möglichkeiten geben, wesentlichen Einfluss auszuüben. Vielleicht können Sie, Herr Jasper, aus Ihrer Sicht noch etwas zu dieser Problematik sagen.
Karl Jasper
Wir haben in Nordrhein-Westfalen vor fast genau einem Jahr eine Veranstaltung unter dem Titel Quergedacht Selbstgemacht durchgeführt, auf der Initiativen aus den Stadtteilen Gelegenheit hatten, dieses Forum zu nutzen, um sich und ihre Arbeit für den Stadtteil darzustellen. Eine dieser Initiativen war ein Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 60 Vereinen in einem Stadtteil. Die haben damals mit ungefähr zehn Vereinen angefangen, sich selbst Strukturen aufgebaut und in diesem Stadtteil das Geschick selbst in die Hand genommen.
Wenn ich zeitlich befristet sage, so auch das Ergebnis des Evaluationsberichts, dann heißt das: In diesen Stadtteilen sollte man alle Kräfte bündeln und auch das Management vor Ort stark unterstützen. Das hat aber nur Sinn, wenn letztendlich diejenigen, die im Stadtteil wohnen, auch animiert werden, sich weiter zu engagieren, und wenn das, was als normale Verwaltung läuft, und das, was normal im Geschehen laufen kann, anschließend zu Strukturen kommt, die es ermöglichen, einen solchen Stadtteil sich wieder selbst zu überlassen. Es sollten dann Strukturen da sein, die einer bedeutenden Unterstützung nicht mehr bedürfen. Jeder Prozess bedarf einer Organisation. Hier läuft es dann darauf hinaus, dass diese Organisation sich selbst findet und unterstützt.
Verfügungsfonds und das Geld, das im Stadtteil sonst noch eingesetzt wird, sowie die Entscheidungsstrukturen müssen zusammengesehen werden. Man darf die Verfügungsfonds nicht z.B. gegen den Bau einer Gesamtschule stellen, die zehn oder 20 Millionen DM kostet, und sagen: Das hat nur die Politik entschieden. Die Entscheidungsprozesse sollten so angelegt sein, dass darüber in den Stadtteilkonferenzen entschieden wird. Es gibt einerseits praktische Beispiele dafür, dass auch über Großbauprojekte in den Stadtteilkonferenzen mitentschieden wird. Andererseits haben wir in einer Millionenstadt wie Köln einen Stadtteil mit vielleicht 20$nbsp;000 Einwohnern, wo Sprache erst übersetzt auch verstanden werden und außerdem dafür geworben werden muss, dass ein Stadtrat, der für eine Millionenstadt verantwortlich ist, auch die Probleme eines 20$nbsp;000 Einwohner umfassenden Stadtteils mit Priorität behandeln soll. Das ist eine Kunst, und ich habe in meinem Beitrag versucht, deutlich zu machen, dass es gute Erfahrungen gibt, wenn Quartiermanagement funktioniert.
Karsten Gerkens
Man läuft leicht ein bisschen in die Irre, wenn es um die Frage der zu verteilenden Mittel geht. Ein Beispiel: Wir vergeben morgen um 14.30 Uhr im Forum Grünau 20$nbsp;000,-DM. Das ist nicht viel Geld. Die Voraussetzung für die Vergabe waren Vorschläge der Mitglieder des Forums, die sich an den Leitlinien des Stadtteils orientieren mussten. Diese Leitlinien hat sich das Forum selbst gegeben. Morgen wird nun der erste Preis vergeben nur ein Betrag von 7 500,- DM für eine Machbarkeitsstudie zu einem Arbeitsansatz Gartenschau im Plattenbau. In dieser einfachen Machbarkeitsskizze wird herausgearbeitet, wie man an diese Frage herangehen kann. Sie dient dann der Verwaltung als Grundlage für die weitere Beauftragung. Letztlich wird aus diesem Anstoß über die Wohnungsunternehmen, über unsere Investitionen und über das Förderprogramm Weiterentwicklung großer Neubaugebiete ein Finanzvolumen mit einigen angehängten Nullen. Der Kern ist also nicht die Größe der Summe, sondern vielmehr die Entwicklung von Ideen, denn schließlich müssen die Investitionssummen aus dem großen Programm bereitgestellt werden, um diese Ansätze dann umzusetzen.
Ingo Neumann, Institut für ökologische Raumentwicklung, DresdenDrei Bemerkungen oder Fragen, erstens: Der Begriff Quartiermanagement suggeriert, dass ein Quartier gemanagt wird. Management ist normalerweise auf formale Organisationen bezogen. Ist denn ein Stadtteil eine formale Organisation mit eigener Präferenz? Oder gibt es ganz unterschiedliche Interessen, die vermischt werden und dann auch zu Konflikten führen? Zweitens: Welche Probleme sollen angegangen werden? Manchmal wird gesagt, das Hauptproblem sei die hohe Arbeitslosigkeit. Ist das wirklich das Problem? Oder geht es um Sanierungsfragen, gerade hier im Osten? Herr Gerkens hat den Leerstand und enorme Anstrengungen für die Umgestaltung angesprochen. Was ist eigentlich das Hauptziel des Quartiermanagements? Meiner Ansicht nach müsste eine Lösung an den Hauptproblemen ansetzen. |
|
Drittens: Wer sind eigentlich die Hauptakteure? Es wird immer von der Stadtverwaltung gesprochen, von den Bürgern. Es geht um eine Skaterbahn und alles Mögliche, was partizipativ entwickelt wird. Wer sind die wichtigen Akteure beim Stadtumbau? Werden Finanzdienstleister berücksichtigt? In welcher Form können sie berücksichtigt werden? Gibt es dazu Erfahrungen?
Brigitte Grandt
Zur Quartiersebene und zum Quartiermanagement: Natürlich gibt es den Stadtteil nicht. Beispiel Marxloh mit 23 000 Einwohnern, davon im zentralen Bereich 50 Prozent nicht-deutsche Bevölkerung mit Herkunftsland Türkei, und der Rest ist alteingesessene deutsche Bevölkerung, da sind Probleme verankert. Wir haben zwei Repräsentativbefragungen in Marxloh durchgeführt: Zum größten Problem gehört das Zusammenleben von Deutschen und Nicht-Deutschen. Da gibt es sehr unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse in der Bevölkerung. In der deutschen Bevölkerung ist durchaus die Meinung verbreitet, dem Stadtteil würde es besser gehen, wenn hier nicht so viele Ausländer leben würden. Die nicht-deutsche Bevölkerung meint: Immer wenn im Ortsteil etwas passiert, wird uns die Schuld gegeben; wir haben hier eine Art Sündenbockfunktion, das muss endlich aufhören, wir beteiligen uns ja auch an der Erneuerung.
Auch das ist Quartiermanagement; es braucht einen langen Atem. Es geht nicht, nur die eine Bevölkerungsgruppe zu berücksichtigen. Hier wirklich ausgewogen zu agieren, ist ein Balanceakt, den das Quartiermanagement zu bewältigen hat.
Rolf-Peter Löhr
Die Probleme sind das ist hier deutlich geworden von Quartier zu Quartier sehr unterschiedlich. Es gibt keine einheitliche Organisationsform, keine einheitliche Problemsituation, keine einheitlichen Akteursgruppen, sondern man muss wirklich prüfen, was konkret da ist. Über den Begriff Management kann man sicher streiten; das ist ein modischer Begriff. Quartiermanagement soll als Moderator der Aktivitäten und Akteursgruppen im Stadtteil fungieren, aber nicht als eine Instanz, die von oben managt. Es soll ein Entscheidungsprozess organisiert werden, an dem alle Akteure mit dem ihnen zukommenden Gewicht beteiligt werden natürlich auch der Finanzdienstleister und die Wohnungsbaugesellschaften, die ein wichtiger Akteur in den meisten Gebieten der Sozialen Stadt sind.
Die Vielfalt der morgigen Arbeitsgruppen spiegelt die Vielfalt der Probleme in den Gebieten. Es gibt kein fertiges Konzept, das man einfach umsetzen kann; so geht es heute gerade nicht mehr. Es handelt sich vielmehr um einen schwierigen und langwierigen Prozess, bei dem wir alle lernen und uns aufeinander sowie auf andere Akteursgruppen und Interessen einstellen müssen. Dies will das Programm befördern und bewirken. Man sollte versuchen, das Programm und den Ansatz zu unterstützen. Ich denke schon, dass hier gute Ansätze vorhanden sind.
Morgen geht es in den Arbeitsgruppen weiter. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Kommen, Ihre Diskussionsbeiträge, Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine erfolgreiche und innovative Tagung.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004