soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
Dr. Ulrich Klimke
Leiter der Unterabteilung Städtebau
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn/Berlin
Begrüßung
|
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier in Connewitz in einer richtigen Arbeitsumgebung zum Ersten Impulskongress im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt begrüßen zu können. Ich freue mich vor allem, dass Sie so zahlreich erschienen sind, und ich glaube, dass wir eine attraktive und auch inhaltlich sehr interessante Veranstaltung haben werden. Ihre Teilnahme zeigt, dass mit dem Quartiermanagement ein Thema aufgegriffen wird, das auf breites Interesse stößt. Mit der heute beginnenden zweitägigen Veranstaltung setzen wir wie bei der Starterkonferenz Soziale Stadt am 1./2. März 2000 in Berlin angekündigt die Reihe der bundesweiten Veranstaltungen zur Sozialen Stadt fort. Die Öffentlichkeit und vor allem die Menschen vor Ort erwarten zu Recht konkrete Arbeit und die schnell, umfassend und zielgerichtet. |
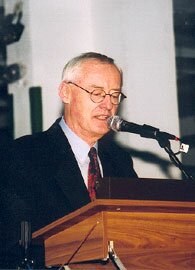 |
Der Impulskongress Quartiermanagement versteht sich daher als Arbeitstagung mit offenem und dennoch verbindlichem Charakter. Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Angebot genutzt, mit Ihrer Anmeldung Themenvorschläge für die Behandlung in den Arbeitsgruppen einzubringen und damit den Inhalt der Veranstaltung mitzugestalten. Das Deutsche Institut für Urbanistik, das im Rahmen der Programmbegleitung die Vorbereitung des Impulskongresses übernommen hat, wertete Ihre Anregungen aus. Im Ergebnis ist das Ihnen vorliegende Programm entstanden. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an das Difu.
Dieser Erste Impulskongress widmet sich mit dem Quartiermanagement einem Thema, das entscheidend für die Umsetzung der von der ARGEBAU ins Leben gerufenen Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt sein wird. Die Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt erhebt den Anspruch, Quartiersentwicklungsprozesse in Gang zu setzen, welche die sozialen Problemgebiete zu Stadtteilen mit positiver Zukunftsperspektive machen sollen. Um diesem auf der Weltkonferenz URBAN 21 bekräftigten Anspruch gerecht zu werden, stellten Bund, Länder und Kommunen seit 1999 insgesamt 600 Millionen DM zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf bereit. Im Jahr 2001 wollen wir das Programm Soziale Stadt fortsetzen und davon gehe ich aus auch darüber hinaus.
Der hohe Zuspruch zum Programm Soziale Stadt und die intensive Programmbegleitung sorgten von Beginn an für eine rasche Vermittlung des neuen Förderansatzes. Für einen Zeitraum von sechs Jahren stehen insgesamt 1,8 Milliarden DM für 210 Programmgebiete in 157 Städten zur Verfügung. Das Programm ist zudem interdisziplinär und auch ressortübergreifend.
Die Koordinierung des Programms muss auf allen Ebenen geschehen. Auf der Ebene des Bundes wurde mit anderen beteiligten Bundesressorts vereinbart, eigene Programmressourcen in die stadtentwicklungspolitische Aufgabe einzubringen. Als ein Beispiel sei das Programm Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (Kurzbezeichnung: E & C) genannt. Die Bündelung und Koordinierung auf Landesebene wird in einigen Ländern zum Teil in der institutionalisierten Form eines interministeriellen Ausschusses bereits erfolgreich praktiziert.
Ziel ist es, über das Leitprogramm Soziale Stadt Synergieeffekte herzustellen und zu nutzen, um eine quartiersbezogene Koordinierung aller stadtentwicklungspolitisch relevanten Politikfelder und Förderungsprogramme zu erreichen.
Die Verwirklichung der Projekte wird sowohl von den Akteuren im Stadtteil, der Quartiersbevölkerung, lokalen Initiativen, freien Trägern, Privatwirtschaft und Wohnungsunternehmen, Vereinen und Verbänden, als auch von Politik und Verwaltung unterstützt.
Beispielgebend für das Bemühen der Verbände um eine soziale Stadtentwicklung ist der auf Initiative des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW) ausgelobte Preis Soziale Stadt 2000 (Preisverleihung am 11. Januar 2001 in Berlin). Verbände und freie Träger sollten bei der Erarbeitung gebietsbezogener integrierter stadtentwicklungspolitischer Handlungskonzepte einbezogen sein.
Warum nun ein Impulskongress zum Quartiermanagement? Die Bemühungen zur Programmumsetzung sind auf allen Ebenen sichtbar. Es zeigt sich aber auch, dass ein Zusammenführen verschiedener Interessen und die Erarbeitung integrierter Handlungskonzepte komplexe Aufgaben sind, die ohne Quartiermanagement nur schwer zu bewältigen sind.
Und auch zum Quartiermanagement stellen sich viele aktuelle Fragen, zum Beispiel zur Zusammenarbeit unter den Akteuren, der Aktivierung der Bevölkerung, der Aufgabenstruktur und Qualifikation, der Bündelungserfolge und auch -schwierigkeiten, der Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen. Diese und andere Themen werden in den Arbeitsgruppen des heute beginnenden Ersten Impulskongresses aufgegriffen.
Die Soziale Stadt erfährt als integratives Programm unumstrittene Zustimmung, eine Fortsetzung der Aktivitäten auf allen Ebenen und in allen Bereichen ist geboten. Neben der Verstetigung des Bund-Länder-Förderprogramms Soziale Stadt können Beiträge des Bundes sein:
- das intensive Bemühen um Kooperation und Bündelung von Mitteln und Kompetenzen (z.B. weitere Zusammenarbeit mit den Verbänden und freien Trägern sowie den Bundesressorts);
- die Fortsetzung des Wissenstransfers (z.B. Zweiter Impulskongress zum Thema integrative Maßnahmenkonzepte und Bündelung 2001, Zwischenbilanz-Konferenz 2002) als Bestandteil eines bundesweiten Netzwerks für Information, Diskussion und Erfahrungsaustausch;
- die umfassende Auswertung der Ergebnisse der Programmumsetzung, um gezielt die Programmstruktur verbessern zu können (z.B. Auswertung der Befragung der Programmstädte sowie Beginn der good-practices-Untersuchungen), sowie die Verstetigung des Programms Soziale Stadt.
Mit der Umsetzung des Programms Soziale Stadt kann erreicht werden, zukünftig ein Klima der Zuversicht für die lokale Bevölkerung zu schaffen und deutliche Zeichen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lebenssituation der Betroffenen zu setzen. Die Aktivierung von Eigeninitiative, von Selbsthilfepotenzialen, die Entwicklung eines gemeinsamen Bewusstseins und die Festigung von nachbarschaftlichen Netzen sind zentrale Elemente des Programms. Die Programm-Mittel Soziale Stadt allein, die weitgehend für investive Maßnahmen zur Verfügung stehen, können nicht alle Bereiche eines integrierten Handlungsansatzes abdecken. Nur wenn neben baulichen Strukturen auch die sozialen Verhältnisse der Menschen zueinander aufgegriffen werden, wird es gelingen, Negativerscheinungen im Wohnumfeld zu begegnen. Quartiermanagement kann dabei helfen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Quartier wieder annehmen und sich stabile Nachbarschaften entwickeln.
Mit dem Ersten Impulskongress verbinden wir die Erwartung, aus Sicht unterschiedlicher Akteure zu vermitteln, welche Möglichkeiten und Handlungsspielräume das Quartiermanagement als lenkende Stelle auf Quartiersebene hat. Dabei wird es zum einen um die umfassende Wahrnehmung der Quartiersinteressen gehen, zum anderen um lenkende Aufgaben auf Quartiersebene. Ihre Mitwirkung in den Arbeitsgruppen soll dazu dienen, die Thematik Quartiermanagement in ihren vielfältigen Verflechtungen weiter zu vertiefen und praxisorientierte Anregungen herauszuarbeiten. Ich ermutige Sie daher, aktiv mitzuarbeiten und sich einzubringen; und ich wünsche uns allen einen regen Meinungsaustausch mit vielfältigen und interessanten Diskussionen.
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004