soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
MR Dr. Hans-Jochen Döhne und MR Dr. Kurt Walter, Bonn
Aufgabe und Chance einer neuen Stadtentwicklungspolitik
Ziele und Konzeption des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf-die soziale Stadt"
Mit dem neuen Programm "Die soziale Stadt" reagiert die Politik auf veränderte Rahmenbedingungen in den Städten. Um die komplizierte Problemlage in benachteiligten Wohnquartiere lösen zu können, sind integrative Handlungsansätze notwendig. Die Förderung rein baulicher Maßnahmen reicht nicht mehr aus.
Die städtebaulichen Erneuerungsstrategien der vergangenen Jahre haben sich schwerpunktmäßig darauf konzentriert, städtebauliche Missstände zu beseitigen und strukturelle Veränderungen sozial abzusichern. Das stadtentwicklungspolitische Selbstverständnis spiegelte sich dabei in der Betonung des Elementes "baulich". Diese Aufgaben werden -trotz aller Erfolge der Vergangenheit - auch in Zukunft weiterbestehen, vor allem in den neuen Ländern. Dem trägt der Entwurf der Bundesregierung für den Haushalt 1999 Rechnung, indem für das "Grundprogramm" der Städtebauförderung 600 Mio. DM Bundesfinanzhilfen vorgesehen sind, davon 520 Mio. DM für die neuen Länder. Andererseits verändern neue Trends die Rahmenbedingungen für die Städte weitreichend:
- hohe Arbeitslosigkeit (insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit)
- Zunahme einkommensschwacher Haushalte (Anstieg der Zahl der Sozialhilfeempfänger u. a. bei Alleinerziehenden mit Kindern, wachsende Zahl von nicht in das Wirtschaftsleben integrierten Ausländern und Aussiedlern)
- zunehmende Perspektiviosigkeit unter Jugendlichen, die vielerorts einhergeht mit wachsender Jugendarbeitslosigkeit, fehlenden beruflichen Chancen und - daraus häufig resultierend - steigender Kriminalität junger Menschen.
Diese Entwicklung führt zu sozialen Problemlagen, die sich jedoch nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilen. Vielmehr lassen sie sozial stigmatisierte Brennpunkte entstehen. Sichtbar wird diese Entwicklung in vernachlässigten öffentlichen Räumen, leerstehenden Gebäuden, Drogenproblemen, zunehmender Gewaltbereitschaft und Vandalismus. Betroffen sind nicht nur die großen Neubausiedlungen, sondern auch historisch gewachsene, aber vernachlässigte Stadtteile und Stadtteile mit ungelösten Konversionsproblemen.
Neuorientierung der Stadtentwicklung
Die Stadtentwicklungspolitik steht damit vor der Herausforderung, einer sozialen Abwärtsentwicklung in gefährdeten Stadtteilen entgegenzuwirken. Deshalb gilt es, Strategien zu entwerfen, die über die klassische Städtebauförderung mit ihrem primär baulichen Ansatz hinausgehen. Die Lösung der wachsenden sozialen Probleme in den Städten müssen Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam als vordringliche Aufgabe der nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik verstehen und ebenso gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln. Nicht selten steht dabei dem notwendigen quartiersbezogenen integrativen Handlungsansatz die Zersplitterung von Zweckzuwendungsbereichen entgegen. Die staatlichen Finanzhilfen verschiedener Ressorts, die jeweils für sich auf bauliche, wirtschaftliche oder soziale Verbesserungen in städtebaulichen Problemlagen abzielen, müssen deshalb auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene ressortübergreifend koordiniert und in ihrem Einsatz aufeinander abgestimmt werden. Bislang beklagen wir die Erfahrung, dass es viele richtige und nützliche politische Programme wie finanzielle Hilfen gibt, leider aber nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Künftig wird es darauf ankommen, investive und nichtinvestive Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerung "aus einer Hand" zu kombinieren und zu integrieren. Dazu zählen insbesondere die Politikfelder
- Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
- Verkehr
- Arbeits- und Ausbildungsförderung
- Sicherheit
- Frauen
- Familien-und Jugendhilfe
- Wirtschaft
- Umwelt
- Kultur und Freizeit.
Die Bündelung öffentlicher und privater Ressourcen in schwierigen Stadtgebieten folgt nicht zuletzt auch dem Gebot, die immer knapper werdenden Mittel öffentlicher Haushalte so sparsam und effizient einzusetzen wie nur eben möglich.
Die politische Reaktion der Bundesregierung
Konzepte lassen sich nicht aus dem Boden stampfen -auch und schon gar nicht in der Entwicklung neuer stadtentwicklungspolitischer Strategien. Deshalb ist gut beraten, wer die Erfahrungen anderer nutzt-denn Stadtteile mit besonders hohem Anteil sozial gefährdeter Gruppen gibt es in fast allen europäischen Staaten. Frankreich, Großbritannien und die Niederlande haben für diese Problemgebiete bereits Programme entwickelt.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland haben einige Länder auf die zunehmende soziale Polarisierung in den Städten reagiert. Der Beschluss des nordrhein-westfälischen Kabinetts zur konzentrierten Förderung von Stadtteilen, das Armutsbekämpfungsprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg und das Programm Wohnen in Nachbarschaften der Freien Hansestadt Bremen mögen als besonders signifikante Beispiele gelten.
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen haben die Gremien der ARGEBAU in einer Gemeinschaftsinitiative mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) ihre überlegungen für einen neuen Programmansatz in einem Leitfaden als Grundlage der weiteren Zusammenarbeit zusammengefasst.
Die Bundesregierung schließlich hat, und das ist der entscheidende Schritt zur Implementierung der Strategie, in der Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 eine Fortentwicklung und Neuorientierung der Städtebauförderung festgeschrieben: "Sie (die Städtebauförderung) wird ergänzt durch ein Programm .Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf-die soziale Stadt'."
Zielsetzung des neuen Programms "Die soziale Stadt“
Ziel des neuen Programmansatzes ist es, die Lebenssituation der betroffenen Menschen in benachteiligten Stadtquartieren durch eine aktive und integrativ wirkende Stadtentwicklungspolitik nachhaltig zu verbessern. Diese Zielsetzung wird verknüpft mit einer Effizienzsteigerung öffentlicher Maßnahmen durch frühzeitige Abstimmung und Bündelung öffentlicher und privater Finanzmittel auf Stadtteilebene. Mittel- und längerfristig gibt das Programm:
- Beschäftigungsimpulse durch Stärkung der lokalen Wirtschaft, Schaffung und Sicherung örtlicher Arbeitsplätze sowie Qualifizierung von Arbeitssuchenden
- soziale Impulse durch Verbesserung der Wohnverhältnisse, vor allem im Wohnungsbestand, Unterstützung des sozialen Miteinanders, Wiederherstellung von gemischten Bewohnerstrukturen durch Verbesserung der Attraktivität für Zuziehende, Schaffung von mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, Verbesserung des Infrastrukturangebotes
- ökologische Impulse durch ökologisches Planen, Bauen und Wohnen im Bestand
- politische Impulse durch den integrativen Einsatz verschiedener Politikfelder.
Die Städtebauförderung dient hierbei als Leitprogramm.
In welchen Gebietstypen kommt das Programm zum Einsatz?
Vordringlich konzentriert sich der neue stadtentwicklungspolitische Ansatz auf die Problemgebiete in
- innerstädtischen oder innenstadtnahen Quartieren in benachteiligten Regionen mit nicht modernisierter Bausubstanz und deutlich unterdurchschnittlicher Umweltqualität
- großen Wohnsiedlungen aus der Nachkriegszeit, einschließlich sozial gefährdeter Bereiche in den Plattensiedlungen der neuen Bundesländer
- darüber hinaus aber auch in Gebieten, die z. B. aufgrund ihrer peripheren Lage und - zum Teil als Folge dieser Lage - durch ihre Einwohnerstruktur vergleichbare Defizite aufweisen.
Das Förderungsprogramm bezieht Problemgebiete in den alten und neuen Ländern gleichermaßen ein.
Finanzierung und Umsetzung des politischen Ansatzes
Der Entwurf der Bundesregierung zum Haushaltsplan 1999 sieht bereits für das Jahr 1999 Bundesfinanzhilfen in Höhe von 100 Mio. DM vor; die Länder stellen die notwendigen Komplementärmittel bereit. Umzusetzen ist der neue Programmansatz durch eine von Bund und Ländern zu schließende Verwaltungsvereinbarung auf der Grundlage der in Art. 104 a Abs.4GG i. V. m. § 164 b BauGB geregelten Mitfinanzierungskompetenz des Bundes für Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung. Die Verwaltungsvereinbarung regelt - neben einer Reihe administrativer Abwicklungsmodalitäten - insbesondere die inhaltlichen Kernpunkte und - thesen sowie Lösungsansätze, den Einsatz- und Förderungskatalog, die Gebietskulisse, die Höhe der Bundesbeteiligung und den Verteilungsschlüssel.
Eckpunkte einer Verwaltungsvereinbarung 1999
Der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung stützt sich auf folgende inhaltliche Eckdaten:
- Das neue Programm wird, unbeschadet der Mittelveranschlagung in einem eigenen Haushaltstitel, in die Städtebauförderung integriert. Gleichzeitig wird jedoch der inhaltlich und strukturell neue Programmansatz deutlich herausgestellt. Mit Recht votieren für diese Lösung auch die Länder ausnahmslos: Zum einen setzt sie die Koalitionsvereinbarung überzeugend um. Zum anderen vermeidet sie einen neuen Mischfinanzierungstatbestand und beschleunigt das Umsetzungsverfahren. Die Verwaltungsvereinbarung muss klarstellen, dass der neue Ansatz sowohl die Kombination investiver und nichtinvestiver Maßnahmen als auch die Bündelung aller stadtentwicklungspolitisch relevanten Ressourcen und Kompetenzen (Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung, Verkehr, Arbeits- und Ausbildungsförderung, Sicherheit, Frauen, Familien- und Jugendhilfe, Wirtschaft, Umwelt, Stadtteilkultur, Freizeit) vordringlich auf der Ebene des Landes und der Gemeinde verlangt. Dabei versteht sich das Programm selbst, so auch die Position der Länder, als "Investitionsund Leitprogramm für die städtebauliche Gesamtmaßnahme".
- Die Schlüsselfrage bei der Umsetzung ist, wie unterschiedliche Ressourcen - primär auf kommunaler Ebene, aber auch von Bund und Land gebündelt werden können (Bild 1). Mit Unterstützung des Bundes und der Länder soll die Verwaltungsvereinbarung Wege zur Mittelbündelung eröffnen, die geeignet sind, komplexe Probleme der Stadtentwicklung zu bewältigen:
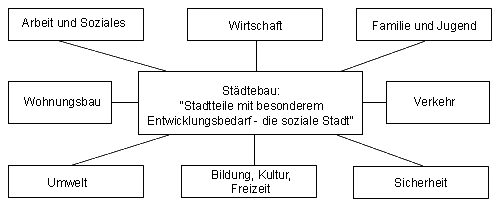
|
1) Ob und wie ab dem Jahre 2000 eine gesetzliche Regelung als Grundlage für das Programm erforderlich oder angezeigt ist, wird im Bundesverkehrs- und -bauministerium derzeit überlegt. |
Aufgaben des Bundes
Die Verpflichtung des Bundes zur Ressourcenbündelung muss selbstverständlich "im eigenen Haus" beginnen. Im Besonderen sind hier die Wohnungsbauförderung und die Finanzhilfemittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) angesprochen.
Eine Verknüpfung des stadterneuerungspolitisch qualifizierten Programms mit der Wohnungsbauförderung gewährleisten insbesondere zwei Regelungen:
- Zum einen sollen von den Finanzhilfen des Bundes bis zu ISO Mio. DM für den sozialen Wohnungsbau in städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten und in den Fördergebieten des neuen Programms eingesetzt werden.
- Zum anderen erlaubt eine Erläuterung im Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 1999 die Flexibilisierung des Mitteleinsatzes bei Maßnahmen im Wohnungsbestand. Danach können die Finanzhilfen für Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus auch in den alten Ländern 2) in städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten und dort auch für Maßnahmen der Modernisierung ohne Vereinbarung von Belegungsrechten an den geförderten Wohnungen einge setzt werden. Diese Optimierung der gesamten Rahmenbedingungen wird helfen, die Bevölkerungsstruktur in den benachteiligten Gebieten zu verbessern.
Darüber hinaus hat Bundesminister Franz Müntefering schriftlich an die betroffenen Kabinettskollegen die Bitte um Kooperation zugunsten des neuen Programms gerichtet. Ungeachtet dessen haben auch auf Arbeitsebene Gespräche des BMVBW insbesondere mit den Bundesministerien für Arbeit und Sozialordnung, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und für Bildung und Forschung die Bereitschaft zur Zusammenarbeit erwiesen. übereinstimmend und einhellig begrüßen die Ressorts die politischen Ziele des BMVBW. Konsens besteht auch darüber, dass sich die Erneuerung städtischer Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf für eine solche Maßnahmen- und Ressourcenbündelung besonders eignet. 3)
Alle Ressorts zeigen sich offen für die Notwendigkeit einer horizontalen Bündelung aller stadtentwicklungspolitisch relevanten politischen, organisatorischen und finanziellen Ressourcen. Die Umsetzung dieser Bereitschaft zur Kooperation in gemeinsame Aktionen verlangt jedoch eine "Politik der kleinen Schritte". Die Möglichkeiten müssen von Fall zu Fall gebiets-, problem- und maßnahmebezogen erörtert werden.
|
2) In den neuen Ländern gilt diese Regelung bereits seit dem Haushaltsjahr 1991. 3) Das Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend bereitet z.B. ein Programm vor, das in sozialen Brennpunkten in verschiedenen Städten ansetzt. Politik, Schulen. Betriebe und freie Träger sollen "lokale Pakte" bilden, um die Integration - insbesondere benachteiligter und ausländischer -Jugendlicher in Beruf und Gesellschaft zu fördern. Schwerpunkte des Aktionsprogramms sind "Arbeit und Jugend" sowie "Beschäftigungs- und Arbeitswelt". Dabei erscheint es wünschenswert, diese Aktionen der Jugendhilfe mit Arbeitsprogrammen zu verknüpfen. Erste Bausteine des Gesamtprogramms sollen im Zusammenwirken mit dem Bau- und Verkehrsministerium in Gang gesetzt werden. Wünschenswert wäre auch, die - in der vorigen Legislaturperiode gescheiterte - Initiative zur übertragung des städtebaulichen Arbeitsförderungskatalogs auf die alten Länder erneut voranzutreiben. |
Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
Für Bund und Länder regelt die Verwaltungsvereinbarung Präambel Nr. 3 Abs. 5 die Verpflichtung beider staatlichen Ebenen, "alle für die Entwicklung dieser Gebiete erforderlichen und bereitstehenden Mittel und Maßnahmen zu koordinieren und zu bündeln". Den Gemeinden schreibt sie zur Begleitung der Maßnahme ein "auf Fortschreibung angelegtes, gebietsbezogenes integriertes stadtentwicklungspolitisches Handlungskonzept" vor (Art. 2 Abs. 4). Dieses Handlungskonzept mit einem Planungs- und Umsetzungskonzept sowie einer Kosten- und Finanzierungsübersicht soll zur Lösung der komplexen Probleme zielorientierte integrierte Lösungsansätze aufzeigen, alle Maßnahmen zur Erreichung der Ziele - auch die anderer Bau- und Finanzierungsträger - erfassen sowie die geschätzten Ausgaben und deren Finanzierung darstellen.
Insgesamt steht so ein Bündel von Handlungsoptionen zur Verfügung, mit dem auf den notwendigen Verbesserungsbedarf in den Stadtteilen mit besonderen Entwicklungsbedarf reagiert werden kann. Auf Grundlage der von den Gemeinden zu erstellenden operativen Programme können die Mittel dann für konkrete Quartiersentwicklungsprozesse eingesetzt werden. Dabei sind zahlreiche Einsatzbereiche denkbar (s. Info-Kasten).
Haupteinsatzbereiche der Fördermittel und typische Maßnahmen im Bund-Länder-Programm
"Die soziale Stadt"
Bürgermitwirkung, Stadtteilleben
- Installation eines Stadtteilmanagements 4), das mit Priorität den Aufbau selbsttragender Bürgerorganisationen einleiten soll
- Einrichtung von Stadtteilbüros
- Bildung von Stadtteilbeiräten
- Bereitstellung von Bürgertreffs und anderen Räumen, die Gelegenheit zu Gemeinschaftsleben bieten
- Ausstattung der Stadtteilbeiräte mit kleinen Verfügungsfonds, um sie in die Verantwortung für ihre Quartiere einzubinden
- Unterstützung vieler Möglichkeiten, die Bürger durch Selbsthilfe an Maßnahmen der Stadtteilentwicklung zu beteiligen
|
4) Stadtteilmanagement soll innovative Prozesse im Quartier in Gang setzen, welche die soziale und ökonomische Lage der Bewohnerinnen und Bewohner benachteiligter Stadtteile nachhaltig verbessern. Dabei bedarf es gezielter spezifischer Interventionen organisatorischer, planerischer. technischer, ökonomischer und nicht zuletzt finanzieller Art. Dieses komplexe Arbeitsfeld bedingt ein neues Ausbildungsangebot. |
Lokale Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung
- teils privat, teils öffentlich finanzierte Gemeinschaftsprojekte mit einer Mischung von Profit- und Nonprofit-Nutzungen
- Gewerbehöfe
- Büro für lokale Wirtschaftsentwicklung
- Angebote für Existenzgründer
- Stadtteilwerkstätten
- Jugendwerkstätten
- Recyclinghöfe
- Arbeitsladen
- Stadtteilcafes
- Stadtteil- und Schulküchenprojekte
- Second-Hand-Läden
- Quartiersbetriebe für stadtteilbezogene Aufgaben wie Gartenpflege und Gebäudereinigung
- Fortbildungs-und Schulungseinrichtungen
- lokale Jobvermittlung
- Tauschringe
- Betreuungsplätze für Kinder von Berufstätigen, insbesondere von Alleinerziehenden
Quartierszentren
- "Stadtmarketing"
- Instandsetzung und Modernisierung des Zentrums
- Ansiedlung eines möglichst breit gefächerten Spektrums an Nutzungen
- Zuordnung öffentlicher und privater Gemeinschaftseinrichtungen
- Umgestaltung des öffentlichen Raums
- Ansiedlung von Wochenmärkten
Soziale, kulturelle, bildungs- und freizeitbezogene Infrastruktur
- für alle Bürgertreffpunkte, internationale Begegnungsstätten, Freizeithäuser, stadtteilkulturelle Projekte,Sporteinrichtungen,
- Gesundheitszentren, Aktionsprogramme insbesondere für Kinder und Jugendliche
- für Kinder Tagesheime. Spielwohnungen, Kinderbauernhöfe
- für Jugendliche Flächen für Bewegung und Kommunikation, Angebote für offene Jugendarbeit, Treffpunkte, Jugendhäuser, Jugendcafes, Jugendwerkstätten, Räume für Aus- und Fortbildung, mobile Spiel- und Sportangebote
- für Frauen und Mädchen eigene Treffpunkte, Werk- und Schulungsräume
- für ältere Menschen Seniorentreffpunkte Wohnen
- Einsatz von Förderprogrammen zur Auffächerung des Wohnungsangebotes
- Sonderregelungen bei der Wohnungsbelegung. z. B. Freistellung von Belegungsbindungen, Austausch von Belegungsbindungen
- Instandsetzung und Modernisierung in Altbaugebieten
- energetische Nachbesserung der Wohnungen
- Selbsthilfeleistungen bei der Modernisierung, insbesondere Gruppenselbsthilfe zur Schaffung gemeinschaftlicher Wohnformen
- Erneuerung von Gebäuden in Großsiedlungen, individuelle Umgestaltung der Fassaden. Erdgeschosszonen und Zugangsbereiche bis hin zur Betreuung von Hauseingängen durch Pförtner in Hochhauskomplexen (Concierge-Modell)
- Umnutzung von Erdgeschossbereichen für kleinere gewerbliche Betriebe
Wohnumfeld und ökologie
- Neu- und Umgestaltung von Plätzen, Straßenräumen, Gewässern, Ufern, Parkanlagen und Treffpunkten
- Spiel- und Sportplätze
- Neugestaltung und Mehrfachnutzungen von Schulhöfen
- begrünte Höfe, Mietergärten, Vorgärten, grüne Wände und Dächer
- Neuordnungen von Müllplätzen
- barrierefreie Wegeführung
- Sicherung von Fuß- und Radwegen
- Immissionsschutzmaßnahme
- Altlastensanierung
- kleinteiliges Flächenrecycling
Grundsätzliche Verfahrensschritte
- Die Verwaltungsvereinbarung wird einen deutlichen, aber nicht zu engen Gebietsbezug definieren und die Abgrenzung des Gebiets durch politischen Beschluss des Gemeinderats sicherstellen. Soweit nicht im Einzelfall das allgemeine Städtebaurecht für die Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung ausreicht, soll eine förmliche Gebietsfestlegung i. S. des Besonderen Städtebaurechts in Betracht gezogen werden. Beide Varianten gewährleisten -je nach Sachlage - eine optimiert flexible Gebietsfestlegung.
- Der Bund beteiligt sich, wie im "Grundprogramm" der Städtebauförderung, mit einem Drittel an der Finanzierung der förderungsfähigen Kosten. Die Aufteilung der verbleibenden zwei Drittel zwischen Land und Gemeinde obliegt auch hier dem Land.
- Der Verteilungsschlüssel stützt sich neben den bisherigen Parametern (Einwohner/Wohnungen) auch auf die Arbeitslosenquote eines Landes. Diese Neuerung rechtfertigt sich insbesondere daraus, dass die bereits für das Grundprogramm nur eingeschränkt sachgerechten Parameter der besonderen Zielgruppe des neuen Programmansatzes noch weniger gerecht werden können. Vielmehr ist das aufgaben- und gebietsqualifizierende Element der Arbeitslosigkeit in die Verteilung der Mittel einzubeziehen. Nach diesen Kriterien verteilen sich die Bundesfinanzhilfen auf die Länder gemäß Tabelle l.
- Nach dem Vorbild des Grundprogramms der Städtebauförderung melden die Länder dem Bund ihre Vorschläge für ein Bund-Länder-Programm.
Bündelung mit EU-Strukturfonds
In allen deutschen Ziel-1- (neue Länder flächendeckend) und Ziel-2-Regionen (Teilgebiete in den alten Ländern) können vom Jahre 2000 ab Maßnahmen gefördert werden, die der Erneuerung städtischer Problemgebiete dienen. Um die Missstände in den städtischen Problemquartieren zu beseitigen, bedarf es einer aktiven und integrativen Stadtteilentwicklungspolitik. Daher sollen - auch nach den Vorstellungen der ARGEBAU - EFRE-Maßnahmen, die sich inhaltlich mit Maßnahmen des ESF zur Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung sinnvoll verknüpfen lassen, auf städtischer Ebene integrativ eingesetzt werden.
Diese Neugestaltung der EU-Strukturfonds erlaubt die Verknüpfung der EU-Förderung mit dem nationalen Programmansatz "Die soziale Stadt" in den künftigen EU-Fördergebieten. Die dazu von den Ländern zu erbringenden Vorarbeiten sind zum April abgeschlossen worden.
Erfolgskontrolle und Programmbegleitung
Eine fachlich-operative Begleitung ist für eine Erfolgskontrolle und Zieloptimierung des Finanzhilfeprogramms vor allem in der Start- und Anlaufphase unentbehrlich; sie soll im Rahmen des Programms Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) erfolgen. Nach dem Start des neuen Finanzhilfeprogramms erscheint es sinnvoll, das Programm mit dem Ziel eines "einheitlichen Designs" zu begleiten und im Bewusstsein der öffentlichkeit zu verankern. Diese Funktion wird das Deutsche Institut für Urbanistik (difu), Berlin, als überregionale Vermittlungs-, Informations- und Beratungsagentur von Beginn an programmbegleitend übernehmen. Das difu organisiert insbesondere
- die Vorbereitung und Durchführung einer Auftaktveranstaltung zum neuen Programm
- regionale Starter-Konferenzen
- Vor-Ort-Betreuung
- Beteiligung von Experten zu Fragen der Mittelbündelung
- offensive öffentlichkeitsarbeit
- prozessbegleitende Ergebnisdokumentation.
Im Rahmen dieser "operativ-experimentellen" Begleitung können richtungsweisend in die Maßnahmen verschiedenste Bausteine integriert werden, z. B. lokale Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche. Einige ausgewählte Städte werden noch intensiver betreut.
Tabelle I.Verteilung der Bundesmittel des Programms "Soziale Stadt" auf die einzelnen Bundesländer| Land | Anteil i. v. H. | in TDM |
| Baden-Württemberg | 11,27 | 11217 |
| Bayern | 12,911 | 12911 |
| Berlin | 5,132 | 5132 |
| Brandenburg | 3,777 | 3777 |
| Bremen | 0,941 | 941 |
| Hamburg | 2,168 | 2168 |
| Hessen | 6,811 | 6811 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,729 | 2729 |
| Niedersachsen | 9,370 | 9370 |
| Nordrhein-Westfalen | 21,293 | 21293 |
| Rheinland-Pfalz | 4,428 | 4428 |
| Saarland | 1,305 | 1305 |
| Sachsen | 6,703 | 6703 |
| Sachsen-Anhalt | 4,332 | 4332 |
| Schleswig-Holstein | 3,226 | 3226 |
| Thüringen | 3,657 | 3657 |
| insgesamt | 100,000 | 100 000 |
Wege zu einer neuen Stadtentwicklungspolitik
Eingangs haben wir bereits angedeutet, dass dem neuen stadtentwicklungspolitischen Programmansatz, wie er sich in der Verwaltungsvereinbarung operativ und administrativ niederschlägt, rund zwei Jahre gemeinsamer Vorarbeiten der ARGEBAU mit dem BMVBW vorausgegangen sind. Die Umsetzung der "politischen Idee" wird gleichwohl wesentlich mehr Zeit und - vor allem - Geduld, Kontinuität und Beharrlichkeit brauchen.
Den Erfolg aktiv und sozial verantwortungsbewusst mitzugestalten, sind nicht nur die staatlichen Ebenen, Organisationen und Institutionen aufgefordert. Gerade die Kräfte außerhalb der staatlichen Funktionsträger werden beweisen müssen, dass das städtebaulichökonomisch-soziale Gesamtgefüge mehr braucht als öffentliche Förderung. Alle "vor Ort" verantwortlichen und zur Hilfe bereiten Kräfte sind aufgerufen, sich der neuen Aufgabe in ihrer ganzen Problem-, aber auch möglichen Lösungsvielfalt zu stellen: Sanierungsträger, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Ausländerorganisationen ebenso wie die Jugend-, Alten- und Arbeitslosenverbände. Der pessimistische Volksmund ist überzeugt, dass der Teufel im Detail steckt - wer aber optimistisch hinsieht, wird im Detail eher die Chance erkennen.
Gelingt eine breite übereinstimmung zwischen allen Beteiligten, kann aus dem integrierten Programm "Die soziale Stadt" - mittel- oder längerfristig - ein Grundmodell für die gesamte Stadtentwicklungspolitik werden.
MR Dr. Hans-Jochen Döhne leitet das Referat "Stadtentwicklung", MR Dr. Kurt Walter das Referat "Städtebaufinanzierung" im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.
Artikel aus: Bundesbaublatt, Heft 5/99, S.24-29
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004