soziale stadt - bundestransferstelle
besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"
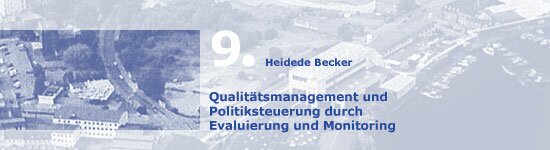
Wirkungsforschung und Erfolgskontrolle haben bereits in den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts für die Bereiche Stadterneuerung und Stadtentwicklung an Bedeutung gewonnen (1). Ausgelöst wurde dies durch die Politisierung der Planung und eine allgemeine Planungsernüchterung mit zunehmender Skepsis gegenüber den damaligen Planungsergebnissen. Gegenwärtig erhöht vor allem die prekäre Finanzlage der öffentlichen Haushalte den Rechtfertigungsdruck; darüber hinaus wirken sich die Standards der europäischen Strukturfondspolitik verstärkend auf Evaluationsanforderungen auch bezüglich von Programmen auf nationaler Ebene aus (2): Effizienz, Effektivität und Wirkungen der eingesetzten öffentlichen Mittel sollen nachgewiesen und optimiert werden; Beobachtungs-, Überprüfungsund Berichterstattungsbedarf wachsen. Mit Nachdruck wird - vor allem von Seiten der Politik - Rechenschaft darüber gefordert, welche Effekte der Einsatz öffentlicher Ressourcen hat und inwieweit die proklamierten Programmziele tatsächlich auch erreicht werden.
Evaluierung und Monitoring können dazu dienen, Transparenz und Öffentlichkeit über die komplexen Wirkungszusammenhänge der mit öffentlichen Mitteln aufgelegten Programme herzustellen, Handlungs- und Erfahrungswissen zu vermitteln, Strategien, Konzepte und Projekte zu qualifizieren, bei Fehlentwicklungen Umsteuerungen vorzunehmen und Hemmnisse für die Programmumsetzung abzubauen. Evaluierung und Monitoring werden so zu Instrumenten des Qualitätsmanagements und der Politiksteuerung.
Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Strukturfondsprogramme zählt Evaluation zum festen Aufgabenrepertoire (3). Für die erste Förderungsperiode der europäischen Gemeinschaftsaufgabe URBAN (1994 bis 1999) gab es noch keine differenzierten Vorgaben zur Durchführung der vorgeschriebenen Zwischenevaluation. Derartige Standards wurden erst im Juni 1999 in einer Verordnung des Rates grundsätzlich geregelt (4). Für die zweite Periode (2000 bis 2006) formulierten unabhängige Sachverständige Evaluationsanforderungen in der Strukturfonds-Verordnung; Indikatorenkataloge und Qualitätskriterien (5) wurden vorgegeben, um so zu einheitlichen Evaluierungsstandards und vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen. Außerdem wird die Evaluierung der Strukturfondsförderung durch die Veröffentlichung von methodischen Arbeitspapieren unterstützt. Allerdings gibt es zu diesen Standards durchaus kontroverse Diskussionen; kritisiert wird unter anderem, dass sie "aufwändig und nicht in jedem Fall problemgerecht" (6) seien. Für die zweite Phase der Strukturfondsförderung war eine Ex-ante-Bewertung auf nationaler Ebene gefordert. Im Sommer 2002 hat die Europäische Kommission zur "Einreichung von Angeboten" für die Ex-post-Evaluation der ersten Periode aufgerufen. In der Ausschreibung wird besonders betont, dass ein analytischer und nicht ein eher deskriptiver Ansatz gefordert ist; nur so ließen sich die gewünschten "politikorientierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen" erarbeiten (7).
Vor dem Hintergrund des allgemeinen "Diskussionslabyrinths um die ,Evaluation'" (8) und einer "noch vergleichsweise unübersichtlichen Fachdiskussion" (9) sind weitere Klärungsprozesse nötig. Zwar wurde 1997 die Deutsche Gesellschaft für Evaluation gegründet, um Abhilfe bei den Definitions- und Methodenproblemen zu schaffen sowie Standards für die Evaluierung zu entwickeln, doch der Begriffswirrwarr besteht weiter - nicht nur im umgangssprachlichen Gebrauch, sondern auch in der Fachdebatte. Verschiedene Begriffe werden teils synonym, teils als Ober- oder Teilkategorien verstanden; dies sind vor allem (in Klammern die hier angewendete Definition):
- Evaluation (als Resultat einer Evaluierung, mit der Prozesse und Ergebnisse von Interventionen identifiziert und bewertet werden) und Evaluierung (als Verfahren und Untersuchungsprozess; Teilergebnisse in diesem Ablauf haben dann wieder den Charakter einer Evaluation);
- Wirkungsanalyse (als kausale Zuordnung von Intervention und Wirkung) und Erfolgskontrolle (als Bewertung und Messung des Grads der Zielerreichung), zwei Begriffe, die von manchen auch synonym für Evaluation verwendet, hier aber als Bestandteile definiert werden;
- Monitoring (als begleitendes oder vorgeschaltetes datengestütztes Beobachtungs- und Analysesystem) und Controlling (als kontinuierliches Überprüfungs-, Koordinierungs und Steuerungssystem).
(1) Dazu z.B. Hellmut Wollmann und Gerd-Michael Hellstern, Sanierungsmaßnahmen. Städtebauliche und stadtstrukturelle Wirkungen (Methodische Vorstudie), Bonn 1978 (Schriftenreihe "Stadtentwicklung" des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bd. 02.012). ![]()
(2) Strukturfondsinterventionen haben sich unter anderem positiv auf die "Evaluationskultur in Deutschland" ausgewirkt, dazu Markus Eltges, Politik braucht Evaluierung, in: Informationen zur Raumentwicklung, H. 6/7 (2001), S. 325-326. ![]()
(3) Dazu weitere Beiträge in dem Themenheft Evaluation und Qualitätsmanagement der EU-Strukturpolitik, Informationen zur Raumentwicklung, H. 6/7 (2001); unter anderem die Beiträge von Thiemo W. Eser, Evaluation und Qualitätsmanagement - Anforderungen und Konsequenzen für die EU-Strukturpolitik, S. 327-339; Peter van der Knaap, Policy-evaluation and outcome-oriented management: instruments for policy-oriented learning. Recent developments in the Netherlands and the evaluation practice of the European Structural Funds, S. 359-371; Klaus Sauerborn und Martin Tischer, Evaluation und Monitoring der europäischen Strukturförderung als Qualitätsmanagement zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, S. 409-421. ![]()
(4) Allgemeine Verordnung des Rates 1260/1999 vom 21. Juni 1999. ![]()
(5) European Commission, Evaluating Socio-Economic Programms. The MEANS Collection, Luxemburg 1999, Bd. 1, S. 179: unter anderem Erfüllung der Anforderungen, zuverlässige Daten, fundierte Analyse, unvoreingenommene Schlussfolgerungen, Klarheit. MEANS steht für Methods for Evaluating Actions of Structural Nature. ![]()
(6) Eser, S. 328. ![]()
(7) Europäische Kommission, Aufruf zur Einreichung von Angeboten für die Ex-post-Bewertung der Gemeinschaftsinitiative URBAN für den Zeitraum 1994-1999 (offenes Verfahren) vom 5. Juni 2002, S. 4. ![]()
(8) Helmut Kromrey, Evaluation - ein vielschichtiges Konzept. Begriff und Methodik von Evaluierung und Evaluationsforschung. Empfehlungen für die Praxis, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, H. 2 (2001), S. 105. ![]()
(9) Karin Haubrich und Christian Lüders, Evaluation - hohe Erwartungen und ungeklärte Fragen, in: DISKURS, H. 3 (2002), S. 70. ![]()
Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005