Die verwundete Stadt:
Gedanken zur Sozialplanung der Stadt
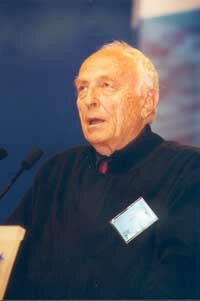 Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, an diesem Kongress über die Soziale Stadt als einziger von außerhalb Deutschlands Kommender teilnehmen zu dürfen. Vielleicht kann ein Blick - wie es heißt - "von außen" neue Perspektiven zutage fördern. Dies zumindest ist meine Hoffnung. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, an diesem Kongress über die Soziale Stadt als einziger von außerhalb Deutschlands Kommender teilnehmen zu dürfen. Vielleicht kann ein Blick - wie es heißt - "von außen" neue Perspektiven zutage fördern. Dies zumindest ist meine Hoffnung.
Mein ursprünglicher Herkunftsort ist die Donaustadt Wien, aus der ich aber schon vor mehr als 60 Jahren in die damals noch sehr weit entfernten und mir rätselhaft erscheinenden Vereinigten Staaten von Amerika auswanderte. Aber dieser Umzug war nur der Anfang einer langen Pilgerfahrt durch die Welt. In diesen sechs Jahrzehnten lebte ich unter ganz verschiedenen Umständen auf fünf Kontinenten, in Städten wie Boston, Chicago, Los Angeles, Rio de Janeiro, Santiago, Seoul, London, Melbourne, und gegenwärtig in Vancouver. Mein "Blick von außen" ist also ein sehr vielseitiger, von diversen Kulturen und sozialen Gebilden geprägter Blick.
Von Beruf bin ich Raumplaner und Entwicklungsforscher, und das Thema, welches ich in den nächsten 30 Minuten ansprechen möchte, stammt aus dieser Praxis und betrifft den doppelten und dialektisch aufgefassten Maßstab der Sozialplanung. Die Parole soll etwa so lauten: "Denke und handle klein ... aber auch groß." Erlauben Sie mir bitte, diese etwas allzu dicht kondensierte, enigmatische Anweisung zu erklären.
Obwohl man sich eine ganze Reihe von Dingen unter dem Begriff "Soziale Stadt" vorstellen kann, bedeutet sie, so meine ich, für uns hier in Berlin hauptsächlich die bedürftige Stadt, oder besser gesagt, die Stadt benachteiligter wenn nicht völlig ausgegrenzter Mitbürgerinnen und Mitbürger - also nicht nur Quartiere -, die eben ihrer Situation wegen im Brennpunkt unserer Bemühungen stehen. Mitbürger - das sind jene, mit denen wir das tägliche Leben teilen, also z.B. auch ausländische Migrantinnen und Migranten. Problematischer ist es, was man sich bei dem Begriff "Bedürftigkeit" (human needs) denken soll, denn der ist nicht einfach mit Armut im konventionellen Sinne gleichzusetzen.
In den 70er Jahren begann die Internationale Arbeits-Organisation (ILO) in Genf ein großes Forschungsprogramm, in der Hoffnung, es wäre möglich, einen Begriff menschlicher Grundbedürfnisse herauszuarbeiten, der dann mit Priorität in nationalen Entwicklungsplänen eingebaut werden sollte. Aus unterschiedlichen Gründen kam es aber leider nicht dazu, und an Stelle von Grundbedürfnissen trat die Ideologie des Neoliberalismus mit ihrem Wachstumswahn und der Illusion des Nachtwächterstaates Modell 2000.
Dennoch klärte die Debatte um menschliche Grundbedürfnisse - basic human needs - so manches, wie z.B. die Einsicht, dass die Befriedigung rein materieller Bedürfnisse, wie ausreichende Nahrung, ein biologisches Minimum an Wasser, dem Klima und der Kultur angepasste Kleidung sowie ein Dach über dem Kopf, obzwar unentbehrlich, noch lange nicht ausreicht, um minimalen menschlichen Ansprüchen - social claims - gerecht zu werden. Welche "Bedürfnisse" man noch zu diesem materiellen Kern hinzu stellen könnte, wurde nicht nur heftig diskutiert, es war auch schwierig, wenn nicht ganz unmöglich, sie alle unter ein volkswirtschaftliches Dach zu bringen, wie dies der allgemeine Auftrag verlangte. Ich möchte zumindest einige Andeutungen machen, welche nichtmateriellen Bedürfnisse da gemeint waren. Bemerken Sie bitte wohl, dass es hier um basic human needs geht, also nicht um einen Begriff der Armut selbst, sondern eher um einen anthropologischen Begriff, was es bedeuten soll Mensch zu sein. Im Folgenden will ich gar nicht erst versuchen, einzelne Bedürfnisse zu hierarchisieren, wie z.B. persönliche Sicherheit, soziale Anerkennung menschlicher Würde, gegenseitige Verbundenheit, persönliche Handlungsautonomie, produktive Arbeit, gleichen Anspruch auf soziale Rechte, kulturelle Freiheit und Ähnliches mehr. In praktischer Sicht könnten diese teilweise Endziele einer gesamten sozialpolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung sein, zum Teil könnten sie aber auch die erforderlichen Rahmenbedingungen einer umfassenden, also nicht nur rein ökonomisch definierten "Entwicklung" darstellen.
Über diesen Umweg durch die Begriffswelt menschlicher Grundbedürfnisse kommen wir zurück auf die Frage, was Bedürftigkeit eigentlich heißen soll. Meine Antwort darauf ist, ganz schlicht und einfach, dass menschliche Bedürftigkeit immer dort besteht, wo irgend eines der genannten Grundbedürfnisse nicht eingelöst wird. Nun ist es aber auch der Fall, dass mangelnde Erfüllung von bestimmten Grundbedürfnissen oft gebündelt auftritt, so z.B., dass Wohnungsnot oder lange Arbeitslosigkeit zugleich mit dem Verlust sozialer Anerkennung, autonomen Handelns und im Falle von ausländischen Migranten und Migrantinnen oft auch mit dem Verlust von gleichen Rechtsansprüchen und kultureller Freiheit verbunden ist. Bei der Charakterisierung einzelner Personen sowie auch sozialer Gruppen kann natürlich das Zusammentreffen dieser traubenförmig gebündelten (clustered) Bedürfnisse, die dann die Betroffenen negativ stigmatisieren, ganz verschieden sein.
Nun muss man sich aber fragen, ob Bedürftigkeit in diesem erweiterten Sinn auch als sozialer Anspruch gelten kann - a social claim - oder weiter nichts mehr ist als die blinde Hoffnung, dass es einmal anders werden könnte oder zumindest sollte. Noch schlimmer wäre es, wenn man sich zuletzt selbst als Urheber dieser Bedürftigkeit anklagt. Hier ist die Schlüsselfrage, wer eigentlich für eine solche Bedürftigkeit verantwortlich ist: ob der Staat, die Kommune, die organisierte Zivilgesellschaft oder ganz einfach jeder Einzelne für sich allein. Für Anhänger des Neoliberalismus ist die Antwort ganz klar und deutlich: Jedermann ist für seine eigenen Lebensumstände selbst verantwortlich. Sind seine "Grundbedürfnisse" nicht eingelöst, so hat er nur sich selbst zu beschuldigen. Sozialisten waren einmal anderer Meinung; sie behaupteten, dass menschliche Bedürftigkeit eine rein soziale Frage sei, also eine Frage menschlicher Solidarität, und dass deren Bekämpfung eine staatliche Aufgabe sei. Manche denken auch heute noch so, obwohl einige von uns schon einmal die kalte Hand der Bürokratie erfahren haben, als unsere verschiedenen Lebenswelten in die Systemwelt des Staates eingeordnet wurden, ohne dass gewisse Grundbedürfnisse, wie z.B. persönliche Autonomie des Handelns oder Bewahrung menschlicher Würde, berücksichtigt wurden oder überhaupt in der Gedankenwelt der staatlichen Behörden auftauchten. So lebte man eben als ein untertäniges Subjekt und war noch für die magere Sicherheit, die einem zugesprochen wurde, dankbar. Die Chinesen nannten so etwas Ähnliches die "eiserne Reisschale." Eine selbständige Zivilgesellschaft war für diesen Fall nicht vorgesehen.
Nun ist aber die Frage, ob es zwischen Calvinistischer Selbstgeißelung und eiserner Reisschale noch eine dritte Möglichkeit gibt, die im Stande wäre, die Verantwortlichkeit für soziale Notstände anders zu verteilen. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich Sie bitten, mit mir einen zweiten Umweg zu machen, der uns zuerst in das Dickicht der Lebenswelt oder, genauer gesagt, in die vielfältig gestalteten Lebenswelten der Stadt hineinführt.
Systemwelt und Lebenswelt, dieses, laut Habermas, sich anscheinend stets selbstbekämpfende Zwillingspaar von Begriffen: einerseits die Welt der großen Ordnungen - der Ministerien, der Multinationalen, der Wissenschaft, der Technik, und, ja, auch der Stadtplanung -, das heißt also die Welt der Ratio; auf der andern Seite die bunte Welt des Alltags, die sich in den kleinen Räumen der Stadt abspielt - auf der Straße, in Nachbarschaftskneipen und anderen Lokalen der Geselligkeit, im Kleinhandel, in Wohnbauten, am Kinderspielplatz, in Kirchen, Tempeln, Moscheen und Synagogen. Im Grunde genommen ist die Lebenswelt das Terrain der Zivilgesellschaft, die sich ihr Leben in den Klein- und Kleinsträumen der Stadt aufbaut und sich sträubt, von der sich immer weiter ausdehnenden Systemwelt "kolonisiert" zu werden. Es ist dies die Welt des täglichen Kampfes um die persönliche Selbstbehauptung und der unmittelbaren menschlichen Beziehungen, die es uns erst ermöglichen, die Hindernisse, die uns immer wieder im Leben begegnen, zu bewältigen und unser Dasein so sinnvoll zu gestalten wie es eben geht. Besonders für unsere benachteiligten Mitbürger, wie z.B. ältere, gebrechliche Menschen, allein stehende Mütter mit Kleinkindern, Langzeit-Arbeitslose, Jugendliche ohne berufliche Aussichten, körperlich und geistig Behinderte, nicht deutsch sprechende Migrantinnen und Migranten, Obdachlose, Drogenabhängige und alle anderen sozial ausgeschlossenen Menschen, ist die Lebenswelt der Quartiere fast die einzige Welt, die sie kennen, und wo sie sich noch irgendwie geborgen fühlen. Aber diese ihre Welt ist, wie ihr eigenes Leben, eine tief verwundete, wenn nicht gänzlich zerstörte Welt, die sich nach Heilung sehnt.
Jene, denen sie begegnen, sind aber keine Heilsbringer, sondern Agenten der über ihnen aufgebauten Systemwelt, deren Aufgabe es ist, eine Ordnung eigener Art zu schaffen und damit zu verhindern, dass sich dieses "Chaos" der Bedürftigkeit auch noch auf die umgebenden, schon brav geordneten und kolonisierten Lebensräume ausdehnt. Da begegnen sie Polizeibeamten, Bauinspektoren, den guten Leuten vom Sozialamt, die überall etwas nachzuspüren haben, den Abgesandten der Stadtentwicklungsorganisationen und Bodenspekulanten, den city planners, den Rattenfängern vom Gesundheitsamt, den Herren des Immigrationsdienstes, den uniformierten Boten der Heilsarmee, die es sowieso nicht fertig bringen die Stadt zu heilen, und jeder einzelne von ihnen ist angestrengt bemüht, seine schon programmatisch zugeschnittenen, monoton-funktionellen Aufgaben so effizient wie möglich zu verrichten. Und fast keiner nimmt das Notstandsquartier als eine, allerdings verwundete, aber immerhin noch vitalfähige Lebenswelt von zwischenmenschlichen Beziehungen wahr, und dann wundert man sich, warum sie, die Ordnungsschaffenden, dort nicht mit offenen Armen begrüßt werden, sondern immerzu auf Widerstand stoßen.
Dabei wäre noch zu bemerken, dass die zwei Welten sprachlich kaum im Stande sind, sich gegenseitig zu verständigen. Denn was hört man denn auf der Straße in den Nachbarschaften? Hier ein Getuschel auf Albanisch, dort ein paar Brocken Spanisch oder Türkisch, und überall ein Murmeln von afrikanischen, südasiatischen und chinesischen Dialekten. Und es brauchen gar nicht Ausländer zu sein, denn auch wenn man deutsch spricht, unterhalten sich die Nachbarn eben nicht auf Hochdeutsch über die Planungsvorhaben des Staates, sondern erzählen sich eher Berliner Geschichten von diesem oder jenem konkreten Fall, Geschichten, die viele von uns vielleicht als "nur dummes Geschwätz" bezeichnen würden, als wollten wir sagen, dass wir's doch nicht so ernst nehmen, denn was weiß schon das Volk von den großen Stadtproblemen, die wir bewältigen müssen. Wir hingegen, die wir den mächtigen Organisationen der Systemwelt angehören, haben unsere eigene Art uns auszudrücken. Wir können Statistiken jeglicher Art zitieren und gehen mit Begriffen um wie Lebenswelt und postmodernity (ein dazwischen geschobenes englisches oder französisches Wort proklamiert ja einen gewissen Bildungsstand), ohne völlig in Verwirrung zu geraten. In solchen Fällen lässt sich ein "kommunikatives Handeln," das man möglicherweise zwischen Lebens- und Systemwelt einschalten könnte, schon rein sprachlich gesehen, schwer vorstellen. Da müssten erst Brücken gebaut werden.
Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben von dem, was ich hier meine. Der Standort ist Hongkong Island. Als ich vor wenigen Jahren an einem Sonntag dort war, um die Fähre nach Kowloon zu nehmen, bot sich mir ein erstaunlicher Anblick. Wohin immer ich schaute, in allen Passagen, auf den Straßen, Gehsteigen und öffentlichen Plätzen in der engeren Umgebung von Hongkong Central sah ich eine Menge junger Philippininnen, die sich dort versammelt hatten. Sie waren in kleine Gruppen aufgeteilt, saßen auf Decken, die sie schön ausgebreitet hatten, und taten nichts anderes, als sich Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen, Briefe zu schreiben, hausgemachte Spezialgerichte miteinander zu teilen, ein bisschen Musik aus der Heimat zu spielen und zu tratschen und zu tratschen. Die Philippininnen - die meisten waren in privaten Haushalten als Dienstboten beschäftigt - kamen zu diesem wöchentlichen Rendezvous mit ihren Gefährtinnen aus allen Stadtteilen Hongkongs, es waren ihrer vielleicht an die Zehntausend, und die Regierung erlaubte dieses Zusammenkommen einer sonst territorial zerstreuten Lebenswelt - einer lebendigen sozialen Stadt mit ihrem eigenen Rhythmus innerhalb der Metropole - und sperrte an jedem Sonntagnachmittag Hongkong Central für den Lokalverkehr.
Der erfolgreiche Kampf der Philippininnen mit den damals in Hongkong regierenden Autoritäten um ihr "Recht zur Stadt", in der berühmten Redewendung Henri Lefebvres, war schwer errungen gewesen. Man könnte nun sagen, dass das eben ein einzelner Fall war, und dass nichts daraus zu lernen sei. Dennoch meine ich, dass diese kleine Geschichte uns recht viel zu lehren hat. Lassen Sie mich bitte die hauptsächlichen Ideen kurz zusammenfassen.
Der Kampf der Philippininnen um ihr "Recht zur Stadt" in Hongkong war nicht allein nur das, sondern auch ein Kampf um ihre eigene Selbstbehauptung als ausländische Frauen in einer fremden Stadtregion, wo sie gewisse Mitbürgerrechte beanspruchten. Darüber hinaus war es ihr Kampf um das (nicht-materielle) Recht kultureller Freiheit und gegenseitiger Verbundenheit und damit zu ihrer eigentlichen Menschlichkeit. Wichtig für uns ist es zu bemerken, dass sie diesen Kampf - und es war ein tatsächlich jahrelanger Kampf - auf eigene Initiative unternahmen und damit ihrer Handlungsautonomie direkten Ausdruck gaben. In der Tat war ihr mutiges Unternehmen ein Versuch, ihre territorial völlig zerstreute Lebenswelt - etwa ihr transnationales Familienleben - irgendwie ganz zu machen, also zu heilen. Sie konnten den Schmerz der Einsamkeit und des Heimwehs durch ein solidarisches Handeln überwinden, indem sie verlangten, die kleinen öffentlichen Räume von Hongkong Central, einem winzigen Bruchteil der autonomen Region, wöchentlich ein paar Stunden für sich zu beanspruchen.
Wie jede andere Großstadt hat Hongkong natürlich Hunderte von solchen Lebenswelten. Manche von ihnen sind auf Kleinquartiere konzentriert, andere, wie die der Philippininnen, sind über ein kleineres oder größeres Territorium verstreut. Obzwar einige dieser Lebenswelten keine besonderen Probleme aufzeigen, sind andere im tiefsten Sinn verwundete Welten. Und so möchte ich nochmals zu meiner vorherigen Frage Stellung nehmen, wer denn eigentlich die Verantwortung für das Einlösen sozialer Grundrechte der lokalen Mitbürgerschaft tragen soll. Ich meinte, dass es vielleicht einen dritten Weg in der Aufteilung sozialer Verantwortlichkeit für die verwundete Stadt zwischen extrem individualistischen einerseits und kollektivistischen Ideologien andererseits gebe. Vier mögliche Akteure - Staat, Kommune, Zivilgesellschaft und der einzelne Mensch - müssen hier genannt werden. Ohne eine bestimmte Situation im Auge zu haben, ist es allerdings schwierig, eine nähere Antwort zu geben, denn Antworten müssen ja immer von konkreten Zusammenhängen bestimmt werden. Dennoch glaube ich, dass wir eine generelle Formel andeuten können, und zwar die, dass die soziale Verantwortung für Grundbedürfnisse auf alle vier Akteure fallen muss, obzwar nicht auf alle im gleichen Maße.
Einzelstehende können wenig, eigentlich gar nichts tun, um sich selbst zu heilen. Diese Art des Hyperindividualismus spricht dem Sozialen kurzweg alle Wirklichkeit ab, sodass zuletzt, wie es uns Thomas Hobbes lehrte, nichts anderes übrig bleibt als nackte Machtverhältnisse. Wie ich es am Beispiel der Philippininnen in Hongkong gezeigt habe, verlangt jede Heilungsaktion der Stadt ein mehr oder weniger aktives Mitwirken der Systemwelt des Staates. Ohne vorhergehende Selbstmobilisation der philippinischen Migrantinnen wäre es allerdings der Hongkonger Regierung nie eingefallen, etwas zu tun, um den mitbürgerlichen Ansprüchen ausländischer Arbeiterinnen gerecht zu werden, und noch weniger wäre sie auf die Idee gekommen, Hongkong Central als Treffpunkt für Abertausende von philippinischen Dienstboten wöchentlich zu reservieren. In diesem Fall allerdings waren Staat und Kommune auf einen einzigen Nenner gebracht, ebenso wie der begriffliche Unterschied zwischen organisierter Zivilgesellschaft und persönlicher Handlung durch die kollektive Aktion der jungen Frauen aufgehoben wurde. Anderenorts aber könnten die vier genannten Akteure gesondert auftreten.
Viel hängt von der Kapazität der betroffenen Mitbürgerschaft zur Selbstorganisation ab, die mitunter gefördert werden muss, und zwar hauptsächlich durch die nicht-staatlichen Organisationen der so genannten Zivilgesellschaft. Und die Kommune müsste natürlich auch irgendwie daran beteiligt werden, sei es durch finanzielle und materielle Hilfsmittel sowie durch die offizielle Anerkennung der wichtigen Rolle, die lokale Bürgerorganisationen in der Stadtentwicklung spielen können. Zuletzt ist es natürlich der zentrale Staat, der dem ganzen Prozess eine gewisse Legitimität zusprechen muss durch die Bereitstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die alles andere erst ermöglichen.
Vor allem gilt es die vielfältigen Lebenswelten der Stadt zu erkennen und zu respektieren sowie - und das dürfen wir nicht vergessen - auch die materiellen und die nicht-materiellen Grundbedürfnisse, die zugleich Rechtsansprüche unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, ernst zu nehmen. Lebenswelt und Systemwelt stehen sich nicht unbedingt feindlich gegenüber. Unter vielem anderen ist die Stadt auch ein dichtes Netz zwischenmenschlicher Beziehungen. Solange dieses Wort richtig verstanden wird und das Prinzip des Dialogs und des kommunikativen Handelns eingesetzt wird, dürfte es möglich sein, selbst tief verwundete Städte wieder heil zu machen.
|
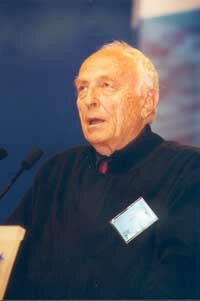 Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, an diesem Kongress über die Soziale Stadt als einziger von außerhalb Deutschlands Kommender teilnehmen zu dürfen. Vielleicht kann ein Blick - wie es heißt - "von außen" neue Perspektiven zutage fördern. Dies zumindest ist meine Hoffnung.
Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, an diesem Kongress über die Soziale Stadt als einziger von außerhalb Deutschlands Kommender teilnehmen zu dürfen. Vielleicht kann ein Blick - wie es heißt - "von außen" neue Perspektiven zutage fördern. Dies zumindest ist meine Hoffnung.